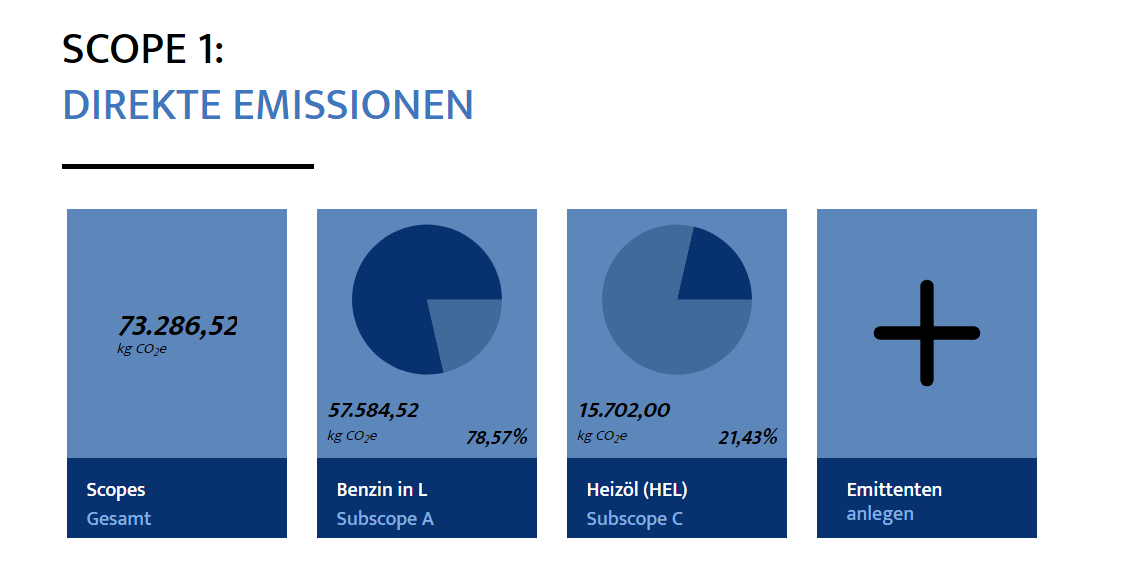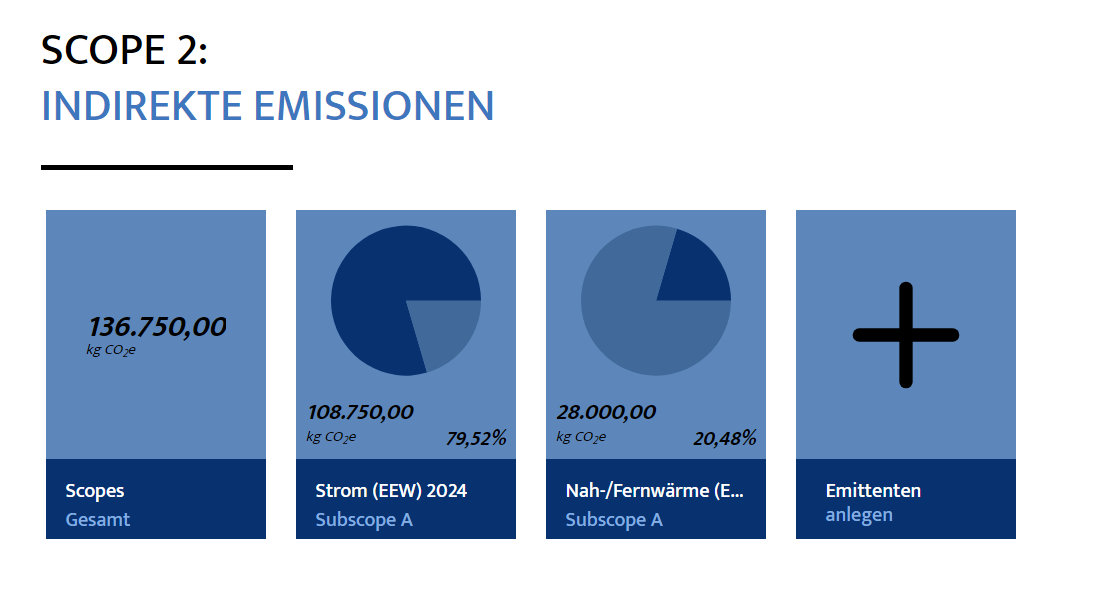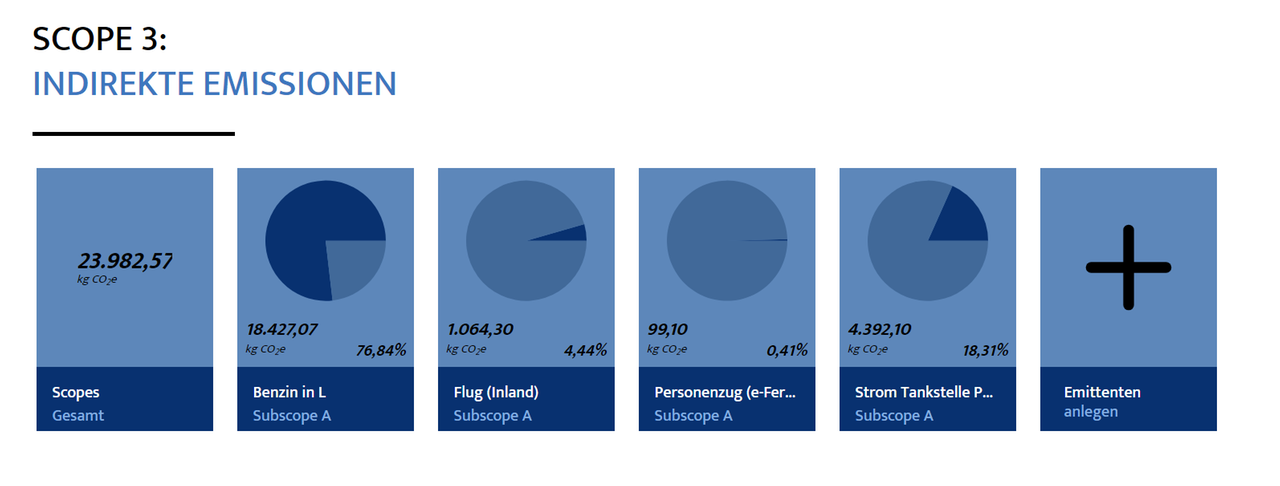Zoll "Deals" USA - Rest der Welt
- Aktuelles: “Notice of Action Letters” der U.S. Customs and Border Protection
- Umfrage zum Zoll "Deal" EU-USA
- 1. US-Zusatzzölle 2025 - allgemein
- 2. Reciprocal Tariffs - Angeblich reziproke länderspezifische Zölle
- 3. Zollerhebungen auf Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und bestimmte Waren daraus
- 4. Zusatzzölle auf Autos und Autoteile
- 5. Welche Fragestellungen gibt es?
- 6. Exkurs: Ursprung und Zollwert
- 7. Was kann man tun?
Aktuelles: “Notice of Action Letters” der U.S. Customs and Border Protection
Unternehmen, die Vollmetallwaren einführen, sollten sicherstellen, dass sie alle relevanten Herstellungskosten korrekt dokumentieren, um die Gefahr einer “Notice of Action” und der damit verbundenen Zollforderungen zu minimieren.
Umfrage zum Zoll "Deal" EU-USA
Wir haben Sie um Ihre Einschätzung der Verhandlungsergebnisse in einer Blitzumfrage gebeten. Bundesweit haben über 3.000 Unternehmen teilgenommen. Die Ergebnisse werden als “bittere Pille” wahrgenommen.
1. US-Zusatzzölle 2025 - allgemein
- Fast alle Waren, sofern nicht bereits anderweitig durch Zusatzzölle erfasst: so genannte reciprocal tariffs
- Kupfer und Waren daraus: Adjusting Imports of Copper (section 232)
- Autos und Autoteile: Imports of Automobiles and Automobile Parts (section 232)
- Aluminium und bestimmte Waren daraus: Adjusting Imports of Aluminum (section 232)
- Eisen/Stahl und bestimmte Waren daraus: Adjusting Imports of Steel (section 232)
- Zölle wegen Drogenausgangsstoffen gegen China, Mexiko, Kanada
- Weißes Haus Rubrik News:
- Fact Sheets
- Presidential Actions
- Federal Register Presidential Documents mit den jeweiligen Warennummern
- Executive Orders
- Proclamations
- Suchhilfe: Verwenden Sie die Schlagworte „Import”,„2025” dann „presidential document” und den verursachenden Präsidenten.
- Die amerikanische Zollbehörde, die US Customs and Border Protection veröffentlicht regelmäßig CBP Updates und FAQs für Importeure zu den neuen Sonderzöllen im sog. Cargo Systems Messaging Service CSMS. Diese Updates sind vergleichbar mit unseren ATLAS Informationen und enthalten wichtige technische Details. Man kann diesen Infodienst abonnieren.
- Aktuelle Informationen zu wichtigen Details werden fortlaufend von der GTAI veröffentlicht. Dort gibt es auch FAQs
- Zusatzzölle, die (auch) Waren mit EU-Ursprung betreffen und in Kraft sind, sind in der Datenbank Access2Markets abgebildet.
-
Weiterhin gibt es inzwischen Zollrechner. Wir haben auf ein Beispiel verlinkt.
2. Reciprocal Tariffs - Angeblich reziproke länderspezifische Zölle
2.1 Welche Zölle gelten seit dem 7. August 2025 für die EU?
Die EU und die USA haben am 27. Juli einen Zoll "Deal" abgeschlossen, der seit dem 7. August 2025 gilt. Eine Übersicht wurde von der GTAI zusammengestellt.
Grundsätzlich soll für EU-Ursprungswaren bei der Einfuhr in die USA ein pauschaler Zollsatz von 15 Prozent ohne Hinzurechnung der bisherigen Zollsätze des US-Tarifs gelten - auch für Autos und Autoteile.
Das gilt nicht
- für bestimmte “strategische” Güter, die zollfrei sind
- falls der bisherige US-Zollsatz höher als 15 Prozent. Dann bleibt der bisherige Zollsatz bestehen.
- für Produkte, die unter Section 232 fallen wie Eisen, Stahl, Aluminium und Kupfer sowie bestimmte Derivate. Hier finden weitere Verhandlungen statt. Quotenregelungen sind angedacht.
Die bisherige Zollfreiheit für Sendungen bis 800 Dollar Warenwert ist generell und unabhängig vom Warenursprung zum 29. August 2025 entfallen.
Der US-Zoll hat Einzelheiten zur Umsetzung dieses “Deals” in der Nachricht CSMS # 65829726 veröffentlicht.
Bei der Einfuhr in die EU sollen zahlreiche US-Ursprungswaren zollfrei werden. Die EU-Gegenmaßnahmen wurden vorläufig ausgesetzt.
Maßgeblich für die Anwendung des US-Zollsatzes dürfte das Verzollungsdatum in den USA sein, bestenfalls könnte es eine Regelung für “schwimmende Ware” geben.
2.2 Neue US-Zölle, Beispiele für EU-Ursprungswaren
| US-Warennummer | US-Zoll bis 6.8.25 | US-Zoll ab 7.8.25 (EU-Ursprung) OHNE GEWÄHR! |
| 3004 (Arzneiwaren) | 0% | 15% |
| 6201 20 11 10 (best. Mäntel) | (16.3% of FOB value + 41.0 ¢/kg) +10% | 16.3% of FOB value + 41.0 ¢/kg |
| 7326 11 (Mahlkugeln) (Section 232, ohne ggf. anteilige Verzollung des Nichtmetallanteils) | 0% + 50% | 0% + 50% (Verhandlungen über Quoten/Zollsenkungen laufen) |
| 8466 20 80 65 (Werkstückhalter) | 3,7% + 10% | 15% |
| 8703 40 00 10 (PKW, Benziner..) | 2,5% + 25% | 15% |
2.3 Spezialfall China
Diese China-Sonderregel wird für Eingänge ab 29.08.2025 durch die globale Regelung abgelöst, die im Folgenden erklärt wird.
2.4 Aussetzung der De minimis-Regel weltweit
Wie ist die Behandlung von Postsendungen geregelt?
Postsendungen sind nicht mehr de-minimis-frei, und werden über ein Sonderverfahren abgewickelt: Der Post-/Transportdienstleister erhebt die Zölle nach der im Erlass festgelegten Methode (Section 3) und führt sie an die US-Zollbehörde (CBP) ab. Bemessungsgrundlage ist dabei ausdrücklich der Ursprung – der Erlass knüpft die (ad-valorem- oder pauschale) Abgabe an den “IEEPA-Tarifsatz des Ursprungslandes”; daher muss das Ursprungsland für Postsendungen gegenüber CBP deklariert werden. Postdienstleister können zwischen den beiden genannten Abgabearten wählen.
Es ist somit entweder ein Wertzoll (Ad-valorem-Methode) gemäß dem effektiven IEEPA-Tarif für das Ursprungsland oder
ein pauschaler Artikelzoll (specific duty) zu entrichten. Die Pauschalzölle richten sich ebenfalls nach dem effektiven IEEPA-Tarif des Ursprungslandes und betragen zwischen US$80 und US $200 pro Paket. Liegt der IEEPA-Zollsatz unter 16 Prozent fallen US $80 an. Bei einem IEEPA-Satz zwischen 16 und 25 Prozent fallen US $160 und bei einem IEEPA-Satz über 25 Prozent fallen US $200 an. Die Methode der Pauschalzölle gilt für lediglich sechs Monate, danach ist nur die Ad-valorem-Methode zulässig.
Die U.S. Customs and Border Protection (CBP) hat die Antworten auf Fragen zum internationalen Postverkehr und den geltenden Zollsätzen auf ihren aktualisierte FAQ-Seite zum Thema E-Commerce zusammengestellt.
3. Zollerhebungen auf Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und bestimmte Waren daraus
- Bei Stahlprodukten beträgt der zusätzliche Zollsatz derzeit 50 Prozent, für Waren mit Ursprung im Vereinigten Königreich 25 Prozent.
- Bei Aluminiumprodukten gelten je nach Ursprungsland 25 Prozent oder 50 Prozent.
- Bei Kupfer seit 1. August 2025 ebenfalls 50 Prozent.
Sofern eine saubere Wertaufteilung zwischen Metall- und Nicht-Metallanteil vorliegt, wird auf den Nicht-Metallanteil kein Section 232-Zoll, sondern ein sogenannter "reciprocal tariff" erhoben. Dieser wird gesondert nach HTS-Position 9903.01.25 berechnet und richtet sich nach den regulären Zollregelungen für die jeweilige Warenart. Der Nicht-Metallanteil muss dabei als separate Position in der Zollanmeldung ausgewiesen werden. Der Metallanteil ist im Gegenzug explizit von den reciprocal tariffs ausgeschlossen (vgl. HTS 9903.01.33). Die entsprechenden FAQs finden Sie hier:
CSMS #64384496 und CSMS #65236374.
Die Informationen für Kupfer finden Sie unter CSMS # 65794272
Neue Pflicht zur Angabe von Schmelz- und Gießland bei Aluminiumimporten und betroffen Produkten daraus seit dem 28. Juni 2025
Laut Mitteilung der CBP (CSMS #65340246 vom 13. Juni 2025) müssen ab dem 28. Juni 2025 für aluminiumhaltige Waren das Primär- und Sekundärschmelzland ("country of smelt") sowie das Gießland ("country of cast") angegeben werden. Ist eine dieser Angaben nicht verfügbar, ist soll die Codierung "UN" (unknown) in der Anmeldung angegeben werden.
Für derart deklarierte Waren wird ein Strafzoll von 200 Prozent erhoben, da sie automatisch den Sanktionsregelungen für russisches Aluminium unterliegen. Dies gilt unabhängig davon, ob tatsächlich ein Bezug zu Russland besteht. Siehe CSMS #65340246.
Empfehlungen für Unternehmen:
- Prüfen, ob Warennummer überhaupt von den Sonderzöllen gemäß Section 232 erfasst ist. Oft werden zu viele Daten angefordert Zusatzzölle, die (auch) Waren mit EU-Ursprung betreffen und in Kraft sind, sind in der Datenbank Access2Markets abgebildet.
- Lieferketten analysieren und Informationen zu Schmelz- und Gießland frühzeitig einholen. Bei fehlenden Ursprungsangaben wahrscheinliche Ursprungsländer oder ausgeschlossene Ursprungsländer an den US-Importeur kommunizieren und dabei die unsichere Informationsbasis offenlegen.
- Wertaufteilung zwischen Metall- und Nicht-Metallanteilen bei gemischten Produkten dokumentieren.
- Zollanmeldung in den USA über zwei getrennte Positionen abbilden, um korrekte Zollerhebung zu ermöglichen.
- Bei unklarem Ursprung oder fehlender Trennung ist mit erhöhten Zöllen auf den Gesamtwarenwert zu rechnen.
4. Zusatzzölle auf Autos und Autoteile
5. Welche Fragestellungen gibt es?
-
Es werden zusätzliche Angaben zum Land des Schmelzens/Gießens verlangt. Die Handhabung der US-Importeure/Zollagenten ist noch sehr unterschiedlich, obwohl die Details vom US-Zoll inzwischen veröffentlicht worden sind. Sie finden diese unter häufig gestellte Fragen, insbesondere im Abschnitt “Additional Section 232 Questions” und im Informationssystem des US-Zolls (CSMS), insbesondere unter den Nachrichten CSMS # 64680374 und CSMS # 64701128. Die Anforderungen der US-Importeure gehen oft aus Unsicherheit weit darüber hinaus.
- Besonders kritisch ist wieder die Situation bei Aluminium: Wenn das Ursprungsland nicht belegt werden kann, drohen 200 Prozent Zoll. Hintergrund: Es kann dann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um russisches Aluminium handelt, auf dem 200 Prozent Zoll liegen.
- Wichtig sind die von der US-Zollverwaltung im CSMS bereitgestellten bereitgestellten technischen Detailinformationen.
- Falls ein Produkt von mehreren Zusatzzöllen betroffen ist, war offen, ob dieses mehrfach betroffen sein kann. Dies ist nicht der Fall. Falls ein Produkt sowohl Stahl als auch Aluminium enthält und jeweils von der Regelung erfasst wird, werden die jeweiligen Anteile verzollt. Falls noch Anteile übrig sind, fallen dafür die reziproken Zölle an, dies ist neu seit dem 4. Juni 2025. Bei anderen Kombinationen (z.B. Aluminium und Autoteil) ist geklärt, dass dann die Autozölle vorgehen.
- Auch US-Zollbroker machen gelegentlich Fehler. Prüfen Sie deren Vorgehensweise bzw. lassen Sie sich nicht erklärbare Doppelbelastungen erklären und erstatten.
- Prüfen, ob Warennummer überhaupt von den Sonderzöllen gemäß Section 232 erfasst ist. Oft werden zu viele Daten angefordert. Zusatzzölle, die (auch) Waren mit EU-Ursprung betreffen und in Kraft sind, sind in der Datenbank Access2Markets abgebildet.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns unter auwi@stuttgart.ihk.de
6. Exkurs: Ursprung und Zollwert
6.1. Wie wird der nichtpräferenzielle Ursprung festgelegt?
6.2 US-Zollwert
7. Was kann man tun?
- Betroffenheit prüfen: Zölle gehen zunächst immer zu Lasten des Importeurs, sofern nicht die extreme Lieferkondition frei Haus oder DDP vereinbart worden ist. Stellen Sie Verträge nicht ohne entsprechende Kompensation auf DDP um.
- Hinweis: Die Bemessungsgrundlage für Zölle in den USA ist immer der FOB-Wert. Es empfiehlt sich immer, diesen anzugeben: Damit wird verhindert, dass auch noch die Frachtkosten mit verzollt werden. Prüfen Sie, ob weitere Posten im Preis enthalten sind, die nicht zum Zollwert gehören.
- Welche Waren sind konkret betroffen: Maßgeblich sind die veröffentlichten Warennummern und Ursprungsländer. Achtung: nur die ersten sechs Ziffern der Warennummern sind international einheitlich.
- US-Zusatzzölle, die in Kraft sind, sind in der Datenbank Access2Markets eingearbeitet. Zollrechner können unterstützen, wir haben ein Beispiel verlinkt.
- Falsche Angaben zu Warennummern, Ursprungsland und Zollwert führen zu hohen Strafen. Allerdings ist klar, dass die US-Regeln insbesondere für chinesische Erzeugnisse zu derartigen Praktiken führen.
- Zusätzliche Angaben, z.B. zum Metallanteil bei weiterverarbeiteten Erzeugnissen, können vom US-Zoll verlangt werden. Einzelheiten werden vom US-Zoll im CSMS oder in den FAQs für Stahl und Aluminium veröffentlicht.
- Wenn Angaben zum Ursprung unsicher sind, dann sollte dies dem US-Importeur auch so offen kommuniziert werden
- Prüfen Sie die Abrechnungen des US-Zollagenten, sofern die Abgaben bei Ihnen landen.
- Aktuelle Informationen zu wichtigen Details werden von der GTAI veröffentlicht.
- Kurzfristig: Können Sendungen noch vor Inkrafttreten der Maßnahmen verzollt werden? Befinden sich Sendungen noch im einem Zolllager oder ist ein Zolllager sinnvoll, um die Entwicklung abwarten zu können?
Mittelfristig: Gilt es alternative Produkte, die nicht betroffen sind? Kann die Logistik geändert werden, weil die Produkte in andere Länder weitergeliefert werden? Lohnt sich eine Umstellung? - Eine exakte Datenbasis ist eine wichtige Grundlage, um flexibel die bestmöglichen Entscheidungen in der nächsten Zeit treffen zu können.