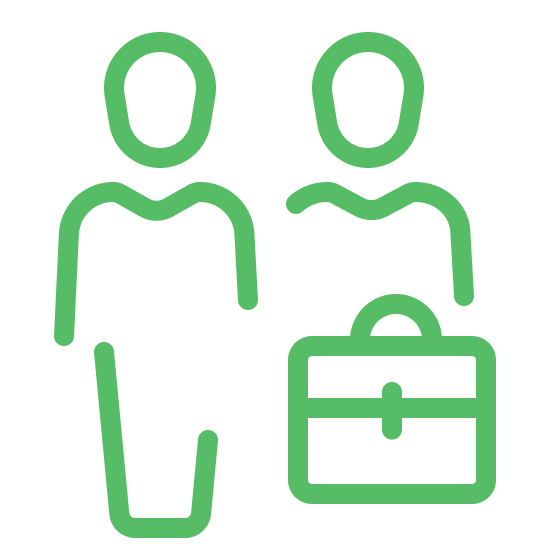Omnibus-Pakete 2025
Die EU-Kommission hat nach der Europawahl eine Kürzung der bürokratischen und administrativen Belastungen um mindestens 25 Prozent und für KMU um mindestens 35 Prozent angekündigt. Um dieses Ziel zu erreichen, reformiert die EU-Kommission in Artikelgesetzen ("Omnibus-Pakete“) eine Reihe von Regelungen. Im folgenden Artikel haben wir die wesentlichen Inhalte zusammengestellt und informieren über die aktuellen Entwicklungen.
- Omnibus I: Vereinfachung von Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit
- Omnibus II: Vereinfachung und Optimierung von Investitionsprogrammen
- Omnibus III: Vereinfachungen in Regularien der Landwirtschaft
- Omnibus IV: Small-Mid-Caps, Produktspezifikationen und Digitalisierung der EU-Konformitätserklärung
- Omnibus V: Vereinfachung von Regularien im Verteidigungsbereich
- Omnibus VI: Vereinfachung von Regularien in der chemischen Industrie
- Omnibus VII: Vereinfachung von Regularien im Bereich Digitalisierung
- Omnibus VIII: Vereinfachung von Regularien im Umweltbereich
Omnibus I: Vereinfachung von Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit
26. Februar 2025
Vollständiger Text des Pakets finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission.
Wesentliche Inhalte der Vorschläge
Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) und EU-Taxonomie
- Verschiebung der CSRD-Meldepflicht (umgesetzt, siehe "Aktueller Stand“)
- Reduzierung des Anwendungsbereichs der CSRD (auf große Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten und entweder einen Umsatz von über 50 Millionen EUR oder eine Bilanzsumme von über 25 Millionen EUR)
- Reduzierung von Taxonomie-Berichtspflichten und Beschränkung auf die größten Unternehmen
- Einführung der Möglichkeit, über Tätigkeiten zu berichten, die teilweise mit der EU-Taxonomie übereinstimmen
- Einführung einer finanziellen Wesentlichkeitsschwelle für die Taxonomie-Berichterstattung und Reduzierung der Berichtsvorlagen
- Vereinfachungen der "Do-No-Significant-Harm“-Kriterien (DNSH)
- Anpassung des Taxonomie-basierten Leistungsindikators für Banken - der Green Asset Ratio (GAR)
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD / EU-Lieferkettenrichtlinie)
- Verschiebung der Anwendung (umgesetzt, siehe "Aktueller Stand“)
- Vereinfachung der Anforderungen an die Sorgfaltspflicht (Konzentration der systematischen Sorgfaltspflicht auf unmittelbare Geschäftspartner, Verringerung der Häufigkeit der regelmäßigen Bewertungen der Geschäftspartner von jährlich auf fünf Jahre, mit Ad-hoc-Bewertungen, wo dies erforderlich ist)
- Begrenzung der Menge an Informationen, die im Rahmen der Abbildung der Wertschöpfungskette verlangt werden können und Verringerung der Trickle-Down-Effekte für KMU
- Harmonisierung der Sorgfaltspflichtanforderungen in der EU
- Abschaffung der zivilrechtlichen Haftung in der EU
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Einführung einer kumulativen jährlichen CBAM-Schwelle von 50 Tonnen pro Importeur
- Vereinfachung der Vorschriften für die Beantragung und Genehmigung des Status des zugelassenen CBAM-Anmelders, für die Berechnung der Emissionen und der Berichterstattungsanforderungen
- Verschärfung der Vorschriften zur Vermeidung von Umgehung und Missbrauch
- Ausweitung des Anwendungsbereichs von CBAM auf andere EHS-Sektoren und nachgelagerte Güter
Aktueller Stand
Teil 1 des Omnibus-Pakets I ist nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am 17. April 2025 in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum 31. Dezember 2025 Zeit, die Änderungen in nationales Recht umzusetzen.
Dieser Teil des Omnibus-Pakets betrifft die CSRD-Richtlinie und die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) und sieht folgende Änderungen vor:
- Das Inkrafttreten der CSRD-Berichtspflichten wird wie folgt verschoben:
- für Unternehmen der 2. Welle (große Kapitalgesellschaften und ihnen gleichgestellte haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften, Mutterunternehmen einer großen Gruppe) – Berichtspflicht ab dem 1. Januar 2027
- für Unternehmen der 3. Welle (kleine und mittlere kapitalmarktorientierte Gesellschaften, bestimmte kleine und nicht komplexe Institute, bestimmte firmeneigene Versicherungsunternehmen) - Berichtspflicht ab dem 1. Januar 2028
- für die Unternehmen der 1. Welle (große Kapitalgesellschaften und ihnen gleichgestellte haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften mit mehr als 500 Mitarbeitern sowie Mutterunternehmen einer großen Gruppe mit mehr als 500 Mitarbeitern) - keine Änderungen (Berichtspflicht ab dem 1. Januar 2024).
- Die Umsetzungsfrist der EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) für die Mitgliedstaaten wird um ein Jahr auf Mitte 2027 verschoben. Die Anwendungsfristen für Unternehmen werden wir folgt verschoben:
- Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und mehr als 900 Millionen Euro weltweitem Nettoumsatz - ab Mitte 2028
- Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und mehr als 450 Millionen Euro weitweitem Nettoumsatz - ab Mitte 2029
Teil 2 des Omnibus-Pakets I über CBAM wurde am 18. Juni 2025 von Rat, Parlament und Kommission inhaltlich beschlossen. Der Entwurf der Änderungsverordnung ist auf der EUR-Lex--Seite verfügbar. Das Amtsblatt liegt noch nicht vor.
Omnibus II: Vereinfachung und Optimierung von Investitionsprogrammen
26. Februar 2025
Vollständiger Text des Pakets finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission.
Wesentliche Inhalte der Vorschläge
- Erhöhung der Investitionskapazität der EU (InvestEU) - Mobilisierung von rund 50 Milliarden EUR an zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionen. Die erhöhte InvestEU-Kapazität soll hauptsächlich zur Finanzierung innovativerer Tätigkeiten im Rahmen vorrangiger politischer Maßnahmen wie des Kompasses für Wettbewerbsfähigkeit und des Deals für eine saubere Industrie verwendet werden.
- Vereinfachung der Beteiligung am Programm für die Mitgliedstaaten
- Vereinfachung der Verwaltungsanforderungen für Durchführungspartner, Finanzintermediäre und Endempfänger.
Aktueller Stand
Die Legislativvorschläge wurden dem EU-Parlament und dem Rat zur Prüfung und Annahme vorgelegt.
Omnibus III: Vereinfachungen in Regularien der Landwirtschaft
14. Mai 2025
Vollständiger Text des Pakets finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission.
Wesentliche Inhalte der Vorschläge
- Vereinfachung der Zahlungsregelung für kleine Höfe
- Vereinfachung der Umweltanforderungen und -kontrollen
- Verstärktes Krisenmanagement, einfachere Verfahren für die nationalen Verwaltungen
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung
Aktueller Stand
Die Legislativvorschläge wurden dem EU-Parlament und dem Rat zur Prüfung und Annahme vorgelegt.
Omnibus IV: Small-Mid-Caps, Produktspezifikationen und Digitalisierung der EU-Konformitätserklärung
21. Mai 2025
Vollständiger Text des Pakets finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission.
Wesentliche Inhalte der Vorschläge
- Einführung einer neuen Unternehmenskategorie "Small-Mid-Caps“ (Unternehmen mit weniger als 750 Mitarbeitern und entweder einen Umsatz von weniger als 150 Millionen EUR oder eine Bilanzsumme von weniger als 129 Millionen EUR), die fast 38.000 Unternehmen in der EU abdecken wird.
- Ausweitung mehrerer bestehenden Unterstützungsmaßnahmen für KMU auf diese neue Unternehmenskategorie und weitere Vereinfachungsmaßnahmen zugunsten von KMU und Small-Mid-Caps in den folgenden Rechtsakten:
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) - Verordnung (EU) 2016/679
- Verordnung über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren – Verordnung (EU) 2016/1036
- Verordnung über den Schutz gegen subventionierte Einfuhren – Verordnung (EU) 2016/1037
- Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente – Richtlinie (EU) 2014/65
- Prospektverordnung – Verordnung (EU) 2017/1129
- Verordnung über Batterien und Altbatterien – Verordnung (EU) 2023/1542
- Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen – Richtlinie (EU) 2022/2557
- Verordnung über fluorierte Treibhausgase – Verordnung (EU) 2024/573
- Vereinheitlichung von Produktspezifikationen, wo es keine gemeinsamen Standards gibt
- Digitalisierung der EU-Konformitätserklärung sowie Schaffung der Möglichkeit, Gebrauchsanweisungen in digitalem Format anstelle von Papier zur Verfügung zu stellen und ein "digitales Kontakt“ in die Herstellerinformationen aufzunehmen.
Aktueller Stand
Die Legislativvorschläge wurden dem EU-Parlament und dem Rat zur Prüfung und Annahme vorgelegt.
Omnibus V: Vereinfachung von Regularien im Verteidigungsbereich
17. Juni 2025
Das Paket wird dazu beitragen, die im "White Paper for European Defence – Readiness 2030“ festgelegten Investitionsziele zu erreichen. Vollständiger Text des Pakets finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission.
Wesentliche Inhalte der Vorschläge
- Europäischer Verteidigungsfonds (European Defence Fund (EDF)): Vereinfachte Anforderungen für Antragsteller, kürzere Fristen für die Gewährung von Finanzhilfen und eine besser vorhersehbare Umsetzung
- Vereinfachungen im Beschaffungsbereich für öffentliche Auftraggeber und Industrie
- Klärung der Anwendung bestehender EU-weit geltender Umwelt- und Chemikaliengesetzgebung:
- Klärung der Frage, ob die bestehenden Ausnahmeregelungen für Projekte zur Verteidigungsbereitschaft im Zusammenhang mit überwiegenden öffentlichen Interessen in Anspruch genommen werden können
- Ein klareres Mandat für die Mitgliedstaaten, Ausnahmeregelungen anzuwenden, wenn dies zur Unterstützung von Investitionen mit kritischen Stoffen erforderlich ist
- Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln durch Anpassungen der Förderkriterien im Rahmen von InvestEU und Leitlinien für nachhaltige Investitionen im Bereich Verteidigung.
Aktueller Stand
Die Legislativvorschläge wurden dem EU-Parlament und dem Rat zur Prüfung und Annahme vorgelegt.
Omnibus VI: Vereinfachung von Regularien in der chemischen Industrie
Voraussichtlich das zweite Halbjahr 2025
Ankündigung und die ersten Informationen finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission.
Voraussichtliche Inhalte der Vorschläge
- Vereinfachungen der Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von gefährlichen Stoffen und Gemischen (CLP) und Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel
Aktueller Stand
Das Paket wurde angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht.
Omnibus VII: Vereinfachung von Regularien im Bereich Digitalisierung
Voraussichtlich das zweite Halbjahr 2025
Ankündigung und die ersten Informationen finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission in der Binnenmarktstrategie vom 21. Mai 2025.
Voraussichtliche Inhalte der Vorschläge
- Vereinfachungen von Data Act, Data Governance Act, AI Act und Open Data Directive
Aktueller Stand
Das Paket wurde angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht.
Omnibus VIII: Vereinfachung von Regularien im Umweltbereich
Voraussichtlich das zweite Halbjahr 2025
Ankündigung und die ersten Informationen finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission in der Binnenmarktstrategie vom 21. Mai 2025.
Voraussichtliche Inhalte der Vorschläge
- Genannt bisher die Vereinfachungen der Erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR)
Aktueller Stand
Das Paket wurde angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht.
Stand: 23. Juni 2025
Wir aktualisieren unseren Artikel kontinuierlich für Sie. Wir können Ihnen jedoch nicht garantieren, dass die Inhalte immer auf dem neuesten Stand sind.
Wir aktualisieren unseren Artikel kontinuierlich für Sie. Wir können Ihnen jedoch nicht garantieren, dass die Inhalte immer auf dem neuesten Stand sind.
Quelle: EU-Kommission, DIHK