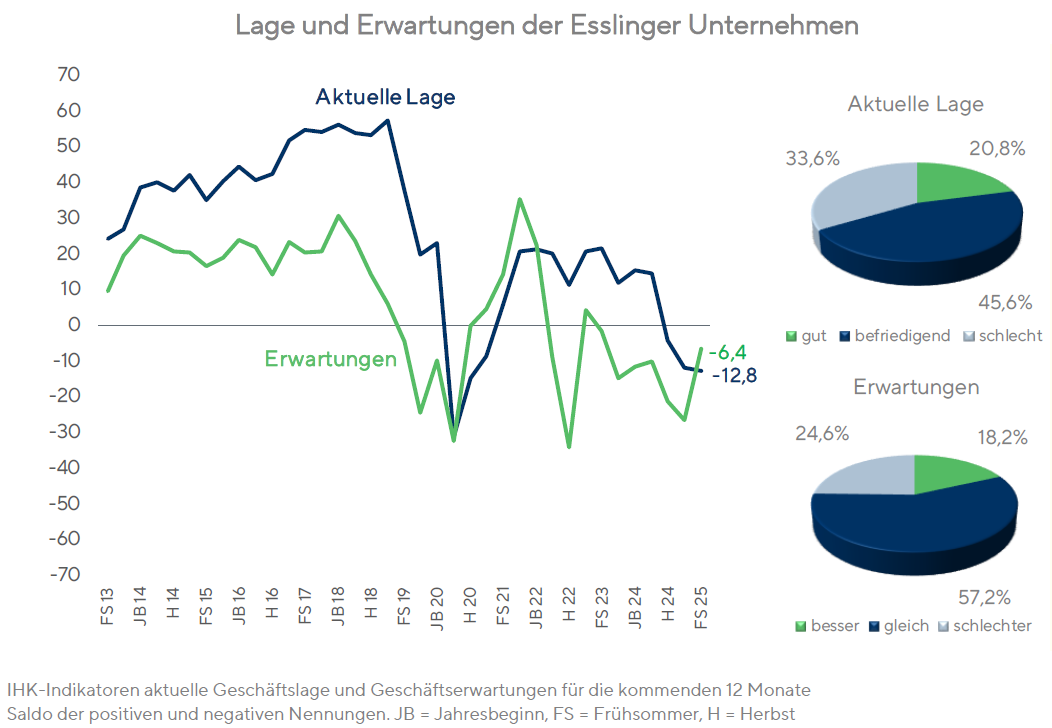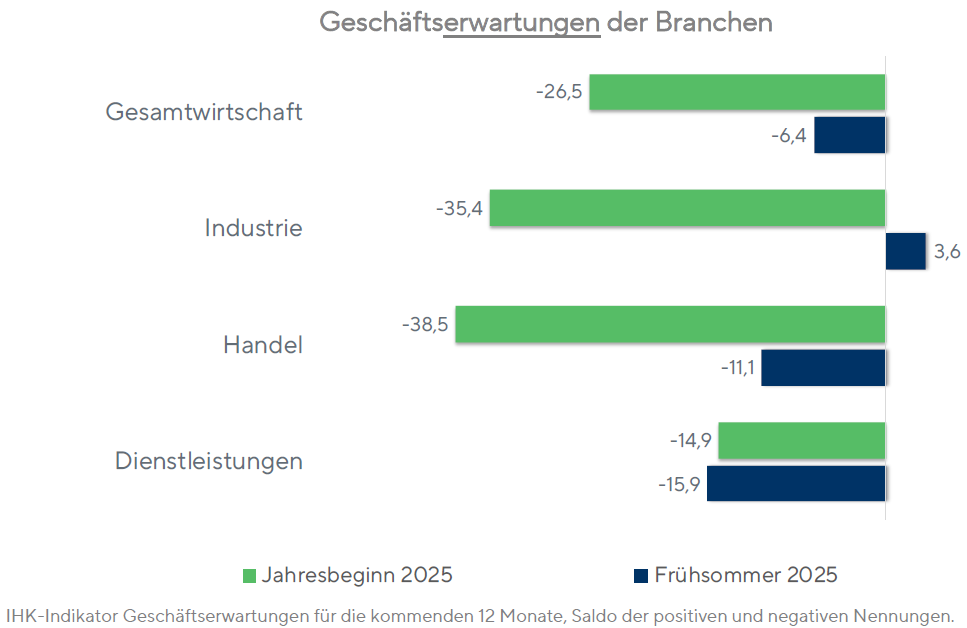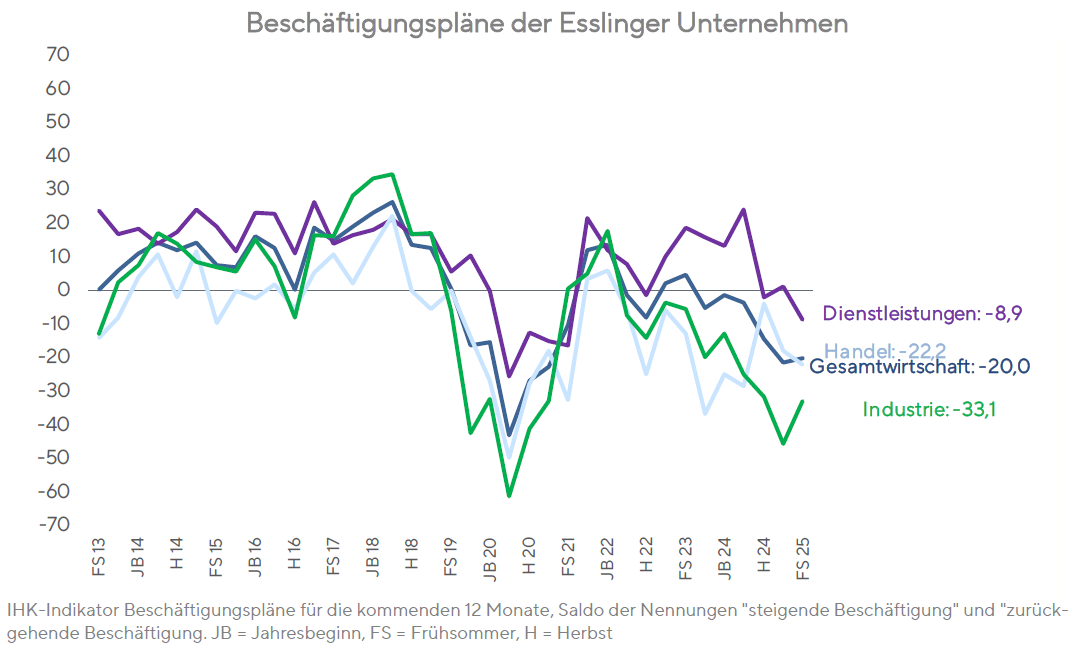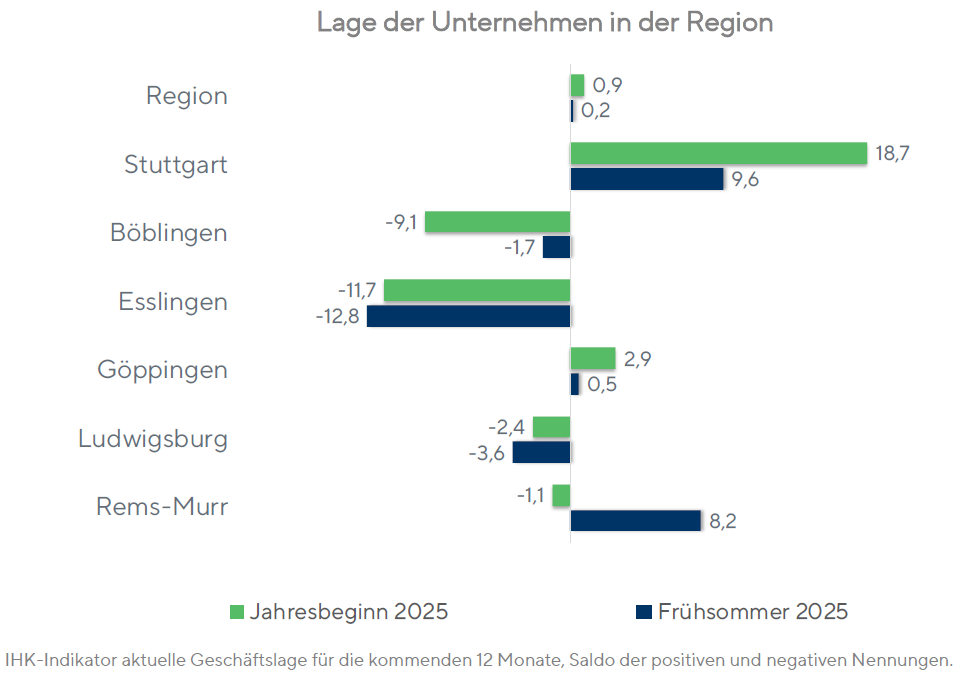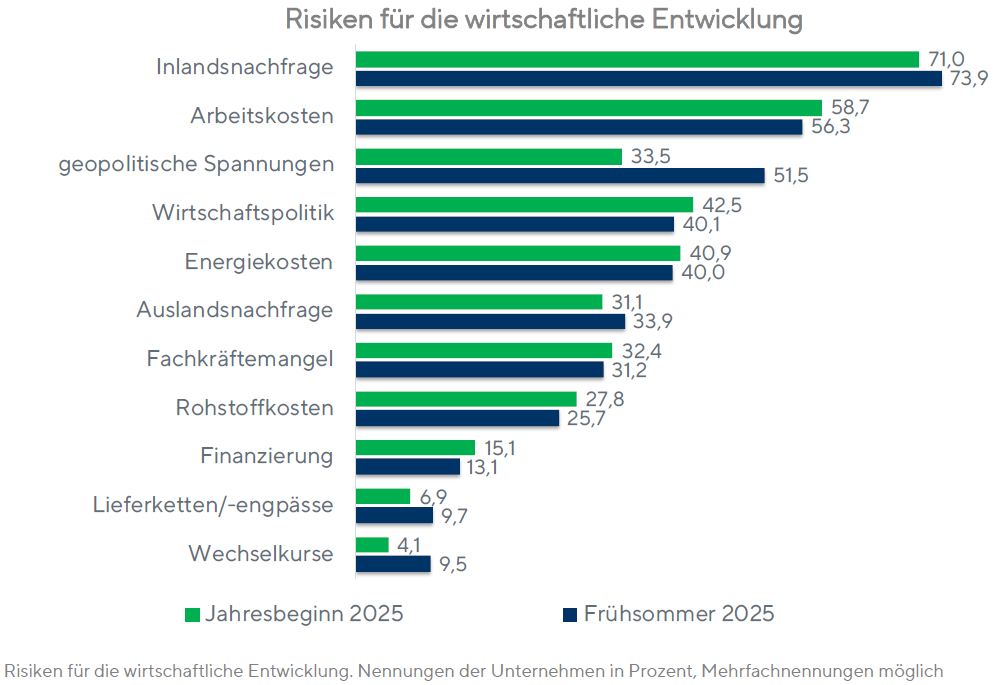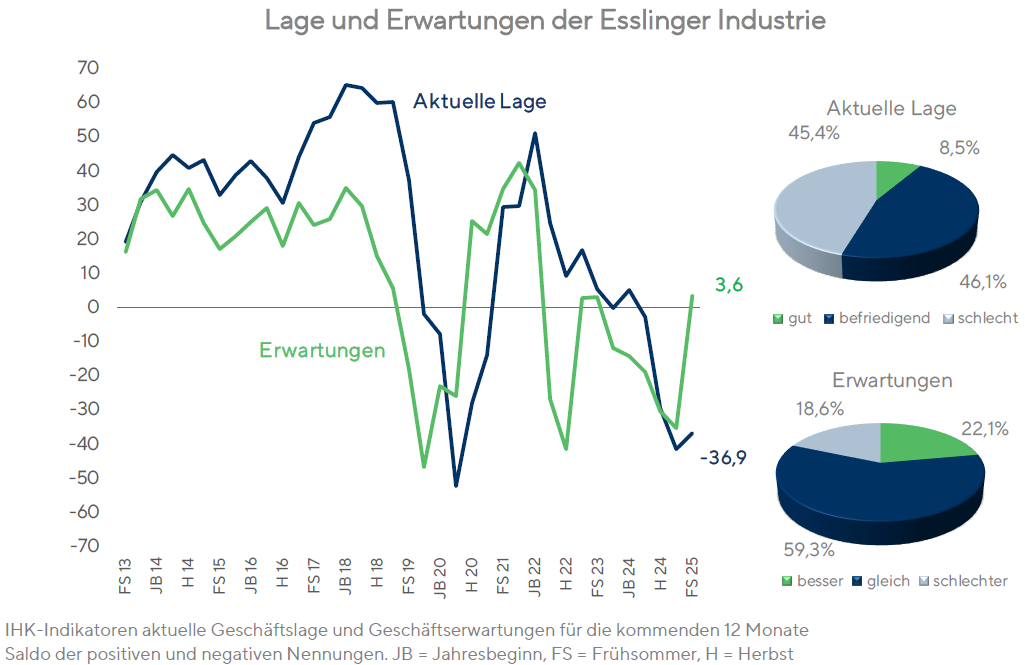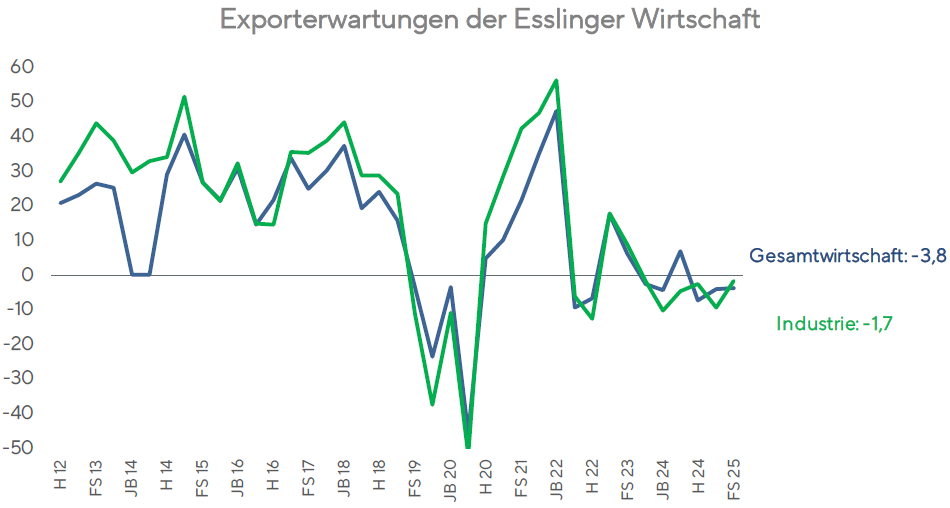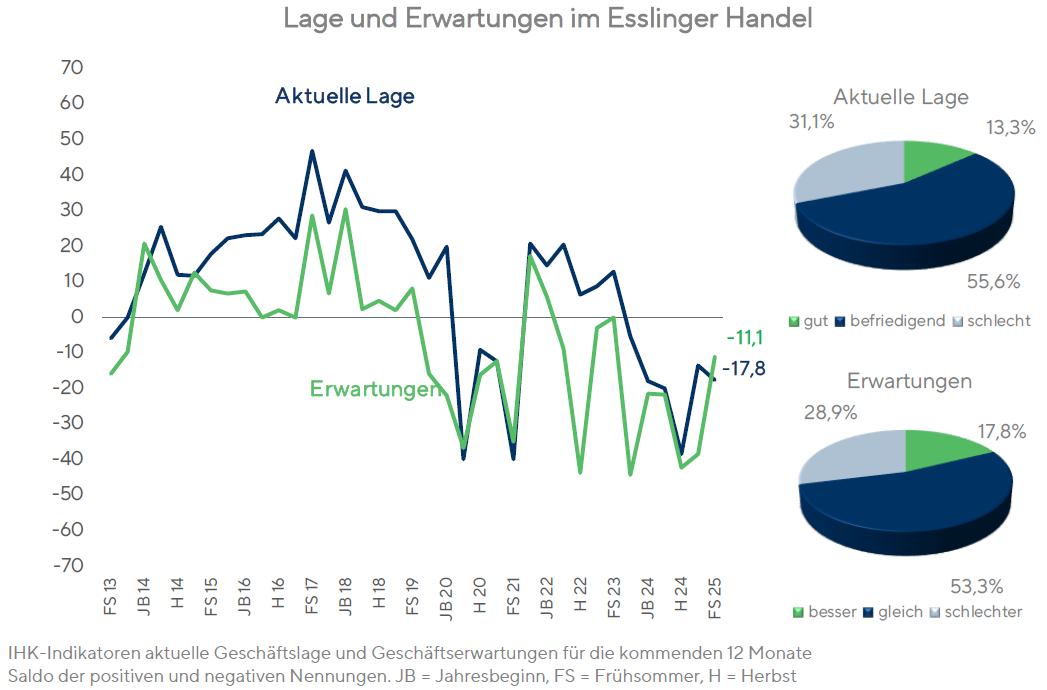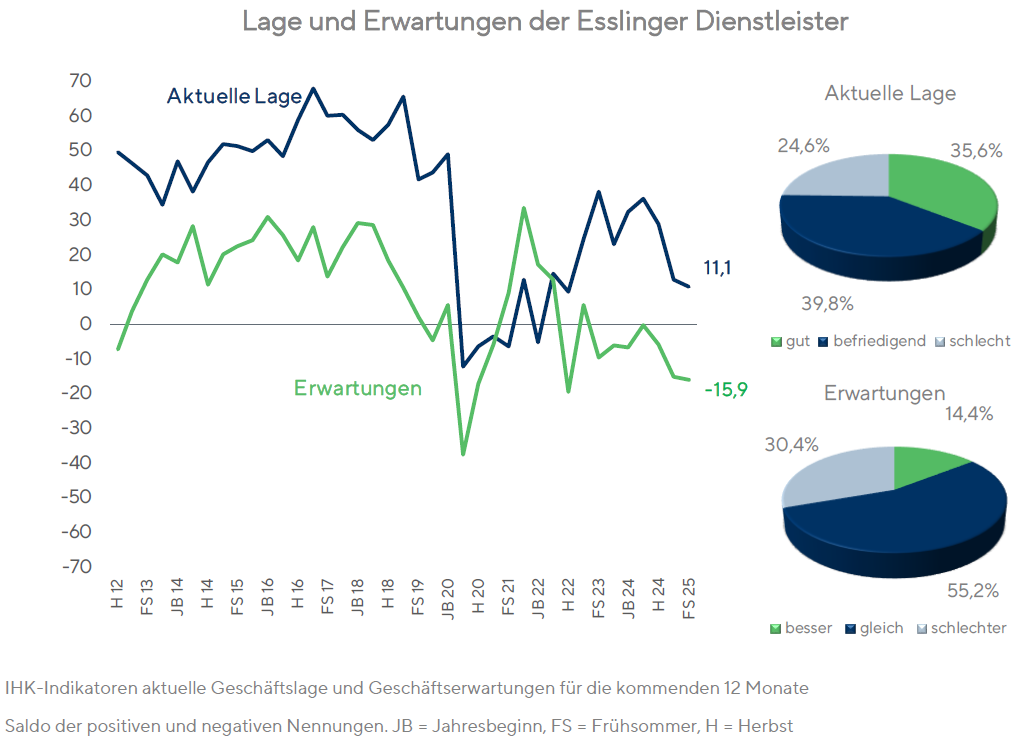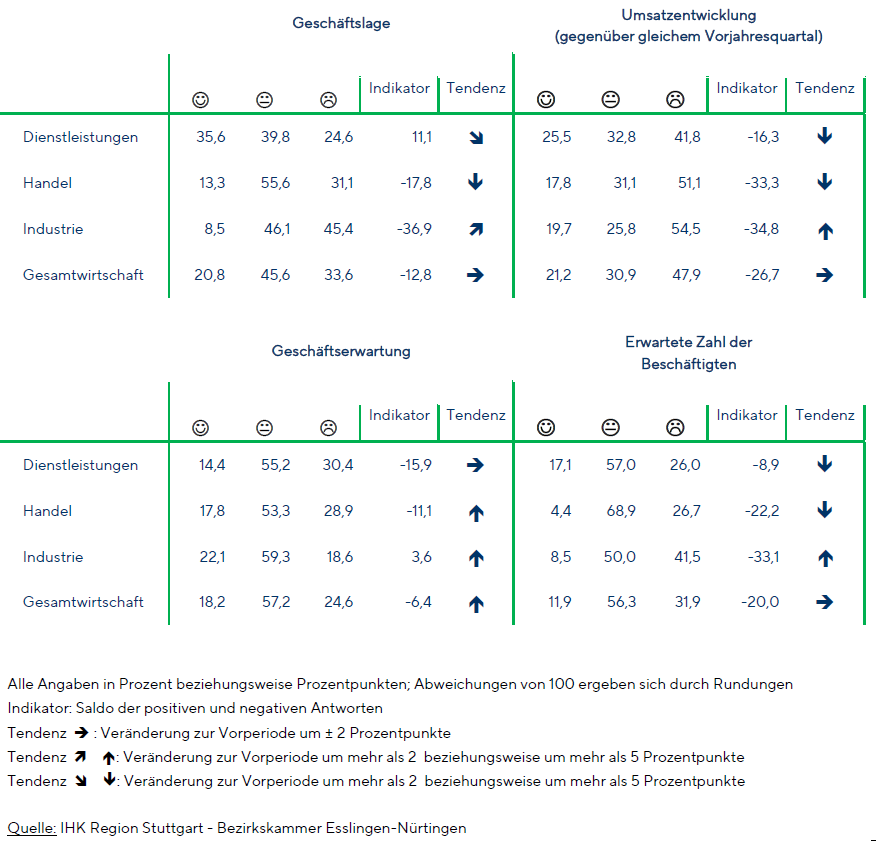Keine Angst vor Vulcan und Ariane
Eine Branche im Steigflug, Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand und vielleicht bald ein Deutscher auf dem Mond: Auf dem Luft- und Raumfahrt-Kongress im Stuttgarter IHK-Haus war etwas zu spüren, was dieser Tage Seltenheitswert hat: Optimismus, ja fast sogar Begeisterung.
IHK-Präsident Paal mit Dr. Silke Launert, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesforschungsministerium
Neben spannenden Vorträgen von Unternehmen, die es geschafft haben, sich als Zulieferer für den technologisch anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtbereich zu etablieren, gab es für die rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie wurde gerne genutzt.
Mittelstand sucht neue Märkte
Viele Gäste kamen aus kleinen und mittleren Unternehmen, die sich angesichts schwächelnder Nachfrage aus der Automobilindustrie nach alternativen Märkten und Branchen umsehen. IHK-Präsident Claus Paal ermutigte sie in seiner Begrüßungsrede: „Viele von Ihnen verfügen bereits über Kompetenzen, die in diesem Sektor dringend gebraucht werden. Ergreifen Sie die Chance, in die Lieferkette hineinzukommen.“
Die Branche entwickele sich derzeit „in einem Ausmaß, das wir noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätten“, ergänzte Michael Kleiner, Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, das den Kongress unterstützte. Er verwies auf die Initiative „The Aerospace Länd“ und auf Luft- und Raumfahrt-Umsätze im Land von jährlich fünf Milliarden Euro.
Raumfahrt: Politik setzt Impulse
Begeistert über diese Dynamik zeigte sich Moderator Moritz Vieth, dessen YouTube-Kanal „Senkrechtstarter" derzeit 90.000 Raumfahrfans folgen – und ebenso Dr. Silke Launert, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesforschungsministerium, die als Ehrengast aus Berlin angereist war. „Die Branche ist ein Innovationstreiber und wirkt sich auf viele andere Bereiche aus“, sagte die CSU-Politikerin. Sie verwies auf das gerade erst vom EU-Ministerrat beschlossene Budget für die europäische Raumfahrtbehörde ESA in Höhe von 22 Milliarden Euro, zu dem Deutschland fünf Milliarden beisteuert. Geht es nach der ESA, wird der erste Mensch, der den Trabanten nach fast 60 Jahren wiederbetreten soll, ein Deutscher sein.
Moritz Vieth, Inhaber des YouTube-Kanals "Senkrechtstarter"
Die Praxisberichte aus den Unternehmen wurden besonders aufmerksam verfolgt – zum Beispiel der Überblick über den Markt und die Entwicklung der Raumfahrtbranche, den Sabine von der Recke vom Vorstand der OHB System AG in Bremen gab. Zukunftsthemen, an denen auch kleine und mittlere Unternehmen Anteil haben könnten, seien zum Beispiel Rohstoffförderung und Produktion im All, sagte die Managerin. .„Warum nicht einen Betonmischer entwickeln, der auf dem Mond eingesetzt werden kann? OHB war vor Jahrzehnten selbst als kleines Engineering-Unternehmen in die Raumfahrt eingestiegen und ist heute ein weltweit tätiger Konzern.
Luftfahrt nimmt Kurs auf Nachhaltigkeit
Welche Herausforderungen auf die rasant wachsende Luftfahrtindustrie warten, wenn sie zugleich den strengen Nachhaltigkeitszielen einer Klimaneutralität bis 2050 gerecht werden will, erklärte Philipp Walter, Geschäftsführer der Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH. Verbesserungen in Aerodynamik, Leichtbau und Digitalisierung der Flugzeuge sowie bei nachhaltigen Treibstoffen seien eine Querschnittaufgabe, bei der Kompetenzen aus Maschinenbau, Medizintechnik und IT gefragt seien. „Europa kann dabei weltweit führend werden, muss aber den Schulterschluss vom Startup bis in die Politik schaffen.“
Wachstum im Defence-Sektor
Viele Fragen der Teilnehmer musste Jochen Pfister beantworten, der die Hensoldt Sensors GmbH aus Ulm vertrat. Die Wachstumserwartungen seien im Defence-Bereich enorm, sagte Pfister, sein Unternehmen rechne mit einer Verdreifachung des Auftragseingangs bis 2030. Auch kleinere Unternehmen könnten diese Chancen wahrnehmen, müssten sich jedoch an deutlich strengere Standards gewöhnen, etwa bei Sicherheit, Transparenz, Compliance und Exportkontrolle.
Praxisbeispiel aus der Region
Ein KMU, dem der Einstieg gelungen ist, ist die MRM2 GmbH in Bad Ditzenbach und Merklingen – Geschäftsführer Martin Rieg, der auch Mitglied er IHK-Vollversammlung ist, beschrieb sein Unternehmen als „softwarelastigen Sondermaschinenbauer“. Für die Ariane-Trägerraketen hat MRM2 eine vollautomatisierte Anlage zur Bearbeitung der Nutzlastverkleidung gebaut. Wer die Massenfertigung in der Autoindustrie gewöhnt sei, müsse sich freilich umstellen: Das Luft- und Raumfahrtgeschäft sei technisch hochkomplexe Manufakturarbeit. „Ich will Ihnen aber keine Angst machen, wir haben es auch geschafft.“
Wie der Mittelstand von der Dynamik der Luft- und Raumfahrtbranche profitieren kann, wurde noch in vielen anderen Vorträgen aus Unternehmen, Politik und Forschung deutlich. Es wird sicher nicht die letzte Veranstaltung dieser Art bei der IHK gewesen sein.