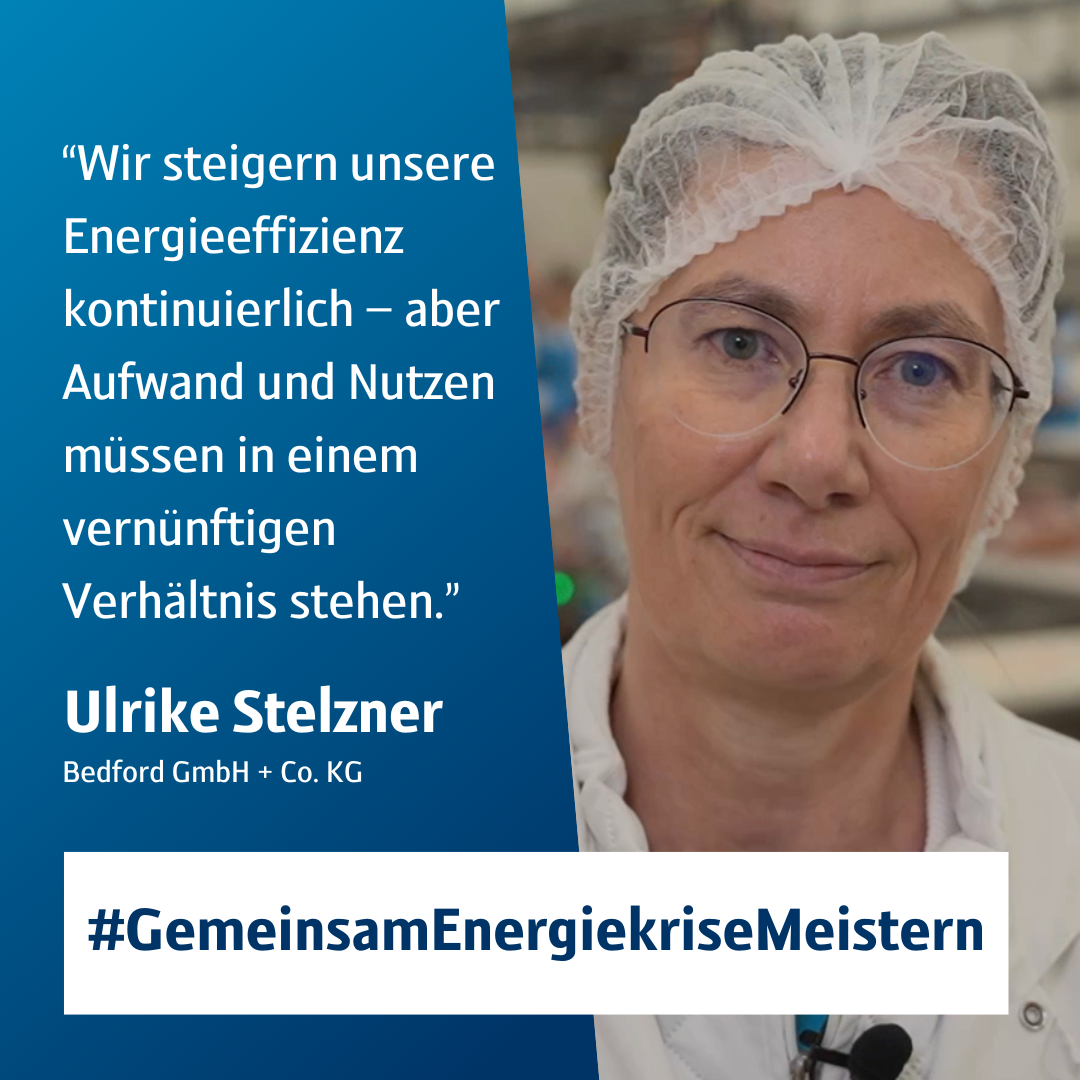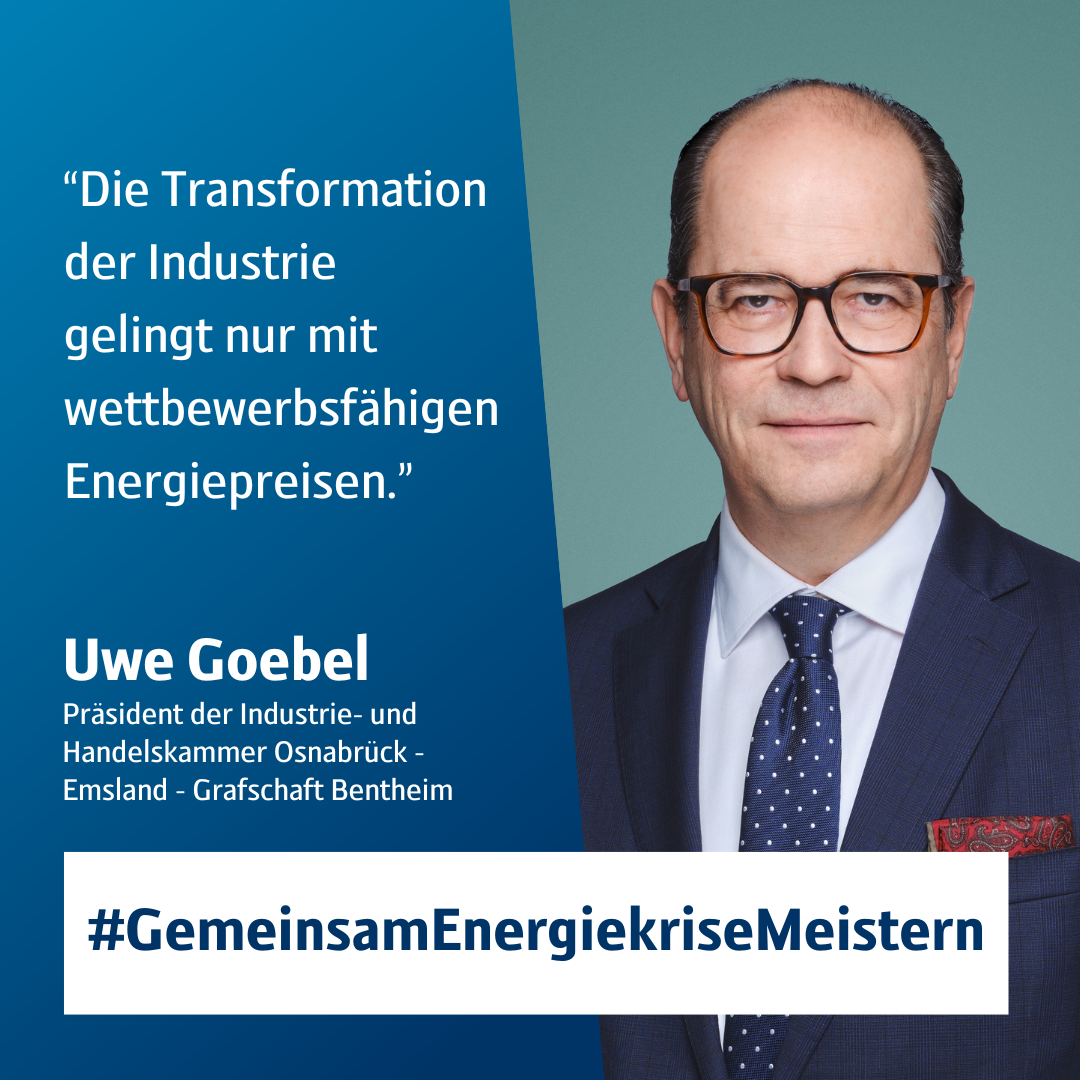Eine effektive Absicherungspflicht als Alternative zu Kapazitätssubventionen
In Deutschland und Europa gibt es eine anhaltende Debatte darüber, wie Versorgungssicherheit beim Übergang zu einem klimaneutralen Stromsystem gewährleistet werden kann. Eine häufige, aber ineffiziente Antwort ist die Subvention konventioneller Technologien, welche jedoch notwendigen Marktanpassungen entgegenwirkt. Eine binnenmarktfreundliche, marktwirtschaftliche Absicherung der Stromversorgung bietet hingegen ökonomische Vorteile und stärkt dadurch Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Kapazitätssubventionen haben einen hohen Preis
Die Einführung von Kapazitätssubventionen in Form von Kraftwerksstrategie (KWS) oder Kapazitätsmärkten erfordert den Nachweis eines Versorgungsproblems. Anstatt Marktunvollkommenheiten ursächlich zu beheben, erscheint es in der Regel politökonomisch attraktiver, Subventionen in Aussicht zu stellen. Doch bereits die Debatte über die Einführung von Kapazitätssubventionen weckt Erwartungen, die zu Investitionszurückhaltungen führen. Insofern kann von politischer Seite und von Seiten potenzieller Subventionsempfänger eine selbsterfüllende Prophezeiung in Gang gesetzt werden.
Die Lösungsräume von wettbewerblichen staatlichen Ausschreibungen und marktwirtschaftlichen preisbasierten Anreizsystemen unterscheiden sich u.a. aufgrund von Mengen- und Technologievorgaben. Die Einführung von Kapazitätssubventionen steigert strukturell die Systemkosten, wodurch Verbraucher, der Binnenmarkt und schließlich die europäische Wettbewerbsfähigkeit einen hohen Preis zahlen. Dafür sind u.a. diese Aspekte verantwortlich:
- Marktabschottung: Die notwendige Anpassung der Marktstrukturen wird behindert. Entscheider zielen bei der Ausgestaltung von Kapazitätssubventionen häufig auf spezifische Technologien an ausgewählten Orten. Dadurch wird der Wettbewerb durch innovative Technologien, Flexibilitätsoptionen und dem Binnenmarkt zugunsten etablierter Unternehmen und Technologien beeinträchtigt. Häufig führen sie sogar zu einer Steigerung der Marktmacht. In der politischen Diskussion über die Notwendigkeit von Kapazitätsmärkten wird der Import aus benachbarten Mitgliedsstaaten zudem regelmäßig fälschlicherweise als problematisch angeführt. Im Ergebnis wird der Wettbewerb auf die Ebene der politischen Einflussnahme (Rent Seeking) verlagert, anstatt durch Marktmechanismen, eine wettbewerbsfähige Stromversorgung anzureizen.
- Nachfragefestlegung: Der Nachweis über Versorgungsprobleme und die auszuschreibende Leistung wird durch staatliche Annahmen und Ziele beeinflusst. In der KWS-Konsultation wurde die Erwartung aus dem EEG (2023) genannt, dass die Bruttostromnachfrage im Jahr 2030 bis zu 750 TWh (ca. 670 TWh netto) betragen soll. Im Jahr 2024 lag der Bruttostromverbrauch bei 512 TWh (Statista, 2025). Das entspräche einem Anstieg von knapp 50 % in sechs Jahren. McKinsey (2025) kalkuliert im aktuellen „Trendszenario“ eine Nettostromnachfrage im Jahr 2030 von 530 TWh und im Szenario „Transformationspfad“ von 615 TWh. Zentrale Planungen unterliegen Informationsasymmetrien. Sie können fälschlicherweise die Notwendigkeit von Eingriffen aufzeigen, sowie teure und marktverzerrende konventionelle Überkapazitäten herbeiführen.
- Technologieverzerrung: Durch die politische Festlegung der subventionierten Technologien und Energieträger wird der Wettbewerb direkt und indirekt verzerrt. In der KWS sollte direkt zunächst vor allem Wasserstoff gefördert werden; inzwischen zunehmend Erdgas. In Kapazitätsmärkten verzerrt die administrative Festlegung von Deratingfaktoren indirekt den Wettbewerb. Die resultierenden konventionellen Überkapazitäten verdrängen Innovationen und Flexibilitätsoptionen, die zu einem kostengünstigen Versorgungssystem beitragen und die Integration erneuerbarer Energien unterstützen könnten. Aufgrund dieser Wettbewerbsverzerrung sinkt der Marktwert erneuerbarer Energien, wodurch Förderkosten steigen. Das Versorgungssystem verliert an Effizienz und Resilienz gegenüber einer marktwirtschaftlichen Organisation, in der Risiken adäquat bewirtschaftet werden.
Die Wettbewerbsverzerrung durch Kapazitätssubventionen führt zu hohen Kosten, fossilen Lock-in-Effekten und wirkt dem Binnenmarkt entgegen. Die Umlage für die Finanzierung behindert zudem die Elektrifizierung, wodurch Dekarbonisierungskosten steigen. Im Ergebnis sinken die Wettbewerbsfähigkeit und der Wohlstand Europas.
Marktwirtschaftliche Absicherung der Versorgungssicherheit
Eine sichere und wettbewerbsfähige Stromversorgung lässt sich besser durch marktwirtschaftlichen Wettbewerb anreizen. Internationale Erfahrungen in vielen Sektoren zeigen, dass privatwirtschaftliche Kapitalallokation zu produktiveren Investitionen führt als eine staatlich gesteuerte Kapitalallokation.
Eine effektive Absicherungspflicht integriert die Vorgaben der Strommarktrichtlinie zur Stärkung des Verbrauchschutzes mit Anreizen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Indem Bilanzkreisverantwortliche ihre antizipierte Nachfrage absichern, werden Investitionen in steuerbare Leistung angereizt. Die Verpflichtung lässt sich über Börsengeschäfte, bilateralen Handel, Eigenerzeugung und Nachfrageflexibilität erfüllen, wodurch ein hohes Maß an Wettbewerb gewährleistet wird.
Die wesentlichen Vorteile basieren auf einer marktbasierten Nachfrageprognose und dem technologieoffenen Wettbewerb ohne verzerrende regulatorische Eingriffe.
- Nachfrageprognose: Marktakteure können die zukünftige Nachfrage besser antizipieren als staatliche Behörden. Die Aussicht auf staatliche Subventionen reizt hohe Nachfrageprognosen an. Wenn die Verwendung des eigenen privatwirtschaftlichen Kapitals von den Prognosen abhängt, fallen sie in der Regel realistischer aus.
- Technologischer Wettbewerb: Der technologische Wettbewerb wird durch effiziente Portfoliooptimierung angereizt; ohne Markteintrittsbarrieren für innovative Technologien und Flexibilitätsoptionen. Indem Unternehmen die zukünftige Wirtschaftlichkeit und absehbare Risiken in ihre Investitionsentscheidungen einkalkulieren, werden die Effizienz und die Resilienz des Stromsystems gestärkt.
Auf diese Weise ermöglicht die Absicherungspflicht eine marktwirtschaftliche Organisation der Versorgungssicherheit. Die Gesamtsystemkosten sinken, was die europäische Wettbewerbsfähigkeit stärkt und schließlich den Wohlstand in Europa steigert.
20.03.2025, Quelle: Connect Energy Economics GmbH