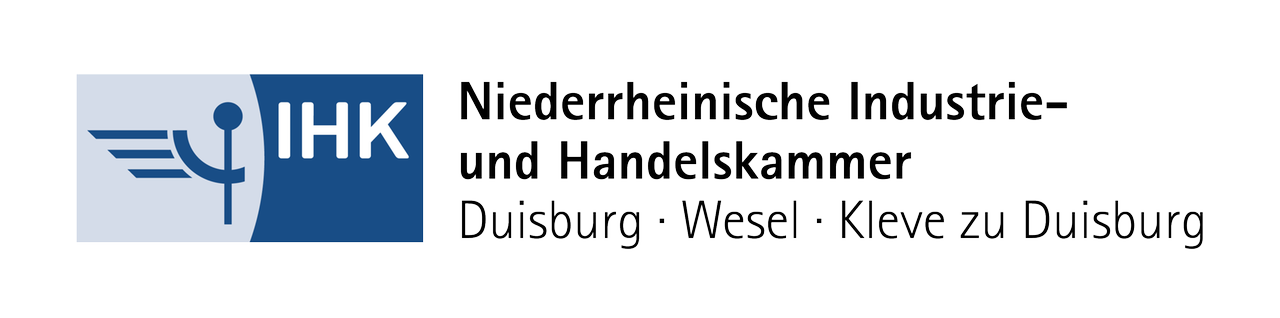Kündigung, Urlaub und Freistellung
- Darf einem Auszubildenden mangels Aufträgen, behördlich angeordneter Betriebsschließung, Kurzarbeit oder drohender Insolvenz gekündigt werden?
- Kann der Auszubildende in den Urlaub geschickt werden?
- Darf der Auszubildende freigestellt werden?
- Sind Auszubildende berechtigt, aufgrund der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Ansteckungsgefahr der betrieblichen Ausbildung fernzubleiben?
Darf einem Auszubildenden mangels Aufträgen, behördlich angeordneter Betriebsschließung, Kurzarbeit oder drohender Insolvenz gekündigt werden?
Ein Mangel an Aufträgen, eine behördlich angeordnete Betriebsschließung, Kurzarbeit oder eine drohende Insolvenz sind grundsätzlich keine Gründe für eine Kündigung.
Sollte der Ausbildungsbetrieb jedoch für längere Zeit vollständig zum Erliegen kommen und ist auch auf absehbare Zeit keine Perspektive gegeben, dass eine Besserung der Umstände eintritt und die Ausbildung wieder aufgenommen werden könnte, ist ein wichtiger Grund zur Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses gegeben. Unter diesen Umständen kann die berufliche Handlungsfähigkeit nicht mehr vermittelt werden.
Durch die dadurch weggefallene Ausbildungseignung des Betriebes, ist eine Kündigung des Auszubildenden möglich, ohne dass ein Schadensersatzanspruch entsteht. Der Ausbildende ist aber dazu verpflichtet, sich rechtzeitig mit der zuständigen Agentur für Arbeit um einen anderen Ausbildungsbetrieb für den Auszubildenden zu bemühen.
Sofern die Schließung nur vorübergehend ist, kommen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte oder auch eine Form der Verbundausbildung zur Überbrückung bis zur Wiedereröffnung ohne Kündigung in Betracht.
Kann der Auszubildende in den Urlaub geschickt werden?
Auszubildende können nicht pauschal in “Zwangsurlaub” geschickt werden. Urlaub muss der Auszubildende beantragen und er kann in der Regel nicht gegen dessen Willen einfach angeordnet werden. Ähnliches gilt für den Abbau von Überstunden. Der Auszubildende selbst oder auch der Betriebsrat können eine Vereinbarung mit der Unternehmensleitung treffen. Hier zählt der Einzelfall.
Betriebsurlaub kann vom Ausbildenden im Rahmen seines Direktionsrechtes nach den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BAG, Urt. v. 28.07.81, Az. 1 ABR 79/79) angeordnet werden. Es muss sich dann um eine generelle Regelung für den gesamten Ausbildungsbetrieb oder zumindest für organisatorisch klar abgegrenzte Betriebsteile handeln, auf die sich die betriebliche Sondersituation auswirkt.
Darf der Auszubildende freigestellt werden?
Eine Freistellung von der Ausbildung verstößt immer – ob bezahlt oder unbezahlt – gegen die Verpflichtung Ausbildender zur Vermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit (§ 14 Absatz 1 Nr. 1 BBiG). Sie ist deshalb nur in den gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fällen möglich. Diese sind auf die Berufsschule bzw. die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte und die Teilnahme an Prüfungen beschränkt.
Eine schlechte Auftragslage oder gar ein behördliches Verbot, die Ausbildungsstätte weiter zu betreiben, gehören nicht zu diesen Fällen. Grund ist, dass Auszubildende nach dem Ausbildungsvertrag nicht ihre Arbeitskraft schulden, sondern ihre Bereitschaft, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erlernentellt die Ausbildungsstätte Auszubildende dennoch von der Ausbildung frei und entstehen diesen dadurch finanzielle Nachteile oder Lücken in der Ausbildung, welche zur Nichtzulassung zur Abschlussprüfung oder zum Nichtbestehen der Abschlussprüfung führen, sind Ausbildende im Einzelfall schadenersatzpflichtig.
Versuchen Sie, Ausbildungsinhalte aus anderen Abteilungen vorzuziehen. Wenn das nicht geht, können Sie Ihrem Auszubildenden ein Projekt für die Erarbeitung zu Hause übergeben, das den Betrieb nach Wiedereröffnung voranbringt. Auch zusätzliche Lernzeit für die Berufsschule ist eine Möglichkeit, die Zeit jetzt sinnvoll zu nutzen.
Sind Auszubildende berechtigt, aufgrund der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Ansteckungsgefahr der betrieblichen Ausbildung fernzubleiben?
Grundsätzlich dürfen Auszubildende die betriebliche Ausbildung nicht verweigern, weil die Ansteckungsgefahr bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin erhöht sein könnte.
Insbesondere ist jedes eigenmächtige Fernbleiben von Auszubildenden von der betrieblichen oder schulischen Ausbildung ein Verstoß gegen seine vertragliche und gesetzliche Verpflichtung, sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben und kann sowohl arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen als auch die Zulassung zur Abschlussprüfung wegen Fehlzeiten gefährden. Ein Fernbleiben von der Ausbildung ist deshalb nur im Einvernehmen mit dem Ausbildenden möglich oder sofern ein behördliches Verbot bzw. ein gesetzlicher / vertraglicher Anspruch darauf besteht.