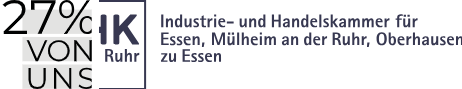Auf einen Blick
- Eignung der Ausbildungsstätte
- Eignung des Ausbilders/der Ausbilderin (vgl. § 28 BBiG)
- Berufsausbildungsvertrag (vgl. § 10 und 11 BBiG)
- Ärztliche Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
- Probezeit (vgl. § 20 BBiG)
- Vergütung (vgl. § 17 BBiG)
- Urlaub
- Pflichten des Ausbildenden (vgl. § 14 BBiG)
- Pflichten des Auszubildenden (vgl. § 13 BBiG)
- Ausbildungsnachweise (vgl. Verordnung über die Berufsausbildung)
- Freistellung Berufsschule (vgl. § 15 BBiG)
- Anrechnung der Berufsschulzeit (vgl. §15 BBiG)
- Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungsdauer (vgl. § 8 BBiG)
- Vorzeitige Zulassung zur Prüfung (vgl. § 45 Abs. 1 BBiG)
- Prüfungen und Beendigung der Berufsausbildung
- Kündigung (vgl. § 22 BBiG)
- Schlichtungsausschuss
Eignung der Ausbildungsstätte
Die Ausbildungsstätte muss nach Art, Einrichtung und personeller Besetzung für die Berufsausbildung geeignet sein. Das ist der Fall, wenn
- der Betrieb über alle Einrichtungen verfügt, die für die Berufsausbildung benötigt werden. Geeignet ausgestattete Räumlichkeiten zum Beispiel Büroräume oder Werkstätten sowie übliche soziale Einrichtungen müssen vorhanden sein. Art und Umfang der Produktion, des Sortiments und der Dienstleistungen sowie die Produktions- bzw. Arbeitsverfahren müssen gewährleisten, dass die Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten entsprechend der jeweiligen Ausbildungsordnung vermittelt werden können.
- die Zahl der Fachkräfte in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Auszubildenden steht. Als angemessen gilt in der Regel ein bis zwei Fachkräfte = ein/e Auszubildende/r; drei bis fünf Fachkräfte = zwei Auszubildende; je weitere drei Fachkräfte = ein/e weitere/r Auszubildende/r.
Eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht im vollen Umfang vermittelt werden können, kann dennoch geeignet sein, wenn diese durch Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte ergänzt werden. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten, aber auch Kooperationen mit anderen Ausbildungsunternehmen.
Eignung des Ausbilders/der Ausbilderin (vgl. § 28 BBiG)
Auszubildende darf nur einstellen, wer persönlich geeignet ist.
Persönlich ungeeignet ist insbesondere, wer
Persönlich ungeeignet ist insbesondere, wer
- Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf oder
- wiederholt oder schwer gegen das Berufsbildungsgesetz oder die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat.
Auszubildende darf nur ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist.
Fachlich geeignet ist in der Regel, wer
- eine Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung erfolgreich abgelegt hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf tätig gewesen ist oder
- über einen einschlägigen Hochschulabschluss und entsprechende berufliche Erfahrungen verfügt oder
- für einen im Ausland erworbenen Bildungsabschluss die Gleichwertigkeit gemäß BQFG festgestellt wurde und
- über berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse verfügt. Diese sind durch eine entsprechende Prüfung nachzuweisen (i.d.R. Ausbilder-Eignungsprüfung).
Berufsausbildungsvertrag (vgl. § 10 und 11 BBiG)
Am Anfang des Berufsausbildungsverhältnisses steht der Vertrag. Das Berufsbildungsgesetz schreibt vor, den wesentlichen Inhalt des Vertrages zwischen dem/der Ausbildenden und dem/der Auszubildenden schriftlich niederzulegen.
In die Vertragsniederschrift sind mindestens aufzunehmen:
- Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll
- Beginn und Dauer der Berufsausbildung
- Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
- Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit
- Dauer der Probezeit
- Zahlung und Höhe der Vergütung
- Dauer des Urlaubs
- Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann
- Hinweis auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
- Die Form des Ausbildungsnachweises (gem. § 13 Satz 2 Nr. 7 BBiG schriftlich oder elektronisch)
Dieser Vertrag ist vom Ausbildenden, dem/der Auszubildenden und bei Jugendlichen auch von deren Eltern zu unterschreiben. Nachdem der Vertrag bei der Industrie- und Handelskammer registriert wurde, erhalten die Vertragspartner je eine Ausfertigung nebst Eintragungsbestätigung. Bei elektronischer Abfassung ist die Vertragsabfassung so zu übermitteln, dass die Empfänger und Empfängerinnen diese speichern und ausdrucken können. Ausbildende haben den Empfang durch die Empfänger und Empfängerinnen nach Satz 1 nachzuweisen. Die Vertragsabfassung und den Empfangsnachweis haben Ausbildende nach Ablauf des Jahres, in dem das Ausbildungsverhältnis beendet wurde, drei Jahre lang aufzubewahren. Adressänderungen von Auszubildenden müssen der IHK unverzüglich mitgeteilt werden. Andere Änderungen, wie z. B. ein Wechsel des verantwortlichen Ausbilders, sollten mit der Ausbildungsberatung der IHK abgestimmt und dieser in geeigneter Weise übermittelt werden. Grundlegende Änderungen des Berufsausbildungsverhältnisses wie die Ausbildungsdauer oder der Beruf bedürfen eines sog. Änderungsvertrages. Für die Eintragung oder Änderung von Verträgen nutzen Sie bitte unsere Verzeichnisführung online oder alternativ unserer Vorlagen auf der Internetseite unter der Dokumentennummer 286999.
Zu Beginn der Ausbildung hat der/die Auszubildende dem/der Ausbildenden vorzulegen bzw. mitzuteilen:
- Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse
- Sozialversicherungsnummer
- ggf. Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis für ausländische Auszubildende
Es empfiehlt sich, den neuen Auszubildenden einen kurzen Fragebogen zur Selbstauskunft auszuhändigen.
Ärztliche Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
Die IHK darf Berufsausbildungsverträge von Minderjährigen nur in das Verzeichnis eintragen, wenn ihr zugleich mit dem Berufsausbildungsvertrag eine Kopie der Bescheinigung über die Erstuntersuchung (§32 JArbSchG) vorgelegt wird und diese nicht länger als 14 Monate zurückliegt. Ein Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung hat sich der Ausbildungsbetrieb die Bescheinigung (§33 JArbSchG) eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, dass der Jugendliche nachuntersucht worden ist, sofern bis dahin die Volljährigkeit noch nicht erreicht wurde.
Berechtigungsscheine für diese kostenlosen Untersuchungen gibt es bei den Einwohnermeldestellen, Gemeinde- bzw. Bürgerämtern am Wohnort des Jugendlichen. Die Wahl des Arztes bleibt dem/der Auszubildenden überlassen.
Probezeit (vgl. § 20 BBiG)
Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit einer Probezeit, die mindestens einen Monat dauern muss und höchstens vier Monate betragen darf. Während dieser Zeit, in der sich die Vertragspartner kennen lernen sollen, kann das Ausbildungsverhältnis von jeder Seite ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen schriftlich gekündigt werden.
Vergütung (vgl. § 17 BBiG)
Auszubildende erhalten eine angemessene Vergütung, die mindestens jährlich ansteigen muss. Wann die Vergütung im Einzelfall als angemessen anzusehen ist, richtet sich danach, ob ein einschlägiger Tarifvertrag besteht und die Vertragsparteien tarifgebunden sind. Besteht eine tarifliche Bindung oder ist der branchenübliche Tarif allgemeinverbindlich, so ist die dort festgelegte Ausbildungsvergütung maßgebend.
Besteht keine Tarifbindung, existiert aber ein branchenüblicher Tarif, in dessen Geltungsbereich das Ausbildungsverhältnis fällt und der somit anwendbar wäre, so ist die dort festgelegte Ausbildungsvergütung zugrunde zu legen und darf maximal um 20 Prozent unterschritten werden. Der Betrag darf allerdings nicht unterhalb der Mindestvergütung liegen.
In den wenigen verbleibenden Fällen gilt die gesetzliche Mindestvergütung, die wie folgt gestaffelt ist:
|
Beginn der
Ausbildung
|
1. Ausbildungs-
jahr
|
2. Ausbildungs-
jahr
|
3. Ausbildungs-
jahr
|
4. Ausbildungs-
jahr
|
| (jew. Kalenderj. v. 01.01.-31-12.) |
+ 18 %
|
+ 35 %
|
+ 40 %
|
|
| 2021 |
515,00 €
|
607,70 €
|
695,25 €
|
721,00 €
|
| 2022 |
550,00 €
|
649,00 €
|
742,50 €
|
770,00 €
|
| 2023 |
585,00 €
|
690,30 €
|
789,75 €
|
819,00 €
|
| 2024 |
620,00 €
|
731,60 €
|
837,00 €
|
868,00 €
|
| 2025 |
682,00 €
|
805,00 €
|
921,00 €
|
955,00 €
|
Bei Krankheit gilt ein Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung bis zu 6 Wochen.
Urlaub
Der/Die Auszubildende hat unter Fortzahlung der Vergütung einen Anspruch auf jährlichen Erholungsurlaub.
Grundsätzlich sollten alle Auszubildenden die gleiche Anzahl an Urlaubstagen erhalten und den vollzeitbeschäftigen Mitarbeitern gleichgestellt sein. Bei volljährigen Auszubildenden gilt der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch gemäß § 3 Bundesurlaubsgesetz von 24 Werktagen (vier Wochen).
Bei minderjährigen Auszubildenden gelten die Regelungen des JArbSchG. Danach beträgt der jährliche Urlaub
- mindestens 30 Werktage, wenn der/die Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist
- mindestens 27 Werktage, wenn der/die Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist
- mindestens 25 Werktage, wenn der/die Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist
Der Urlaub soll möglichst zusammenhängend in den Berufsschulferien genommen werden.
Pflichten des Ausbildenden (vgl. § 14 BBiG)
Der Ausbildende hat dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels notwendig ist. Die entsprechende Verordnung über die Berufsausbildung sowie die sachliche und zeitliche Gliederung sind so anzuwenden und umzusetzen, dass das Ausbildungsziel in der vorgegebenen Ausbildungszeit erreicht werden kann. Der Ausbildende kann dabei entweder selbst ausbilden oder eine andere Person ausdrücklich damit beauftragen.
Alle zur betrieblichen Ausbildung erforderlichen Ausbildungsmittel müssen den Auszubildenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Auszubildende sind zur Teilnahme am Berufsschulunterricht anzuhalten und entsprechend freizustellen (vgl. § 15 BBiG).
Weiter hat der Ausbildende dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet werden.
Der Ausbildende ist verpflichtet, die Ausbildungsnachweise regelmäßig durchzusehen. Den Auszubildenden ist Gelegenheit zu geben, den Ausbildungsnachweis am Arbeitsplatz zu führen.
Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren körperlichen Kräften angemessen sind.
Schließlich ist den Auszubildenden am Ende der Ausbildungszeit ein schriftliches Zeugnis auszustellen (vgl. § 16 BBiG).
Pflichten des Auszubildenden (vgl. § 13 BBiG)
Auszubildende haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungskompetenz zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Sie sind insbesondere verpflichtet, sorgfältig zu arbeiten; an Ausbildungsmaßnahmen und am Berufsschulunterricht teilzunehmen; Weisungen zu folgen, die im Rahmen der Berufsausbildung erteilt werden; die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten; Werkzeuge, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln; über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren sowie einen schriftlichen oder elektronischen Ausbildungsnachweis zu führen.
Ausbildungsnachweise (vgl. Verordnung über die Berufsausbildung)
Ausbildungsordnungen und das Berufsbildungsgesetz (BBiG §14) sehen vor, dass Auszubildende während ihrer Ausbildungszeit einen Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) führen müssen. Der ordnungsgemäß geführte Ausbildungsnachweis ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung. Der Ausbildende muss seine Auszubildenden zum Führen von Ausbildungsnachweisen anhalten und diese regelmäßig durchsehen. Der Ausbildungsnachweis ist täglich oder wöchentlich zu führen und mindestens monatlich durch den Ausbildenden oder benannten Ausbilder zu prüfen und abzuzeichnen (schriftlich oder elektronisch). Die Ausbildungsnachweise können stichwortartig geführt werden und umfassen die durchgeführten Tätigkeiten einschließlich der betrieblichen, überbetrieblichen und schulischen Inhalte. Abteilungs- oder Fachberichte zu bestimmten Themen stellen lediglich eine Ergänzung dar und können vom Ausbildenden zusätzlich verlangt werden. Die Bearbeitung erfolgt während der Ausbildungszeit im Betrieb.
Das Vorliegen eines ordnungsgemäß und vollständig geführten Ausbildungsnachweises wird mit der Unterschrift auf der Prüfungsanmeldung bestätigt. Die IHK behält sich vor, die Berichtshefte auch weiterhin anzufordern, insbesondere dann, wenn die Angaben für die Durchführung der Prüfung notwendig sind. Außerdem sind die Berichtshefte auf Verlangen den Ausbildungsberatern der IHK vorzulegen. Bei elektronisch geführten Berichtsheften ist für die IHK ein entsprechender Zugang zu gewährleisten.
Freistellung Berufsschule (vgl. § 15 BBiG)
Schulpflichtig sind in Nordrhein-Westfalen alle Auszubildende, die ihre Ausbildung vor Vollendung des 21. Lebensjahres beginnen (§ 38 Abs. 1 SchulG NRW). Dies gilt dann für die gesamte Ausbildungszeit. Auszubildende, die bei Beginn der Ausbildung 21 Jahre oder älter sind, sind berufsschulberechtigt, aber nicht verpflichtet (§ 38 Abs. 4 SchulG NRW).
Der Ausbildende ist verpflichtet, seine Auszubildenden vor Beginn der Berufsausbildung bei der zuständigen Berufsschule anzumelden, zur Teilnahme am Berufsschulunterricht anzuhalten und entsprechend – unter Fortzahlung der Vergütung – freizustellen (§ 15 BBiG, § 9 JArbSchG). Der Ausbildende muss ihnen also die Teilnahme am Unterricht ermöglichen und darf sie während dieser Zeit nicht beschäftigen – egal wie dringlich die Erledigung im Betrieb anfallender Arbeiten auch sein mag.
Zudem dürfen Auszubildende vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht nicht beschäftigt werden (§ 9 JArbSchG).
- Freistellung für virtuellen Unterricht
Die Freistellungsverpflichtung gilt auch für virtuellen Unterricht z. B. per Videokonferenz. Maßgeblich für die Freistellungspflicht ist die von der Berufsschule für den virtuellen Unterricht veranschlagte Zeit. - Unterrichtsausfall
Fällt der Unterricht aus, entfällt auch die Freistellungspflicht, so dass der Auszubildende unverzüglich in den Betrieb zurückkehren muss. - Sanktionen bei Nichtfreistellung
Stellt der Ausbildungsbetrieb seine Auszubildenden nicht für den Schulbesuch frei, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße bis 5.000 Euro (bei Minderjährigen: bis 15.000 Euro) geahndet wird (§ 101 Abs. 1 Nr. 4 BBiG, § 58 Abs. 5 Nr. 6 JArbSchG).
Im Wiederholungsfall kann dem Ausbildungsbetrieb außerdem die Ausbildungsbefugnis durch die IHK entzogen werden (§ 33 BBiG).
Auszubildende, die vom Ausbildungsbetrieb nicht für den Berufsschulbesuch freigestellt werden, sind berechtigt, „eigenmächtig“ am Unterricht teilzunehmen. Der Ausbildungsbetrieb darf sie deshalb nicht abmahnen, kündigen oder ihnen hierfür Urlaub abziehen.
Anrechnung der Berufsschulzeit (vgl. §15 BBiG)
Von der Freistellung zu unterscheiden ist die Frage der Anrechnung der Berufsschulzeit. Die Anrechnung regelt, in wie weit die Berufsschulzeit als Arbeitszeit gilt, also die betriebliche Ausbildungszeit ersetzt.
Die Anrechnung der Berufsschulzeit ist seit dem 01.01.2020 für jugendliche und erwachsene Auszubildende gleich geregelt:
- Grundsätzliche Anrechnungsregel
Berufsschulunterricht wird grundsätzlich mit der tatsächlichen Unterrichtszeit plus Pausen auf die Ausbildungszeit angerechnet (§ 9 Abs. 2 Nr. 3 JArbSchG, § 15 Abs. 2 Nr. 1 BBiG).
Seit dem 1. August 2024 ist die Wegezeit von der Berufsschule zum Betrieb auf die Arbeitszeit anzurechnen (§ 15 Abs. 2 Nummer 1 BBiG).
Gleiches gilt für Prüfungen:
Auch die Fahrtzeit zwischen Prüfungsort und Betrieb muss vom Ausbildungsbetrieb als Arbeitszeit angerechnet werden.
- Ausnahme: Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden
Ein Berufsschultag pro Woche mit mehr als 5 Unterrichtsstunden à 45 Minuten wird mit der durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit angerechnet (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 JArbSchG; § 15 Abs. 2 Nr. 2 BBiG). Die Anrechnungspflicht gilt auch, wenn der Berufsschultag außerhalb der betrieblichen Arbeitszeit liegt.
Sind in einer Woche zwei Berufsschultage mit jeweils mehr als 5 Unterrichtsstunden, ist der Auszubildende verpflichtet, an einem der beiden Tage wieder in den Betrieb zurückzukehren – an welchem der beiden Tage, bestimmt der Ausbildungsbetrieb. - Ausnahme: Blockunterricht
Blockunterricht von planmäßig mindestens 25 Unterrichtsstunden à 45 Minuten (an mindestens 5 Tagen) mit der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit anzurechnen, das heißt in dieser Woche ist die Ausbildungszeit durch den Berufsschulbesuch erfüllt.
Die Anrechnungsregel gilt nur, wenn der Unterricht auch stattfindet, also nicht, wenn der Unterricht beispielsweise an einem Tag ausfällt. Dann erfolgt die Anrechnung der Berufsschulzeit nach der Grundregel (= tatsächliche Unterrichtszeit + Pausen ohne Wegezeit).
Erwachsene Auszubildende und ihr Ausbildungsbetrieb können vereinbaren, dass Ausbildungszeiten nach der Berufsschule zeitlich auf andere Tage verschoben werden. Allerdings darf dabei eine Ausbildungsdauer von 10 Stunden täglich und 48 Stunden wöchentlich - wobei die Berufsschulzeit anzurechnen ist - nicht überschritten werden. Es bestehen teilweise branchenspezifische Besonderheiten.
Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungsdauer (vgl. § 8 BBiG)
Auf gemeinsamen Antrag der Vertragspartner hat die IHK die Ausbildungsdauer zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Dauer erreicht wird. Eine Verkürzung der Ausbildungszeit kann bereits bei Vertragsabschluss vereinbart werden. Eine nachträgliche Verkürzung im Verlauf der Ausbildung geht mit einem Änderungsvertrag einher. Es wird insbesondere die Vorbildung des Auszubildenden zugrunde gelegt und das Ausbildungsverhältnis im Nachhinein verkürzt. Auf die Ausbildungszeit kann z. B. ein höherwertiger allgemeinbildender Schulabschluss oder eine Berufsausbildung in demselben oder einem verwandten Beruf (anteilig) angerechnet werden (z. B. bei Abitur maximal 12 Monate). Mehrere Abkürzungsmöglichkeiten können nebeneinander berücksichtigt werden. Die Mindestausbildungsdauer darf jedoch die Hälfte der regulären Dauer gemäß der Ausbildungsordnung nicht unterschreiten (z. B. 18 Monate und bei einer regulären Dauer von 36 Monaten). Die aktuellen Leistungen des Auszubildenden finden keine Berücksichtigung. Für die Änderung von Verträgen nutzen Sie bitte unsere Verzeichnisführung online oder alternativ unserer Vorlagen auf der Internetseite unter der Dokumentennummer 286999.
In Ausnahmefällen kann es auch zu einer Verlängerung der Ausbildungszeit kommen, bevor eine Prüfung abgelegt wurde, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sofern nicht ohnehin Einigkeit zwischen den Vertragspartnern besteht, z. B. wegen langfristiger Erkrankung, können Auszubildende bei der IHK einen entsprechenden Antrag stellen. Vor der Entscheidung ist der Ausbildende zu hören.
Vorzeitige Zulassung zur Prüfung (vgl. § 45 Abs. 1 BBiG)
Eine vorzeitige Zulassung zur Prüfung erfolgt aufgrund guter Leistungen im Verlauf der Berufsausbildung, d.h. die für die Abschlussprüfung relevanten Leistungen in der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb müssen jeweils mit mindestens 2,49 (gut) bewertet werden. Die vorzeitige Zulassung ermöglicht das Vorziehen der Abschlussprüfung um einen Termin (6 Monate). Die Vorbildung des Auszubildenden (Schulabschluss, andere Ausbildung etc.) ist dabei nicht von Bedeutung. Die Mitteilung erfolgt telefonisch oder per Mail an die IHK und Sie erhalten die entsprechenden personalisierten Bescheinigungen für die Berufsschule und den Ausbildungsbetrieb. Eine Liste der Ausbildungsberufe mit den jeweiligen Ansprechpartnerinnen der Prüfungssachbearbeitung finden Sie auf unserer Internetseite unter der Dokumentennummer 70849. Die berufsabhängigen Anmeldefristen sind selbstverständlich zu berücksichtigen.
Prüfungen und Beendigung der Berufsausbildung
Ob für den jeweiligen Ausbildungsberuf die klassische Prüfungsform mit einer Zwischen- und Abschlussprüfung oder das Modell der gestreckten Abschlussprüfung angewandt wird, regelt die jeweilige Verordnung über die Berufsausbildung.
Bei der klassischen Prüfungsform findet die Zwischenprüfung i.d.R. nach der Hälfte der Ausbildungszeit statt und dient der Feststellung des aktuellen Leistungsstandes. Es sollen eventuelle Lücken sichtbar gemacht und den Beteiligten die Möglichkeit gegeben werden, diese bis zur Abschlussprüfung zu schließen. Auszubildende und Ausbildungsbetrieb erhalten eine Bescheinigung über das Prüfungsergebnis. Die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist Zulassungsvoraussetzung zur späteren Abschlussprüfung.
Die Abschlussprüfung wird am Ende der Ausbildungszeit durchgeführt. Welche Bereiche und Inhalte geprüft werden und in welcher Form die Prüfung stattfindet, ist ebenfalls in der jeweiligen Verordnung über die Berufsausbildung geregelt.
Die sog. gestreckte Abschlussprüfung findet mittlerweile bei vielen Berufen Anwendung. Nähere Informationen und Hinweise auf die rechtlichen Vorgaben finden Sie unter der Dokumentennummer 4786040.
Unabhängig von der Prüfungsform endet das Berufsausbildungsverhältnis mit dem Ablauf der Ausbildungsdauer. Bestehen Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungsdauer die Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses. Üblicherweise sind die Prüfungen so terminiert, dass für die meisten Auszubildenden die Prüfungen vor dem vertraglichen Ausbildungsende stattfinden. Bei Bestehen der Prüfung erhalten die Auszubildenden ein Prüfungszeugnis der IHK.
Sollten Auszubildende die Abschlussprüfung nicht bestehen, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr. Die Abschlussprüfung kann zweimal wiederholt werden, sofern eine rechtzeitige Anmeldung zur Wiederholungsprüfung erfolgt. Dies gilt auch, wenn das Ausbildungsverhältnis zum Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung nicht mehr besteht.
Kündigung (vgl. § 22 BBiG)
Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Nach Ablauf der Probezeit kann der Vertrag nur fristlos aus wichtigem Grund gekündigt werden oder von Seiten des Auszubildenden mit einer Frist von vier Wochen, wenn die Berufsausbildung aufgegeben wird oder er/sie sich in einem anderen Beruf ausbilden lassen will. Die Kündigung muss in jedem Fall schriftlich und nach der Probezeit auch unter Angabe von Gründen erfolgen.
Eine Vertragsauflösung in gegenseitigem Einvernehmen ist jederzeit möglich. Hierzu schließen die Vertragspartner einen Aufhebungsvertrag. Ein Muster finden Sie auf unserer Internetseite unter der Dokumentennummer 286999.
Schlichtungsausschuss
Sollte es einmal zu ernsthaften Auseinandersetzungen und Streitigkeiten zwischen den Vertragspartnern kommen, die weder durch die Beteiligten selbst noch nach Hinzuziehen der IHK-Ausbildungsberatung beigelegt werden können, hat die IHK einen Schlichtungsausschuss eingerichtet (siehe Dokumentennummer 5033380).
Der Termin vor dem IHK-Schlichtungsausschuss ist einer möglichen Klage vor dem zuständigen Arbeitsgericht zwingend vorgeschaltet.