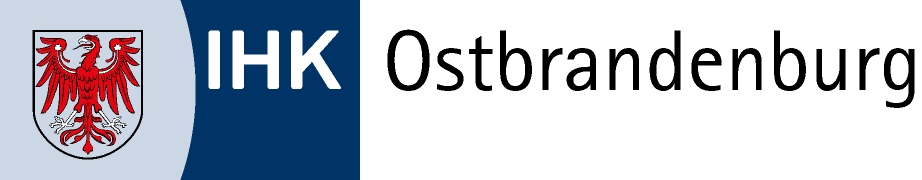Beschäftigung von Minderjährigen
1. Verbot von Kinderarbeit
Kinder unter 13 Jahren dürfen grundsätzlich gar nicht beschäftigt werden.
Dies gilt nicht, sofern die Beschäftigung durch Personensorgeberechtigte im Familienhaushalt erfolgt oder die Kinder lediglich geringfügige Hilfeleistung erbringen, soweit sie gelegentlich aus Gefälligkeit, auf Grund familienrechtlicher Vorschriften, in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter erbracht werden.
Ausnahmsweise ist die Beschäftigung von Kindern zudem dann erlaubt, wenn dies zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, im Rahmen eines Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht oder in Erfüllung einer richterlichen Weisung erfolgt.
Eine weitere Ausnahme von diesem Grundsatz gilt schließlich gemäß § 6 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) für die gestaltende Mitwirkung von Kindern bei bestimmten kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Theatervorstellungen, Musikaufführungen, Werbeveranstaltungen et cetera, die jedoch jeweils der behördlichen Bewilligung nach Anhörung des zuständigen Jugendamtes bedarf.
Die Beschäftigung des Kindes darf erst nach Empfang des Bewilligungsbescheides erfolgen! Weitere Informationen zu den kulturellen Ausnahmen finden Sie nachstehend unter Absatz 3. “Besonderheiten bei Veranstaltungen”.
2. Stundenweise Beschäftigung von vollzeitschulpflichtigen Minderjährigen
Leichte Beschäftigung
Kinder ab dem 13. Geburtstag und Jugendliche zwischen Vollendung des 15. und 18. Lebensjahres, die noch der Vollzeitschulpflicht (die Dauer der Vollzeitschulpflicht richtet sich nach dem jeweiligen Schulgesetz des konkreten Bundeslandes) unterliegen, dürfen mit Einwilligung der Eltern stundenweise beschäftigt werden, soweit die Beschäftigung leicht und für sie geeignet ist (vergleiche §§ 5 Absatz 3, 2 Absatz 3 JArbSchG). Bei dieser Einwilligung handelt es sich um die vorherige Zustimmung vor Aufnahme der Tätigkeit, die auch mündlich erteilt werden kann.
Tipp: Der Arbeitgeber sollte sich die Einwilligung der Eltern, eine Kopie der Geburtsurkunde sowie eine Schulbescheinigung geben lassen und den Ausweis zeigen lassen!
Die Beschäftigung ist leicht, wenn sie sich aufgrund ihrer Beschaffenheit und der besonderen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird, weder auf die Sicherheit, die Gesundheit oder die Entwicklung, noch auf den Schulbesuch, die Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung oder Berufsausbildung und die Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen, nachteilig auswirkt.
Beispiele: Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättern, Prospekten und Werbezetteln ohne schweres Tragen, Botengänge, Betreuung von Kindern und Haustieren, Nachhilfeunterricht, Tätigkeiten in Haushalt und Garten, Einkaufstätigkeiten, Handreichungen beim Sport oder der Tierversorgung, Autoreinigungen, Auffüllen von Regalen ohne schweres Heben, einfache Telefondienste et cetera.
Achtung: Nicht erlaubt sind unter anderem Tätigkeiten, die von der Kinderarbeitsschutzverordnung (KindArbSchV) erfasst sind. Hierzu gehören sämtliche Beschäftigungen, die infolge ungünstiger Körperhaltungen physisch belastend oder gefahrengeneigt sind. Erst recht gelten für Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche die Verbote von § 22 JArbSchG, die nachstehend unter 5. weiter ausgeführt werden. Die erlaubten Tätigkeiten für Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche sind deutlich enger gefasst. Daher können von dem Beschäftigungsverbot auch Arbeiten im produzierenden Gewerbe, auf Baustellen, in Tankstellen, oder in Kfz-Werkstätten erfasst sein.
Tipp: Zweifelsfragen vor geplanter Arbeitsaufnahme mit der zuständigen Behörde klären.
Erlaubte Arbeitszeiten
Die Beschäftigung selbst mit leichten und geeigneten Arbeiten darf in ihrer Länge nicht mehr als zwei Stunden täglich, in landwirtschaftlichen Familienbetrieben in ihrer Länge nicht mehr als drei Stunden täglich, betragen. Die Arbeitszeit darf nicht zwischen 18 und 8 Uhr sowie nicht vor und nicht während des Schulunterrichts liegen. Weiter gelten die Fünf-Tage-Woche und die Samstags-, Sonn- und Feiertagsruhe. Die Nachtruhe ab 18:00 Uhr sowie die Untersagung der Arbeit vor und während der Schulzeit soll die Konzentrationsfähigkeit des Kindes und vollzeitschulpflichtigen Jugendlichen im Hinblick auf den Schulunterricht gewährleisten, gilt jedoch auch, wenn das Kind (temporär) nicht am Schulunterricht teilnimmt. Während der schulfreien Tage ist hingegen nur die Nachtruhe zwischen 18:00 und 08:00 Uhr relevant.
Nicht vollzeitschulpflichtige Kinder dürfen außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses bis zu sieben Stunden täglich und maximal 35 Stunden wöchentlich mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden.
Ruhepausen sind stets einzuhalten. Bei einer Arbeitszeit von viereinhalb bis sechs Stunden beträgt die Pause 30 Minuten, bei einer längeren Arbeitszeit 60 Minuten. Damit eine Arbeitsunterbrechung als Pause gilt, muss die Arbeit für mindestens 15 Minuten unterbrochen werden. Auch dürfen maximal viereinhalb Stunden am Stück gearbeitet werden, ohne dass eine Pause gewährt wird.
3. Besonderheiten bei Veranstaltungen
Auf Antrag bei der zuständigen Behörde können Kinder ab drei Jahren bei Musik- und Werbeveranstaltungen oder bei Film- und Fotoaufnahmen gestaltend mitwirken. Bei Theatervorstellungen ist eine Ausnahmebewilligung für Kinder ab sechs Jahren möglich. Die maximale Arbeitszeit richtet sich nach dem Alter.
Jugendliche dürfen bei
- Musikaufführungen,
- Theatervorstellungen und anderen Aufführungen,
- bei Aufnahmen im Hörfunk und Fernsehen,
- auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
von 6 Uhr bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Nach Beendigung einer solchen Tätigkeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Frist von mindestens 14 Stunden beschäftigt werden. Dass eine Tätigkeit Jugendlicher nur bei Vorstellungen, Aufführungen et cetera erlaubt ist, bei denen die Anwesenheit Jugendlicher nicht nach den Vorschriften des Jugendschutzgesetzes verboten ist, versteht sich dabei von selbst.
Kinder unter sechs Jahren dürfen nach behördlicher Bewilligung maximal bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit zwischen 08:00 und 17:00 Uhr bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und TV), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen mitwirken, Kinder über sechs Jahre dürfen dies bis zu drei Stunden täglich zwischen 08:00 und 22:00 Uhr.
Bei Theatervorstellungen dürfen Kinder über sechs Jahren nach behördlicher Bewilligung maximal bis zu vier Stunden täglich in der Zeit von 10:00 bis 23:00 Uhr mitwirken.
4. Besonderheiten für Ferienjobs und Schüler-Praktika
Jobs in den Schulferien
Jugendliche über 15 Jahren dürfen – solange sie der Vollzeitschulpflicht unterliegen – im Kalenderjahr zusätzlich zu den oben aufgezeigten Möglichkeiten einer Beschäftigung in den Schulferien für höchstens vier Wochen nachgehen. Das sind mit Blick auf die Fünf-Tage-Woche höchstens 20 Arbeitstage im Kalenderjahr. Wie diese 20 Tage auf die amtlich festgelegten Ferien verteilt werden, ist nicht vorgeschrieben, so dass mehrere kürzere Ferienjobs oder ein langer Ferienjob in den Sommerferien denkbar sind. Die tägliche Arbeitszeit darf dabei in der Regel nicht mehr als acht Stunden betragen, so dass die wöchentliche Arbeitszeit während der Schulferien auf 40 Stunden beschränkt ist.
Schüler-Betriebspraktika
Kinder und Jugendliche ohne Altersbeschränkung dürfen im Rahmen eines nach Landesschulrecht vorgeschriebenen Praktikums in der Vollzeitschulpflicht bis zu fünf Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich zu leichten, für sie geeigneten Tätigkeiten herangezogen werden, sofern das Praktikum während der Schulzeit stattfindet. Findet es am Nachmittag statt, ist es auf zwei Stunden täglich und zwölf Stunden in der Woche beschränkt.
5. Beschäftigung nicht vollzeitschulpflichtiger Jugendlicher
Auch mit nicht mehr vollzeitschulpflichtigen Jugendlichen können Arbeitsverträge wirksam nur mit Zustimmung von deren gesetzlichen Vertretern geschlossen werden. Ohne Zustimmung geschlossene Arbeitsverträge sind bis zur nachträglichen Genehmigung schwebend unwirksam. Wird die Genehmigung nicht erteilt, ist der Arbeitsvertrag von Anfang an als nichtig zu betrachten mit der Folge, dass der Arbeitgeber grundsätzlich keine Ansprüche gegen den Jugendlichen oder dessen Eltern ableiten kann.
Jugendliche, die nicht vollzeitschulpflichtig sind, dürfen grundsätzlich nicht mehr als acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten; in der Spitze ist nach Maßgabe der §§ 8 Absatz 2, Absatz 2a JArbschG zum Freizeitausgleich eine temporäre tägliche Arbeitszeit von achteinhalb Stunden möglich. Jugendliche dürfen grundsätzlich nur in der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr beschäftigt werden. Es sind Ausnahmen vorgesehen, wenn die besonderen Bedingungen einzelner Berufe dies erfordern (zum Beispiel Landwirtschaft, Gaststätten).
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden. Außerdem besteht ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, für das es jedoch jeweils Ausnahmen gibt. Allerdings müssen auch im Falle einer Ausnahme vom Beschäftigungsverbot jeweils zwei Sonn- und Samstage beschäftigungsfrei bleiben und ist trotz Wochenendarbeit eine Fünf-Tage-Woche sicherzustellen.
Während Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche grundsätzlich nur leichten Beschäftigungen nachgehen dürfen, sind die möglichen Tätigkeiten für nicht vollzeitschulpflichtige Jugendliche weiter gefasst. Allerdings gibt es auch für sie gemäß § 22 JArbSchG Beschäftigungsverbote für gefährliche Arbeiten, Akkordarbeit und Arbeit unter Tage.
Gefährliche Arbeiten sind solche Tätigkeiten, die entweder die individuelle körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der Minderjährigen übersteigen, objektiv mit einer sittlichen Gefahr verbunden sind, gefahrengeneigte Tätigkeiten mit erhöhter Unfallgefahr darstellen, die Minderjährigen durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte gefährden, oder sie schädlichen Erschütterungen, Lärm oder Strahlen aussetzen. Insbesondere zählen hierzu Tätigkeiten auf Gerüsten, Abbrucharbeiten, Arbeiten mit schnell laufenden Geräten, Arbeiten mit explosiven, leicht entzündlichen Stoffen sowie Elektrizität, in Hüttenwerken, medizinischen Einrichtungen, Kühlräumen und Schlachthöfen. Eine Orientierung bezüglich der sittlich gefährdenden Tätigkeiten bieten Vorschriften wie das Jugendschutzgesetz. So ist regelmäßig die Beschäftigung als Bedienung oder Barpersonal in einem Nachtlokal oder die Mitwirkung an der Herstellung pornografischer oder kriegsverherrlichender Inhalte gefährdend und verboten. Als jugendgefährdend dürfte auch die Mitarbeit in einem dem Glücksspiel dienenden Lokal einzustufen sein.
6. Anzuwendende Vorschriften und Regelungen
Sonderschutz für Minderjährige
Wie ausgeführt, sind ergänzend die Jugendarbeitsschutzvorschriften, wie sie auch bei jugendlichen Auszubildenden gelten, zu beachten. Diese Vorschriften sind zwingend, eine für den Minderjährigen ungünstigere einzelvertragliche Regelung wäre unwirksam.
Bei der Beschäftigung von nicht schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen muss sowohl vor als auch während der Beschäftigung ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorgelegt werden. Dies gilt jedoch nicht, sofern nur eine geringfügige Beschäftigung oder eine nicht länger als zwei Monate dauernde Tätigkeit ausgeübt wird, von der keine gesundheitlichen Nachteile zu erwarten sind.
Nachtruhe
Ausnahmen von der Nachtruhe für über 16-Jährige:
- in Gaststätten und Schaustellerbetrieben bis 22 Uhr,
- in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr, für über 17-Jährige in Bäckereien ab 4 Uhr,
- in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr und
- in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr.
Diese Ausnahmen für eine längere Beschäftigung am Abend gelten jedoch nicht für den Abend vor einem Berufsschultag, wenn der Unterricht vor 9 Uhr beginnt. In diesem Fall dürfen Jugendliche nach 20 Uhr nicht mehr beschäftigt werden.
In Betrieben, in denen die Beschäftigten in außergewöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, dürfen Jugendliche in der warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden. Die Jugendlichen sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in regelmäßigen Zeitabständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er diese nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.
Urlaubsansprüche von Minderjährigen
Jugendliche haben einen gegenüber Erwachsenen erhöhten jährlichen Mindesturlaubsanspruch:
- bis 16 Jahre: 30 Werktage;
- bis 17 Jahre: 27 Werktage;
- bis 18 Jahre: 25 Werktage.
Der gesetzliche Mindesturlaub für Kinder beträgt wie bei 15-jährigen 30 Werktage. Die Bestimmung der einschlägigen Altersstufe richtet sich danach, welches Alter der Jugendliche am 1. Januar des jeweiligen Kalenderjahres hat. Ebenso erfolgt eine Reduzierung des Mindesturlaubsanspruchs bei einer Teilzeitbeschäftigung nur an einzelnen Wochentagen.
Abschließender Hinweis:
Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz sowie unerlaubte Kinderarbeit sind mindestens bußgeldbewährt und teilweise auch strafbar. Wir regen daher dringend an, im Zweifel vor Aufnahme der geplanten Tätigkeit die rechtlichen Rahmenbedingungen im Einzelfall abschließend zu klären.
Der Arbeitgeber sollte sich im Zweifel die Einwilligung der Eltern, eine Kopie der Geburtsurkunde oder den Ausweis sowie eine Schulbescheinigung zeigen lassen.
Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz sowie unerlaubte Kinderarbeit sind mindestens bußgeldbewährt und teilweise auch strafbar. Wir regen daher dringend an, im Zweifel vor Aufnahme der geplanten Tätigkeit die rechtlichen Rahmenbedingungen im Einzelfall abschließend zu klären.
Der Arbeitgeber sollte sich im Zweifel die Einwilligung der Eltern, eine Kopie der Geburtsurkunde oder den Ausweis sowie eine Schulbescheinigung zeigen lassen.
Haftung
Diese Kurzinformation soll – als Service Ihrer Kammer – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl diese Kurzinformation mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit übernommen werden.
Diese Kurzinformation soll – als Service Ihrer Kammer – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl diese Kurzinformation mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit übernommen werden.