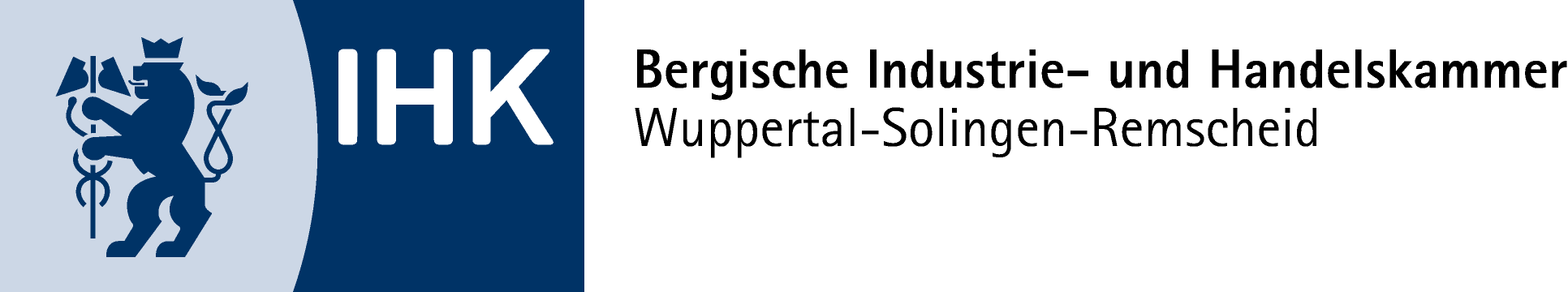Geschäftsbezeichnung des nicht eingetragenen Unternehmens
Die Geschäftsbezeichnung der nicht im Handelsregister eingetragenen Gewerbetreibenden
Allgemeines
Das Handelsrecht unterscheidet zwischen Gewerbetreibenden, die im Handelsregister eingetragen sind (Kaufleute), und solchen, die nicht eingetragen sind (Kleingewerbetreibende). Nicht ins Handelsregister eingetragene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Art der Tätigkeit einfach, der Geschäftsumfang überschaubar und kaufmännische Einrichtungen wie doppelte Buchführung, Inventur und Bilanz nicht erforderlich sind. Einfacher Art sind solche Geschäfte, die unkompliziert abgewickelt werden können, bei denen langfristige Dispositionen nicht erforderlich sind und auch keine lang andauernden Gewährleistungsfristen eingehalten werden müssen. Kleingewerbetreibende haften für Verbindlichkeiten aus der gewerblichen Tätigkeit unbeschränkt sowohl mit dem Betriebs- als auch mit dem Privatvermögen (siehe auch die Merkblätter "Das Handelsregister - Hinweise zu Eintragung, Kaufmannseigenschaft und Firmierung" und "Freiwillige Eintragung in das Handelsregister" unter "Weitere Informationen").
Unterscheidung zwischen "Geschäftsbezeichnung" und "Firma"
Nur der eingetragene Kaufmann darf eine Firma führen; es ist die Bezeichnung, unter der er im Handelsverkehr auftritt, Verträge schließt, klagt und verklagt wird, also der offizielle Name des Kaufmanns. Kleingewerbetreibende treten im geschäftlichen Verkehr dagegen mit dem Familiennamen und einem ausgeschriebenen Vornamen auf. Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts müssen alle Gesellschafter mit Vor- und Zunamen genannt werden. Das gilt für Geschäftsbriefe, die an bestimmte andere Personen gerichtet werden, und andere Formen rechtsverbindlichen Handelns. Zulässig ist es aber, wenn als Zusatz zum Namen Branchenbezeichnungen oder Tätigkeitsangaben hinzugefügt werden, zum Beispiel "Max Schmeling, Holzhandel", "Josef Meier, Handelsvertreter".
In der Werbung können Kleingewerbetreibende dagegen eine sog. Geschäftsbezeichnung – auch Etablissementsbezeichnung genannt – verwenden. Es handelt sich dabei um Wahlnamen, die eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben können, denn sie sind ein wichtiges Mittel, durch das der Namensträger in seinen Beziehungen zur Umwelt Individualität, Identität und Unterscheidbarkeit von anderen wahrt. Sie dienen einer werbewirksamen Beschreibung des Unternehmens und haben "schmückende" Funktion. Geschäftsbezeichnungen werden häufig am Geschäftslokal, in Zeitungsinseraten, auf Visitenkarten und auf der Homepage des Unternehmens verwendet; sie dürfen aber auch im Briefkopf erscheinen, wenn sie nicht den Eindruck einer Firma erwecken und auf dem Bogen der Name des Gewerbetreibenden genannt wird.
Eine Geschäftsbezeichnung ist vor Verwechslungen geschützt. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie kennzeichnungskräftig ist und in rechtmäßiger Weise verwendet wird (vgl. hierzu das Merkblatt "Der Schutz gewerblicher Bezeichnungen").
Die Wahl einer Geschäftsbezeichnung
Bei der Wahl der Geschäftsbezeichnung stehen dem Gewerbetreibenden viele Möglichkeiten offen. Er sollte aber auf die folgenden Punkte achten:
Die gewählte Bezeichnung darf nicht geeignet sein, das angesprochene Publikum über maßgebliche Umstände zu täuschen. So darf die Bezeichnung nicht den Eindruck einer Größe oder Bedeutung erwecken, die das Unternehmen in Wirklichkeit gar nicht besitzt, beispielsweise "Internationaler Modeschmuckvertrieb" für einen Kleinbetrieb.
Weiterhin darf durch die Wahl der Geschäftsbezeichnung keine Handelsregistereintragung vorgetäuscht werden. Aus diesem Grunde ist die Verwendung eines Inhaberzusatzes (zum Beispiel des Begriffes "Inhaber" oder der allgemein verständlichen Abkürzung "Inh.") durch Unternehmer, die nicht in das Handelsregister eingetragen sind, zu vermeiden. Solche Inhaberzusätze lassen regelmäßig auf in das Handelsregister eingetragen Firma schließen. Auch Zusätze wie "Nachfolger", "Gebrüder", "Partner" oder ähnliche können auf eine eingetragene Firma hindeuten.
Allgemeines
Das Handelsrecht unterscheidet zwischen Gewerbetreibenden, die im Handelsregister eingetragen sind (Kaufleute), und solchen, die nicht eingetragen sind (Kleingewerbetreibende). Nicht ins Handelsregister eingetragene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Art der Tätigkeit einfach, der Geschäftsumfang überschaubar und kaufmännische Einrichtungen wie doppelte Buchführung, Inventur und Bilanz nicht erforderlich sind. Einfacher Art sind solche Geschäfte, die unkompliziert abgewickelt werden können, bei denen langfristige Dispositionen nicht erforderlich sind und auch keine lang andauernden Gewährleistungsfristen eingehalten werden müssen. Kleingewerbetreibende haften für Verbindlichkeiten aus der gewerblichen Tätigkeit unbeschränkt sowohl mit dem Betriebs- als auch mit dem Privatvermögen (siehe auch die Merkblätter "Das Handelsregister - Hinweise zu Eintragung, Kaufmannseigenschaft und Firmierung" und "Freiwillige Eintragung in das Handelsregister" unter "Weitere Informationen").
Unterscheidung zwischen "Geschäftsbezeichnung" und "Firma"
Nur der eingetragene Kaufmann darf eine Firma führen; es ist die Bezeichnung, unter der er im Handelsverkehr auftritt, Verträge schließt, klagt und verklagt wird, also der offizielle Name des Kaufmanns. Kleingewerbetreibende treten im geschäftlichen Verkehr dagegen mit dem Familiennamen und einem ausgeschriebenen Vornamen auf. Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts müssen alle Gesellschafter mit Vor- und Zunamen genannt werden. Das gilt für Geschäftsbriefe, die an bestimmte andere Personen gerichtet werden, und andere Formen rechtsverbindlichen Handelns. Zulässig ist es aber, wenn als Zusatz zum Namen Branchenbezeichnungen oder Tätigkeitsangaben hinzugefügt werden, zum Beispiel "Max Schmeling, Holzhandel", "Josef Meier, Handelsvertreter".
In der Werbung können Kleingewerbetreibende dagegen eine sog. Geschäftsbezeichnung – auch Etablissementsbezeichnung genannt – verwenden. Es handelt sich dabei um Wahlnamen, die eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben können, denn sie sind ein wichtiges Mittel, durch das der Namensträger in seinen Beziehungen zur Umwelt Individualität, Identität und Unterscheidbarkeit von anderen wahrt. Sie dienen einer werbewirksamen Beschreibung des Unternehmens und haben "schmückende" Funktion. Geschäftsbezeichnungen werden häufig am Geschäftslokal, in Zeitungsinseraten, auf Visitenkarten und auf der Homepage des Unternehmens verwendet; sie dürfen aber auch im Briefkopf erscheinen, wenn sie nicht den Eindruck einer Firma erwecken und auf dem Bogen der Name des Gewerbetreibenden genannt wird.
Eine Geschäftsbezeichnung ist vor Verwechslungen geschützt. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie kennzeichnungskräftig ist und in rechtmäßiger Weise verwendet wird (vgl. hierzu das Merkblatt "Der Schutz gewerblicher Bezeichnungen").
Die Wahl einer Geschäftsbezeichnung
Bei der Wahl der Geschäftsbezeichnung stehen dem Gewerbetreibenden viele Möglichkeiten offen. Er sollte aber auf die folgenden Punkte achten:
Die gewählte Bezeichnung darf nicht geeignet sein, das angesprochene Publikum über maßgebliche Umstände zu täuschen. So darf die Bezeichnung nicht den Eindruck einer Größe oder Bedeutung erwecken, die das Unternehmen in Wirklichkeit gar nicht besitzt, beispielsweise "Internationaler Modeschmuckvertrieb" für einen Kleinbetrieb.
Weiterhin darf durch die Wahl der Geschäftsbezeichnung keine Handelsregistereintragung vorgetäuscht werden. Aus diesem Grunde ist die Verwendung eines Inhaberzusatzes (zum Beispiel des Begriffes "Inhaber" oder der allgemein verständlichen Abkürzung "Inh.") durch Unternehmer, die nicht in das Handelsregister eingetragen sind, zu vermeiden. Solche Inhaberzusätze lassen regelmäßig auf in das Handelsregister eingetragen Firma schließen. Auch Zusätze wie "Nachfolger", "Gebrüder", "Partner" oder ähnliche können auf eine eingetragene Firma hindeuten.
- Schließlich sollte überprüft werden, ob nicht schon ein anderer Betrieb in demselben geographischen Wirkungsbereich die konkret ins Auge gefasste Geschäftsbezeichnung verwendet.
Bei Zweifeln über die Wahl der Bezeichnung oder die Gestaltung der Geschäftspapiere hilft Ihnen Ihre Kammer gerne weiter.
Formen von Geschäftsbezeichnungen
Geschäftliche Bezeichnungen sind Namen, die der Inhaber zur Bezeichnung des Unternehmens, des Geschäfts oder seiner Produkte wählt, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Sie sollen also auffallend, einprägsam und werbewirksam sein. Die Ausprägung ist äußerst vielfältig. Sie reicht von den typischen Etablissementbezeichnungen, die in einigen Branchen üblich sind (zum Beispiel "Rathaus-Apotheke", "Zum Goldenen Lamm", "Uschis Woll-Lädchen"), über Fantasiebegriffe, Schlagwörter, Buchstaben- und Zeichenfolgen bis hin zu Kombinationen aus Namen und Branchenbegriffen ("Müller Marketing"; "Holz Schmeling"). Auch Domainnamen oder Logos können eine Geschäftsbezeichnung darstellen.
Achtung: Zwar genießt die Geschäftsbezeichnung einen eigenen Schutz, weitreichender und stärker ist jedoch die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke geschützt. Deshalb sollte der Inhaber einer schlagkräftigen Bezeichnung prüfen, ob für ihn eine Markeneintragung sinnvoll ist.
Folgen unzulässigen Verhaltens
Wer eine unzulässige Geschäftsbezeichnung führt oder seinen Briefbogen nicht korrekt gestaltet hat, dem drohen verschiedene Sanktionen. So kann der Inhaber eines älteren Zeichens, das mit der Geschäftsbezeichnung verwechselt werden kann, Unterlassung, gegebenenfalls sogar Schadensersatz, verlangen. Ist die Bezeichnung täuschungsgeeignet, kann der Gewerbetreibende aus wettbewerbsrechtlichen Gründen abgemahnt werden. Ordnungsgelder sind zu befürchten, wenn auf dem Briefbogen nicht die vollständigen Namen des oder der Gewerbetreibenden aufgeführt sind. Außerdem kann das Amtsgericht den Gebrauch einer firmenähnlichen Bezeichnung mit einem sogenannten Firmenmissbrauchsverfahren verbieten. Schließlich besteht die Gefahr, dass beim Eindruck einer kaufmännischen Firma das strengere Handelsrecht Anwendung findet, etwa im Hinblick auf die Haftung für die Schulden des Vorgängers.
Formen von Geschäftsbezeichnungen
Geschäftliche Bezeichnungen sind Namen, die der Inhaber zur Bezeichnung des Unternehmens, des Geschäfts oder seiner Produkte wählt, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Sie sollen also auffallend, einprägsam und werbewirksam sein. Die Ausprägung ist äußerst vielfältig. Sie reicht von den typischen Etablissementbezeichnungen, die in einigen Branchen üblich sind (zum Beispiel "Rathaus-Apotheke", "Zum Goldenen Lamm", "Uschis Woll-Lädchen"), über Fantasiebegriffe, Schlagwörter, Buchstaben- und Zeichenfolgen bis hin zu Kombinationen aus Namen und Branchenbegriffen ("Müller Marketing"; "Holz Schmeling"). Auch Domainnamen oder Logos können eine Geschäftsbezeichnung darstellen.
Achtung: Zwar genießt die Geschäftsbezeichnung einen eigenen Schutz, weitreichender und stärker ist jedoch die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke geschützt. Deshalb sollte der Inhaber einer schlagkräftigen Bezeichnung prüfen, ob für ihn eine Markeneintragung sinnvoll ist.
Folgen unzulässigen Verhaltens
Wer eine unzulässige Geschäftsbezeichnung führt oder seinen Briefbogen nicht korrekt gestaltet hat, dem drohen verschiedene Sanktionen. So kann der Inhaber eines älteren Zeichens, das mit der Geschäftsbezeichnung verwechselt werden kann, Unterlassung, gegebenenfalls sogar Schadensersatz, verlangen. Ist die Bezeichnung täuschungsgeeignet, kann der Gewerbetreibende aus wettbewerbsrechtlichen Gründen abgemahnt werden. Ordnungsgelder sind zu befürchten, wenn auf dem Briefbogen nicht die vollständigen Namen des oder der Gewerbetreibenden aufgeführt sind. Außerdem kann das Amtsgericht den Gebrauch einer firmenähnlichen Bezeichnung mit einem sogenannten Firmenmissbrauchsverfahren verbieten. Schließlich besteht die Gefahr, dass beim Eindruck einer kaufmännischen Firma das strengere Handelsrecht Anwendung findet, etwa im Hinblick auf die Haftung für die Schulden des Vorgängers.