Kündigung in Kleinbetrieben
Die Kündigung ist noch immer die häufigste Art, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. In unserem Artikel erfahren Sie, was bei einer Kündigung zu beachten ist. Den Fokus legen wir dabei auf Kleinbetriebe.
Das Wichtigste in Kürze: In Kleinbetrieben gilt der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz nicht. Das bedeutet, dass Sie als Arbeitgeber keinen der in § 1 KSchG niedergelegten Gründe betreffend die sozialen Kriterien berücksichtigen müssen. Kleinbetriebe sind dabei solche in denen in der Regel weniger als 10 Arbeitnehmende beschäftigt werden (§ 23 KSchG). Zwar ist eine Kündigung in Kleinbetrieben regelmäßig leichter durchzusetzen, allerdings sind auch hier einige Regelungen zu beachten. So darf die Kündigung nicht treuwidrig oder sittenwidrig sein und muss ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme erfüllen. Daneben gilt aber auch im Kleinbetrieb ein Sonderkündigungsschutz für Angestellte z.B. in der Ausbildung oder während der Schwangerschaft. Steht der ordentlichen Kündigung nichts im Weg, muss sich diese aber dennoch an die geltenden Kündigungsfristen und die weiteren Anforderungen an Form und Inhalt der Kündigung halten.
Kündigung und Kündigungsschutz
In Kleinbetrieben ist das Kündigungsschutzgesetz weitestgehend nicht anwendbar, mit der Folge, dass für eine Kündigung u.a. keine Gründe erforderlich sind, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder die durch dringende betriebliche Erfordernisse gerechtfertigt sind. Es ist daher wichtig zu ermitteln, ob das betroffene Unternehmen tatsächlich ein Kleinbetrieb ist.
| Entscheidend für die Feststellung des sog. betrieblichen Schwellenwertes, der darüber entscheidet, ob das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet oder nicht, ist die Anzahl der Arbeitnehmenden, die in der Regel im Betrieb beschäftigt werden. Das Kündigungsschutzgesetz ist nämlich nur dann anwendbar, wenn mehr als 10 Arbeitnehmenden regelmäßig beschäftigt werden (§ 23 KSchG). | Betrieblicher Schwellenwert > 10? |
| Auszubildende werden bei der Berechnung nicht mitgezählt. Teilzeitbeschäftigung wird bei nicht mehr als 20 Arbeitsstunden pro Woche mit einem Zählwert von 0,5, bei nicht mehr als 30 Arbeitsstunden pro Woche mit 0,75 berücksichtigt. | Vollzeit (VZ) = 1 Azubi = 0 TZ (<20h) = 0,5 TZ (<30h) = 0,75 |
|
Aber Achtung: Für bereits vor dem 01.01.2004 im Betrieb Beschäftigte gilt ein Bestandsschutz. Bei diesen Arbeitsverhältnissen bleibt der Kündigungsschutz erhalten, wenn in der Regel mehr als 5 „Alt-Arbeitnehmende“ beschäftigt werden. Dieser Kündigungsschutz bleibt so lange erhalten, wie mehr als fünf dieser „Alt-Arbeitnehmenden” im Betrieb verbleiben.
Für ab dem 01.01.2004 eingestellte Beschäftigte entsteht der Kündigungsschutz für diese eingestellten Arbeitnehmenden erst, wenn der Schwellenwert von 10 Arbeitnehmenden überschritten wird.
Bei der Abgrenzung von Alt-Arbeitnehmenden gegenüber denen, die der neueren Regelung zum Kündigungsschutz unterliegen, ist ausschlaggebend, wann der Arbeitnehmende seine Arbeit aufgenommen hat. Auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses kommt es also nicht an.
|
Arbeitsbeginn vor dem 01.01.2004 & mehr als 5 = Bestandsschutz |
| Im Betrieb eingesetzte Leiharbeitnehmende sind bei der Bestimmung der Betriebsgröße nach § 23 Abs. 1 S. 3 KSchG mitzuzählen, soweit mit ihnen ein regelmäßiger Beschäftigungsbedarf abgedeckt wird (BAG, Urt. v. 24.01.13 - 2 AZR 140/12). | Leiharbeit wird mitgezählt |
Ein Beispiel:
| Im Betrieb wurden vor dem 01.01.2004 6 Arbeitnehmende beschäftigt. Nach dem 01.01.2004 wurden 4 weitere Arbeitnehmende eingestellt, zwei davon sind jedoch teilzeitbeschäftigt mit jeweils 20 Arbeitsstunden pro Woche. Damit werden im Betrieb 8 Arbeitnehmende voll beschäftigt, 2 Arbeitnehmende teilzeitbeschäftigt. Da die Teilzeitbeschäftigten jeweils mit 0,5 berücksichtigt werden müssen, arbeiten im Betrieb nun also regelmäßig 9 Arbeitnehmende. |

6 x VZ, vor 2004 = 6
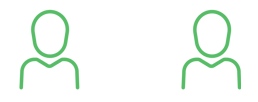
2 x VZ, nach 2004 = 2
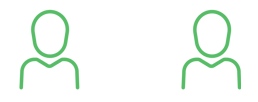
2 x TZ (20h), nach 2004 = 1
6 + 2 + 1= 9
|
| Kündigungsschutz genießen allerdings nur die 6 Alt-Arbeitnehmenden, denn für sie besteht ein Bestandsschutz. Die 4 Neu-Arbeitnehmenden hingegen unterliegen nicht dem Kündigungsschutz, denn der betriebliche Schwellenwert von mehr als 10 Arbeitnehmenden wurde nicht erreicht. |
:

6 x VZ, vor 2004 : Kündigungsschutz wegen Bestandsschutz

4 x VZ/TZ, nach 2004 : kein Kündigungsschutz, da < 10
|
| Später kündigt Alt-Arbeitnehmende A, Alt-Arbeitnehmende B geht in Rente und ein weiterer Arbeitnehmende N wird neu eingestellt. Durch das Ausscheiden der beiden Alt-Arbeitnehmenden A und B sinkt der Bestand der Alt-Arbeitnehmenden auf 4. Damit besteht auch für die anderen im Betrieb verbleibenden Alt-Arbeitnehmenden kein Kündigungsschutz mehr. Dass Arbeitnehmender N eingestellt wurde, um Alt-Arbeitnehmenden B zu ersetzen, ändert daran nichts. Er wurde nach dem 01.01.2004 eingestellt und genießt damit keinen Bestandsschutz. Insgesamt verbleiben 8 Arbeitnehmende im Betrieb, die alle keinen Kündigungsschutz (mehr) genießen. |

4 x VZ, vor 2004 = 4
→ Aufhebung Bestandsschutz, da weniger als 5

3 x VZ, nach 2004 = 3

2 x TZ (20h), nach 2004 = 1
4 + 3 + 1 = 8
Kein Kündigungsschutz für alle, da Beschäftigtenzahl < 10 und kein Bestandsschutz
|
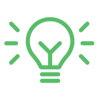
|
Tipp: Sie haben ermittelt, dass Ihr Betreib einen betrieblichen Schwellenwert größer als 10 hat? Dann lesen Sie weiter in unserem Artikel „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“. |
Gibt es Grenzen der Kündigung?
Grundsätzlich kann zwar ein Arbeitsverhältnis im Kleinbetrieb von beiden Seiten unter Beachtung der Kündigungsfristen jederzeit wirksam gekündigt werden. Es gibt jedoch Grenzen:
- Verbot treuwidriger Kündigung
Die Kündigung darf nicht auf willkürlichen oder sachfremden Motiven beruhen. Beispielsweise kann das bei Kündigungen, die in ehrverletzender Form oder für den Arbeitnehmenden zu einer sehr ungelegenen Zeit vorgenommen werden, der Fall sein. - Verbot diskriminierender Kündigung
Kündigungen, die einen Arbeitnehmenden wegen Geschlecht, Abstammung, ethnischer Herkunft oder Religion diskriminieren, sind unwirksam. Eine Einschränkung der Anwendbarkeit in Orientierung an der Betriebsgröße kennt das AGG nicht, so dass auch Arbeitnehmenden in Kleinbetrieben vollumfänglich vor diskriminierenden Kündigungen geschützt sind. - Verstoß gegen die guten Sitten
Die Kündigung darf nicht sittenwidrig sein. Beispielsweise sind verwerfliche Motive wie Rachsucht oder aber eine Kündigung wegen einer durch den Arbeitgeber selbst herbeigeführter Krankheit sittenwidrig. - „Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme”
Das Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme sorgt dafür, dass Kündigungen in Kleinbetrieben nicht völlig frei von jeglicher rechtlichen Kontrolle bleiben. Arbeitgeber müssen also auch in Kleinbetrieben gewisse soziale Mindeststandards beachten, um eine rechtmäßige Kündigung auszusprechen. Das fordert auch das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom 21.02.2001 - 2 AZR 15/00. Eine Kündigung eines erheblich schutzwürdigeren Arbeitnehmendens vor der eines weniger schutzwürdigeren Arbeitnehmenden ist ohne ein berechtigtes (betriebliches, persönliches oder sonstiges) Interesse nicht erlaubt. Beispielsweise ist die Kündigung eines 50-jährigen Familienvaters, der schon über 20 Jahre im Unternehmen arbeitet vor der Kündigung eines 30-jährigen Ledigen ohne ein berechtigtes Interesse (z. B. deutlich bessere Ausbildung und höherer Wissensstand des 30-jährigen) nicht zulässig. Allerdings kommt bei der Abwägung dieser Gründe der unternehmerischen Freiheit gegenüber der sozialen Rücksichtnahme ein erhebliches Gewicht zu. Praktisch bleibt damit die betriebsbedingte Kündigung auch schutzwürdigerer Arbeitnehmenden zulässig, so lange der Arbeitgeber ein sachbezogenes Motiv für die Auswahl gerade dieses Arbeitnehmenden anführen kann.
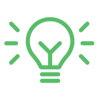
|
Unsere Empfehlung: Prüfen Sie aufgrund dieser Grundsätze immer, ob möglicherweise auch das Vorangehen einer Abmahnung erforderlich sein kann, selbst wenn sie nicht gesetzlich vorgegeben ist. |
Sonderkündigungsschutz auch in Kleinbetrieben beachten
Für bestimmte Arbeitnehmendengruppen gilt auch im Kleinbetrieb ein besonderer Kündigungsschutz. Zum Beispiel bei schwangeren Mitarbeiterinnen und Schwerbehinderten ist zunächst eine Genehmigung der zuständigen Behörde einzuholen. Ohne eine solche Genehmigung besteht ein absolutes Kündigungsverbot. Genehmigungen werden nur in besonderen Ausnahmefällen erteilt.
Außerdem sind Arbeitnehmenden, die zum Wehrdienst einberufen werden, durch einen Sonderkündigungsschutz abgesichert. Dieser Schutz verhindert, dass der Arbeitgeber während des Wehrdienstes kündigen kann, und sichert dem Arbeitnehmenden das Recht auf Rückkehr in den Betrieb nach Ende des Dienstes.
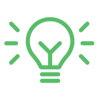
|
Tipp: Für Schwerbehinderte ist in Karlsruhe das Integrationsamt (Telefon 0721 8107-0) Ansprechpartner, für Schwangere die Fachgruppe Mutterschutz beim Regierungspräsidium Karlsruhe (Weitere Informationen, Telefon 0721 926-0). |
Sonderfall: Kündigung Auszubildender
Kündigungsfristen
Bestehen keine besonderen vertraglich oder tariflich festgesetzten Kündigungsfristen, greifen die gesetzlichen Kündigungsfristen des § 622 BGB für die ordentliche Kündigung.
Ordentliche Kündigung
Während einer vereinbarten Probezeit, die höchstens 6 Monate dauern darf, gilt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Nach Ablauf der Probezeit gilt dann eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende des Kalendermonats Diese Frist gilt sowohl für eine Kündigung durch den Arbeitnehmenden als auch durch den Arbeitgebenden.
Als Arbeitgeber müssen Sie darüber hinaus folgende Kündigungsfristen beachten:
Als Arbeitgeber müssen Sie darüber hinaus folgende Kündigungsfristen beachten:
| Betriebszugehörigkeit | Kündigungsgrund |
|---|---|
| 2 Jahre | 1 Monat zum Monatsende |
| 5 Jahre | 2 Monat zum Monatsende |
| 8 Jahre | 3 Monat zum Monatsende |
| 10 Jahre | 4 Monat zum Monatsende |
| 12 Jahre | 5 Monat zum Monatsende |
| 15 Jahre | 6 Monat zum Monatsende |
| 20 Jahre | 7 Monat zum Monatsende |
Außerordentliche/Fristlose Kündigung
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann auch im Kleinbetrieb außerordentlich, d.h. fristlos ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung gekündigt werden nach § 626 BGB).
Die Kündigung muss in solchen Fällen innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlangung der für die Kündigung maßgebenden Tatsachen erfolgen.

|
Beispiele die in der Regel eine fristlose Kündigung rechtfertigen können: Diebstahl, Arbeitszeitbetrug, Eigenmächtiger Urlaubsantritt, Körperliche Angriffe oder Bedrohungen, Schwerwiegende Beleidigungen, Geheimnisverrat. |
Form und der Kündigung
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und muss vom Kündigungsberechtigten selbst unterschrieben werden. Ein Fax, eine E-Mail oder Ähnliches genügen dem Schriftformerfordernis nicht (§ 623 BGB). Die Kündigung muss unmissverständlich sein und dem gekündigten Arbeitnehmenden die Möglichkeit bieten, dass er eindeutig ermitteln kann, zu welchem Termin das Arbeitsverhältnis beendet werden soll.
Eine Angabe der Gründe für die Kündigung ist nur bei Auszubildenden vorgesehen.
Bei der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund von sonstigen Arbeitnehmenden muss der Arbeitgeber dem Kündigenden den Kündigungsgrund auf dessen Verlangen allerdings unverzüglich schriftlich mitteilen (§ 626 BGB).
Bei der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund von sonstigen Arbeitnehmenden muss der Arbeitgeber dem Kündigenden den Kündigungsgrund auf dessen Verlangen allerdings unverzüglich schriftlich mitteilen (§ 626 BGB).
Hinweispflicht
Der Arbeitgeber hat außerdem die Pflicht, den betroffenen Mitarbeiter - spätestens zum Zeitpunkt der Kündigung - darauf hinzuweisen, dass er sich aktiv an der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz beteiligen und sich sofort bei der Bundesagentur für Arbeit melden muss. Der Arbeitnehmenden soll dazu freigestellt werden und die Möglichkeit erhalten, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen (§ 2 SGB III).
Die Meldung bei der Bundesagentur für Arbeit ist fällig, sobald der Beendigungszeitpunkt bekannt ist, also nach Erhalt der Kündigung. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen hat die Meldung bei der Agentur für Arbeit drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erfolgen, auch hier besteht die Hinweispflicht des Arbeitgebers.
Die Meldung bei der Bundesagentur für Arbeit ist fällig, sobald der Beendigungszeitpunkt bekannt ist, also nach Erhalt der Kündigung. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen hat die Meldung bei der Agentur für Arbeit drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erfolgen, auch hier besteht die Hinweispflicht des Arbeitgebers.
Meldet sich der Arbeitnehmenden später arbeitssuchend, droht ihm eine Sperre des Arbeitslosengeldes von bis zu 30 Tagen.
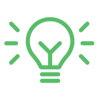
|
Tipp: Um Schadensersatzforderungen zu vermeiden, ist eine schriftliche Bestätigung seitens des Arbeitnehmenden, dass der Hinweispflicht genügt wurde, empfehlenswert. Eine Formulierungshilfe für die Hinweispflicht gibt die Bundesagentur für Arbeit. |
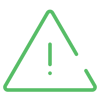
|
Achtung: Urlaubsanspruch bei Kündigung Sofern im Rahmen einer ordentlichen oder außerordentlichen ("fristlosen") Kündigung eine Freistellung des Arbeitnehmenden erfolgt, hat der Arbeitgeber ausdrücklich klarzustellen, ob die Freistellung unter Anrechnung auf den Urlaubsanspruch geschieht. Ansonsten bleiben trotz Kündigung die Urlaubsansprüche des Arbeitnehmenden bestehen und sind gegebenenfalls in Geld auszugleichen. |
Arbeitszeugnis
Der gekündigte Arbeitnehmende hat Anspruch auf die Erteilung eines Zeugnisses (§ 630 BGB). Mindestinhalt eines einfachen Zeugnisses sind:
- Name,
- Geburtsdatum und -ort (nur auf Wunsch des Arbeitnehmenden),
- Art und Dauer der Tätigkeit,
- Unternehmensbeschreibung
- Tätigkeitsbeschreibung,
d.h. Aufgaben mit beruflichem Werdegang.
Der Arbeitnehmenden kann jedoch auch ein qualifiziertes Zeugnis fordern, das sich auch auf eine ausführlichere Tätigkeitsbeschreibung (Fähigkeiten, Kompetenzen, besondere Arbeitserfolge), die Leistungen und die Führung erstreckt.
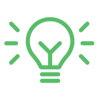
|
Tipp: Lesen Sie dazu unseren Artikel „Arbeitszeugnis“. |
Exkurs: Aufhebungsverträge und Abfindungen
Durch einen Aufhebungsvertrag enden die Pflichten der Parteien, die auf dem Arbeitsverhältnis beruhen. Voraussetzung dafür ist, dass sich beide Parteien auf eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses einigen. Es wird vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Termin aufgelöst wird. Im Gegenzug zahlt der Arbeitgeber eine Abfindung, über deren Höhe sich die Parteien einigen können. Dabei gilt, dass ein Aufhebungsvertrag ebenso wie eine Kündigung schriftlich erfolgen muss.
Eine Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmenden hätte dann keinen Erfolg.
Allerdings besteht bei einem Aufhebungsvertrag die Gefahr, dass für den Arbeitnehmenden eine Sperre für den Bezug des Arbeitslosengeldes entstehen kann. Die Sozialgerichte haben in mehreren Urteilen eine Sperre aber dann abgelehnt, wenn der Aufhebungsvertrag einer sogenannten betriebsbedingten Kündigung zuvorgekommen ist.
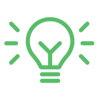
|
Tipp: Falls Sie doch eine Abfindung zahlen müssen oder wollen, lesen Sie auch unseren Artikel „Arbeitsrechtliche Abfindungen“. |
Exkurs: Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres mindestens 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, ist ihnen von ihrem Arbeitgeber aufgrund § 167 Abs. 2 Satz 1 SGB IX ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten.
Das BEM ist ein ergebnisoffenes Klärungsverfahren. Das Gesetz schreibt weder konkrete Maßnahmen noch einen bestimmten Verfahrensablauf vor.
Ziel des BEM ist es, Arbeitsunfähigkeit möglichst zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten zu erhalten.
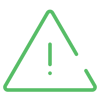
|
Achtung: An das BEM sollten Sie insbesondere bei einer krankheitsbedingten Kündigung – auch im Kleinbetrieb – denken. Verzichten Sie als Arbeitgeber vor Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung darauf, diese milderen Alternativen zu einer Kündigung zu identifizieren, liegt bei ihnen die Beweislast, dass auch bei Durchführung eines BEM das Arbeitsverhältnis nicht hätte erhalten werden können. Das bedeutet, dass Sie als Arbeitgeber, der vor der krankheitsbedingten Kündigung eines Arbeitnehmers kein BEM durchführt, einem erheblichen Risiko ausgesetzt ist, einen nachfolgenden Kündigungsschutzprozess zu verlieren. |
Trotz der fehlenden Anwendung des KSchG können Arbeitnehmer in einem Kleinbetrieb eine Kündigungsschutzklage einreichen. Eine solche Klage zielt dann darauf ab, die Wirksamkeit der Kündigung zu überprüfen.
Weiterführende Informationen:
IHK Karlsruhe: Betriebliches Eingliederungsmanagement -
Deutsche Rentenversicherung: Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
IHK Karlsruhe: Betriebliches Eingliederungsmanagement -
Deutsche Rentenversicherung: Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Stand: November 2024
Diese Ausführungen können nur erste Hinweise geben und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und erstellt wurden, geben sie die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung nur auszugsweise wieder und können eine individuelle Beratung durch einen Rechtsanwalt nicht ersetzen. Es kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.