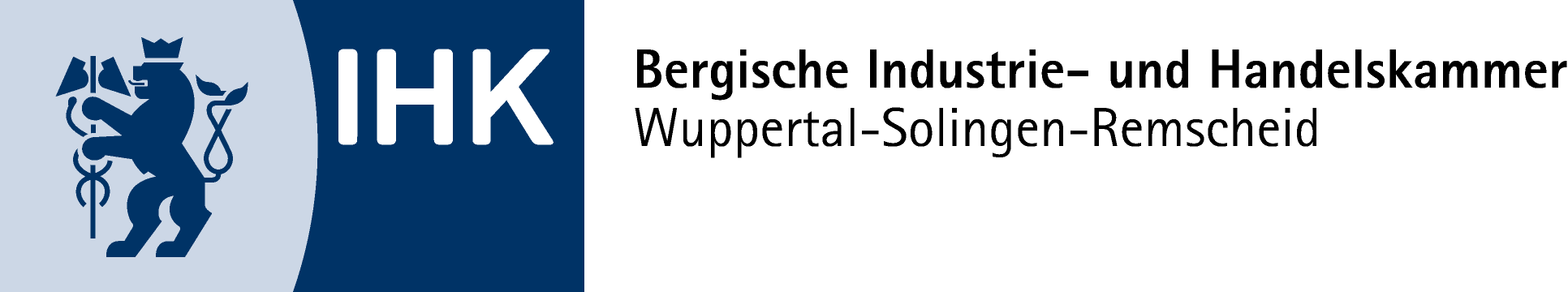LogistiKids 2025
Wir können alles kaufen – immer und an fast jedem Ort. Im Supermarkt ist das Obst immer frisch, und das per Mausklick bestellte Buch landet am nächsten Tag in unserem Briefkasten. All das ist für unsere Kinder selbstverständlich. Was jedoch alles dazugehört, damit Waren in den Handel oder direkt zu den Verbrauchern gelangen, ist selten bekannt.
Hier setzt der Ideenwettbewerb „LogistiKids 2025“ an. Er richtet sich an Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen und will Kinder auf spielerische Weise die Welt der Logistik näher bringen.
Bei den zu bearbeitenden Fragen wird zwischen Vorschulgruppen und Grundschulgruppen unterschieden. Die Fragestellungen lauten in diesem Jahr: „Wie kommt die Kiwi zu uns nach Hause?“ oder “Heute im Onlineshop bestellt, morgen da! Wie funktioniert das?" (E-Commerce)
Bei der Beantwortung der Fragen ist der Phantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt: malen, basteln, filmen, bauen – alles ist erlaubt!
Bei der Beantwortung der Fragen ist der Phantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt: malen, basteln, filmen, bauen – alles ist erlaubt!
Mitmachen können Vorschulkinder aus Kitas und Kindergärten im Alter von 5–6 Jahren und Grundschulkinder im Alter von 6–11 Jahren. Die Gruppen sollten aus mindestens fünf Kindern bestehen. Es können auch klassenübergreifende Projekte, z.B. aus der Ganztagsbetreuung, eingereicht werden. Die kreativsten und innovativsten Vorschläge werden abschließend von einer Expertenjury aus Unternehmensvertretern ausgewählt und prämiert.
Zu gewinnen gibt es:
1. Platz 1.000 €
2. Platz 700 €
3. Platz 500 €
4. Platz Sonderpreis (gestiftet von der Plattform Bargelink.com und der babymarkt.de GmbH)
2. Platz 700 €
3. Platz 500 €
4. Platz Sonderpreis (gestiftet von der Plattform Bargelink.com und der babymarkt.de GmbH)
Die Anmeldephase läuft noch bis zum 3. November 2025 für den landesweiten Wettbewerb. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Flyer unter “Weitere Informationen”. Der Wettbewerb findet bereits in diesem Jahr bereits zum 13. Mal statt. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kompetenznetz Logistik.NRW und der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen unter der Schirmherrschaft von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur.
Kreative LogistiKids: Kinder erklären die Logistikwelt.
Gruppenfoto im Rahmen der Preisverleihung der LogistiKids 2024 in der IHK zu Essen.
Gruppenfoto im Rahmen der Preisverleihung der LogistiKids 2024 in der IHK zu Essen.