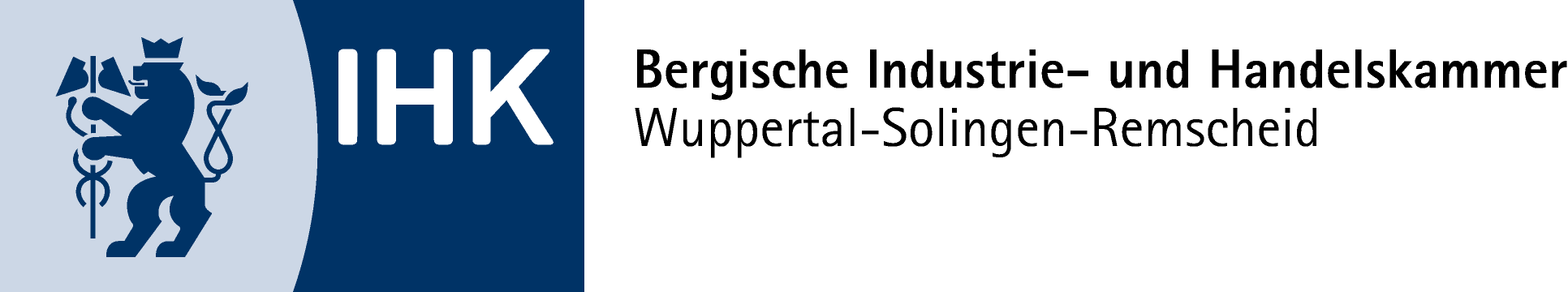Regionalplan Düsseldorf
Gemäß der entsprechenden Bekanntmachung vom 13.04.2018 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW ist der Regionalplan Düsseldorf (RPD) in Kraft getreten und löst damit für den Planungsraum Düsseldorf (Regierungsbezirk Düsseldorf ohne die zum RVR gehörigen Kommunen) den bisherigen Regionalplan (GEP99) ab.
Der Regionalplan (früher: Gebietsentwicklungsplan) ist Bindeglied zwischen Landesplanung und lokaler Bauleitplanung. Der Plan, der aus textlichen und zeichnerischen Darstellungen besteht, setzt Rahmenbedingungen unter anderem für die wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion. Er trifft beispielsweise Aussagen zu Gewerbe- und Industriestandorten, zu Binnenhafen-, Flughafen- und Kraftwerkstandorten sowie zu Abbaustätten für Kalk, Kies, Sand und Ton. Darüber hinaus legt er fest, in welchem Umfang und an welcher Stelle die Kommunen zukünftig neue Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete ausweisen können. Der neue Regionalplan stellt wichtige Weichen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region in den nächsten 20 Jahren.
Grundstückseigentümer sind von den Vorgaben des Regionalplans zunächst nicht direkt betroffen (der Plan entfaltet keine Drittwirkung). Der Plan richtet sich an Kommunen und Genehmigungsbehörden. Darstellungen werden in die Bauleitplanung übernommen, bestimmte Vorgaben müssen im Rahmen von Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden, beispielsweise bei Abgrabungsverfahren. In diesen Fällen können Unternehmen betroffen sein.
Von der Idee zum Planwerk
2010 startete die Bezirksplanungsbehörde Düsseldorf einen vier Jahre dauernden Diskussionsprozess mit allen wichtigen regionalen Akteuren, wie beispielsweise den Kommunen oder den Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammer Düsseldorf. Diskutiert wurde die inhaltliche Neuausrichtung des Regionalplans Düsseldorf, die Methode der Flächenbedarfsberechnung und der Detailierungsgrad des Umweltberichts.
Am 18. September 2014 fasste der Regionalrat den Erarbeitungsbeschluss. Danach wurde der Entwurf des Planwerks insgesamt drei Mal öffentlich ausgelegt und zwar vom 31. Oktober 2014 bis 31. März 2015, vom 1. August bis 7. Oktober 2016 und vom 4. August bis 4. Oktober 2017. Bürger, Unternehmen und weitere Akteure wie beispielsweise Industrie-und Handelskammern und die Handwerkskammer Düsseldorf konnten bei der Bezirksregierung eine Stellungnahme abgeben.
Am 14. Dezember 2017 wurde der Regionalplan Düsseldorf vom Regionalrat beschlossen. Danach wurde er drei Monate bei der Landesplanungsbehörde (Wirtschaftsministerium) angezeigt, bevor er rechtskräftig werden konnte.
Engagement der Kammern in der Planungsregion
Die Kammern hatten sich frühzeitig in den Diskussionsprozess um den neuen Regionalplan eingemischt:
Der Regionalplan (früher: Gebietsentwicklungsplan) ist Bindeglied zwischen Landesplanung und lokaler Bauleitplanung. Der Plan, der aus textlichen und zeichnerischen Darstellungen besteht, setzt Rahmenbedingungen unter anderem für die wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion. Er trifft beispielsweise Aussagen zu Gewerbe- und Industriestandorten, zu Binnenhafen-, Flughafen- und Kraftwerkstandorten sowie zu Abbaustätten für Kalk, Kies, Sand und Ton. Darüber hinaus legt er fest, in welchem Umfang und an welcher Stelle die Kommunen zukünftig neue Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete ausweisen können. Der neue Regionalplan stellt wichtige Weichen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region in den nächsten 20 Jahren.
Grundstückseigentümer sind von den Vorgaben des Regionalplans zunächst nicht direkt betroffen (der Plan entfaltet keine Drittwirkung). Der Plan richtet sich an Kommunen und Genehmigungsbehörden. Darstellungen werden in die Bauleitplanung übernommen, bestimmte Vorgaben müssen im Rahmen von Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden, beispielsweise bei Abgrabungsverfahren. In diesen Fällen können Unternehmen betroffen sein.
Von der Idee zum Planwerk
2010 startete die Bezirksplanungsbehörde Düsseldorf einen vier Jahre dauernden Diskussionsprozess mit allen wichtigen regionalen Akteuren, wie beispielsweise den Kommunen oder den Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammer Düsseldorf. Diskutiert wurde die inhaltliche Neuausrichtung des Regionalplans Düsseldorf, die Methode der Flächenbedarfsberechnung und der Detailierungsgrad des Umweltberichts.
Am 18. September 2014 fasste der Regionalrat den Erarbeitungsbeschluss. Danach wurde der Entwurf des Planwerks insgesamt drei Mal öffentlich ausgelegt und zwar vom 31. Oktober 2014 bis 31. März 2015, vom 1. August bis 7. Oktober 2016 und vom 4. August bis 4. Oktober 2017. Bürger, Unternehmen und weitere Akteure wie beispielsweise Industrie-und Handelskammern und die Handwerkskammer Düsseldorf konnten bei der Bezirksregierung eine Stellungnahme abgeben.
Am 14. Dezember 2017 wurde der Regionalplan Düsseldorf vom Regionalrat beschlossen. Danach wurde er drei Monate bei der Landesplanungsbehörde (Wirtschaftsministerium) angezeigt, bevor er rechtskräftig werden konnte.
Engagement der Kammern in der Planungsregion
Die Kammern hatten sich frühzeitig in den Diskussionsprozess um den neuen Regionalplan eingemischt:
| August 2011 | Fachbeitrag der Wirtschaft zum Regionalplan |
| März 2012 | Regionales Gewerbeflächenkonzept Bergisches Städtedreieck |
| Februar 2015 | Stellungnahme zum ersten Entwurf des Regionalplans |
| Oktober 2016 | Stellungnahme zum zweiten Entwurf des Regionalplans |
Was für die Wirtschaft erreicht wurde
In den Regionalplan sind viele Hinweise der Kammern aus dem Fachbeitrag der Wirtschaft eingeflossen, insbesondere die textlichen Vorgaben zum Schutz von Gewerbe- und Industriegebieten (GIB) vor heranrückender Wohnbebauung. Des Weiteren wurde auf Initiative der Kammern mit Blick auf die zeichnerischen Darstellungen auch eine neue Gebietskategorie (ASB-GE) eingeführt, die beispielsweise als Pufferzone zwischen Gewerbe- und Industriegebieten und Wohngebieten dienen kann. Hier darf genauso wie in einem GIB nicht gewohnt werden. Auf der Basis des Regionalen Gewerbeflächenkonzeptes Bergisches Städtedreieck haben die Kommunen neue Gewerbeflächen erhalten. Dennoch sind die Möglichkeiten der Siedlungsflächenentwicklung bei den Kommunen des Bergischen Städtedreiecks nahezu ausgeschöpft. Die Kommunen des Bergischen Städtedreiecks werden nach aktuellen Erkenntnissen (Siedlungsflächenmonitoring 2023) nicht in der Lage sein, den rechnerischen Bedarf an Gewerbeflächen in den eigenen Stadtgebieten zu decken. Diese Tatsache wurde durch die Einrichtung eines sogenannten Flächenbedarfskontos berücksichtigt.