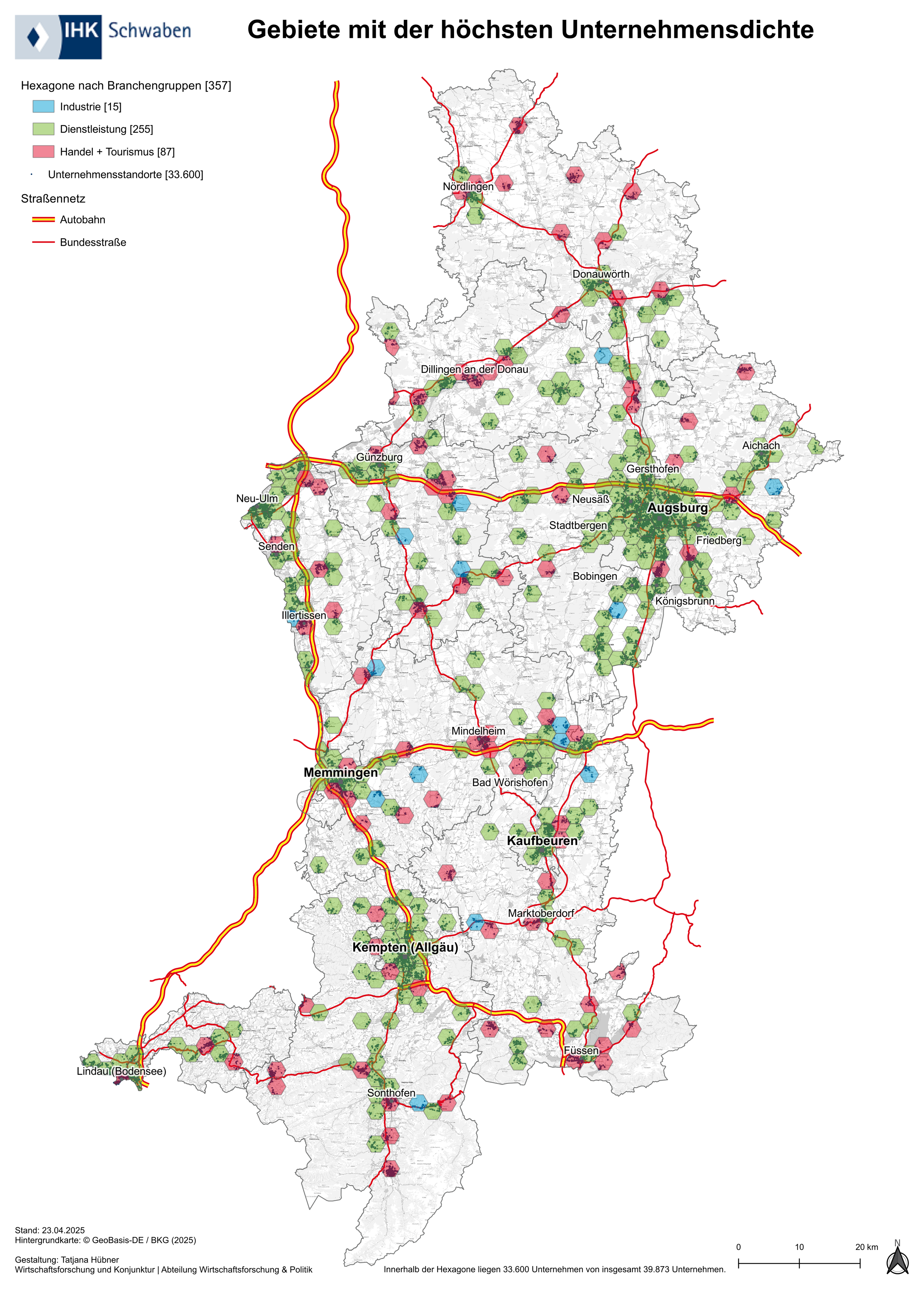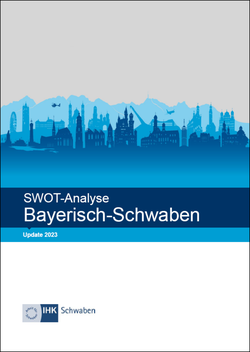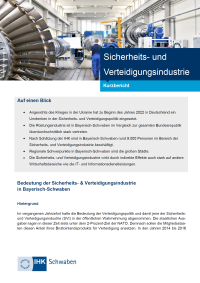Arbeitsvolumen in Deutschland
- Zulassung der Arbeitnehmerüberlassung für die Fachkräftegewinnung aus Drittstaaten,
- sofortige Abschaffung des abschlagsfreien vorzeitigen Renteneintritts für besonders langjährig Versicherte,
- Einschränkung des Zeitraums für den vorzeitigen Renteneintritt für langjährig Versicherte bei gleichzeitiger Erhöhung der Abschläge,
- Wiedereinführung der Hinzuverdienstgrenze spätestens nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Evaluierungsfrist 2027,
- sofortige Streichung eines gesetzlichen Feiertags,
- Verzicht auf zusätzliche familien- und sozialpolitisch motivierte Maßnahmen, mit denen eine zunächst temporäre Freistellung von Arbeit subventioniert oder gefördert wird (z. B. Ausweitung des Elterngelds, Einführung einer Lohnersatzleistung im Zusammenhang mit der Pflege von Angehörigen).
- die Dynamisierung des Rentenzugangsalters in Abhängigkeit einer steigenden Lebenserwartung und damit einer im Trend steigenden Rentenbezugsdauer,
- der weitere Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur, mit dem Teilzeitbeschäftigte mit Betreuungsverpflichtungen in die Lage versetzt werden, ihr individuelles Arbeitsangebot zu steigern, wenn sie dies wünschen,
- die Beseitigung von Anreizfallen im Steuer- und Transfersystem in Kombination mit einer Entlastung bei Steuern und Sozialabgaben.