Cookie-Hinweis
Wir setzen etracker, einen Analysedienst der etracker GmbH ein.
Weitere Informationen entnehmen Sie hierzu bitte der Datenschutzerklärung.
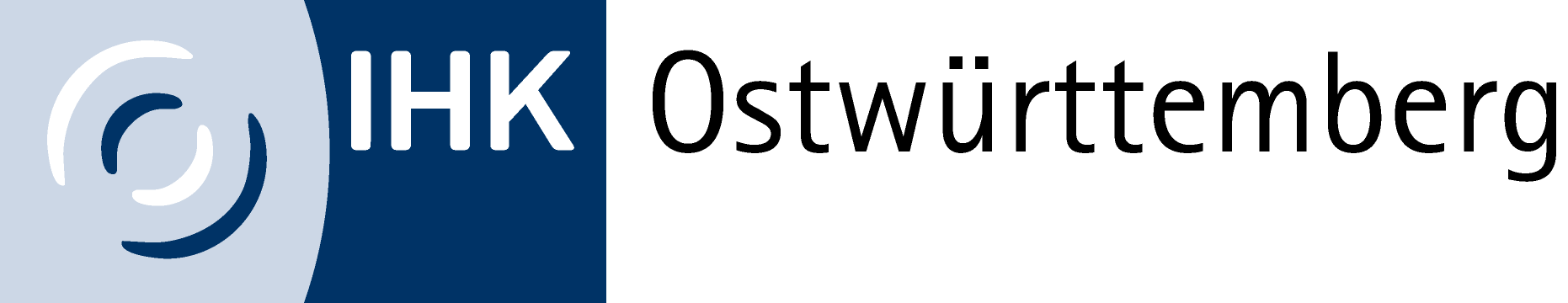
Sie befinden sich auf der Seite der IHK Ostwürttemberg. Möchten Sie diese Seite in einem Cookie als Ihre Heimat-IHK setzen?
Sie befinden sich auf der Seite der IHK Ostwürttemberg. Bisher ist die als Ihre Heimat-IHK hinterlegt. Wollen Sie die Seite der IHK Ostwürttemberg in einem Cookie als Ihre neue Heimat-IHK setzen?
Sie werden zum Angebot der weitergeleitet.
Zollinformationen
Zoll-Portal, EU-Trader-Portal, Newsletter Zoll
1. Bürger- und Geschäftskundenportal (deutsches Zoll-Portal)
Das Bürger- und Geschäftskundenportal des Zolls wird zu einem umfassenden Zoll-Portal ausgebaut. Damit werden auch Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes umgesetzt.
Bislang waren wesentlichen Funktionen für Unternehmen:
- Beantragung und Verwaltung der EORI
- Beantragung Verbindlicher Zolltarifauskünfte (vZTA)
- Kfz-Steuer
- Meldeportal Mindestlohn
- Zoll-Auktion
Aktuell sind bereits eine Vielzahl weiterer Funktionen verfügbar. Dazu gehören:
- Verbrauchsteuern/EMCS: weitere Steuerarten, generell Bewilligungen, Meldungen und Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren
- AEO/Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
- Warenursprung und Präferenzen: Beantragung Ermächtigter Ausführer, REX, buchmäßige Trennung
- Verlagerung der Buchführung
- Stundung, Vollstreckungsaufschub, Erstattung/Erlass aus Billigkeitsgründen
- Antrag auf kostenpflichtige Amtshandlung (u.a. Gestellung außerhalb des Amtsplatzes)
- Bestellung steuerlicher Beauftragter
- Zugang zum EU-Traderportal (u.a. für Bewilligungen, die in mehreren Mitgliedsstaaten gelten und hilfsweise für CBAM)
Sämtliche zollrechtliche Bewilligungen sowie die Teilnahme und Zertifizierung für ATLAS und EMCS kann (bald) über das Bürger- und Geschäftskundenportal (Zoll-Portal) beantragt werden.
Zugang: Unternehmenskonto, Elsterzertifikat und/oder Zoll-Ident-App
Erforderlich ist ein Unternehmenskonto sowie ein Elster-Zertifikat. Je nach Unternehmensgröße benötigen mehrere Mitarbeitende einen Zugang. Es können unterschiedliche Berechtigungen für die einzelnen Mitarbeitenden festgelegt werden. Die Ausstellung und Zuteilung unterschiedlicher Elster-Zertifikate ist relativ aufwändig und unbeliebt. Dieses Problem löst die Zollverwaltung mit der seit Mai 2024 verfügbaren Zoll-Ident-App. Damit benötigt nur noch der Hauptbenutzer im Unternehmen ein Elster-Zertifikat. Für die weiteren Nutzer können individuelle Nutzer-Codes generiert werden, die Nutzer erhalten damit dann einen Zugang zum Zoll-Portal. Die Zoll-Ident-App ist in den jeweiligen App-Stores (App Shop bzw. App Store) enthalten.
Auch die Anmeldung über den Personalausweis ist möglich, dies ist vermutlich eher für Privatpersonen geeignet. Die bisherige Papier-Antragstellung bleibt möglich, die Abwicklung über das Zoll-Portal dürfte aber im Vergleich deutlich schneller sein.
2. EU-Trader-Portal: für mitgliedsstaatenübergreifende Bewilligungen
Über das EU-Traderportal werden Bewilligungen beantragt, die in mehreren EU-Mitgliedsstaaten gelten. Neben einigen sehr speziellen Bewilligungen ist das insbesondere die Zentrale Zollabwicklung. Weitere Bewilligungen werden hinzukommen, zunächst die des “zugelassenen Ausstellers (ACP)”: Diese neue Bewilligung dient der künftigen elektronischen Ausstellung von T2L/F-Statusnachweisen. Diese sind für Sendungen in steuerliche Sondergebiete innerhalb der EU erforderlich beispielsweise für die Kanarischen Inseln.
In der ATLAS Info 0416/23 werden die Einzelheiten zum EU-Traderportal geschildert. Für den Zugang zum EU-Traderportal ist zunächst ein Zugang zum deutschen Zoll-Portal (Bürger- und Geschäftskundenportal) erforderlich. Dieser erfolgt über die Dienstleistung „EU-Trader-Portal und Identitätsmanagement“ im Zoll-Portal (siehe 1.)
3. Newsletter-Angebot des Zolls
Der Zoll bietet auch einen Newsletter-Service für zahlreiche Themengebiete an. Anmeldung und Konfiguration auf der Seite des Zolls.
Quelle: IHK Region Stuttgart
EORI-Nummer
Für Zollanmeldungen ist Registrierung beim Zoll erforderlich
Stand: Juli 2024
- 1. Was ist EORI?
- 2. Wer braucht eine EORI-Nummer?
- 3. Wie sieht die EORI-Nummer aus?
- 4. Wann ist die EORI-Nummer anzugeben?
- 5. Wie erhalte ich eine EORI-Nummer?
- 6. Wie kann ich überprüfen, ob ich eine (gültige) EORI-Nummer habe?
- 7. Wo finde ich weitere Details, auch über die Nutzung ausländischer EORI-Nummern?
1. Was ist EORI?
EORI (Economic Operators' Registration and Identification System) ist ein EU-weites System zur eindeutigen Registrierung und Identifizierung von Unternehmen und Privatpersonen gegenüber der Zollverwaltung. Diese erfolgt mithilfe einer individuell zugeteilten EORI-Nummer, die EU-weit gültig ist.
2. Wer braucht eine EORI-Nummer?
Unternehmen und Privatpersonen, die Ausfuhren oder Einfuhren beim Zoll anmelden, benötigen eine EORI-Nummer. Auch für die Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine EORI erforderlich. Die Pflicht zur Angabe der EORI-Nummer besteht bereits ab dem ersten Export- oder Importvorgang. Sowohl das elektronische Zollsystem ATLAS Ausfuhr als auch die Internetzollanmeldung Plus (IAA Plus) funktionieren nur mit gültiger EORI-Nummer. Unternehmen, die noch keine EORI-Nummer haben, können den Antrag auf Registrierung und Erteilung während der Abwicklung ihres ersten Vorgangs stellen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Anmeldung über einen Dienstleister erfolgt.
Nach den EU-rechtlichen Vorschriften dürfen nur rechtsfähige Einheiten, also natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personenvereinigungen eine EORI-Nummer erhalten. Nicht rechtsfähige Unternehmenseinheiten (Zweigniederlassungen, Betriebsstätten) werden in Deutschland über die EORI-Nummer ihres Hauptsitzes und eine vierstellige Niederlassungsnummer identifiziert.
3. Wie sieht die EORI-Nummer aus?
In allen EU-Staaten wird das jeweilige Länderkürzel vorangestellt, in Deutschland also DE. Danach folgt eine 15-stellige Nummernkombination, also beispielsweise DE000000001234567.
4. Wann ist die EORI-Nummer anzugeben?
Die EORI-Nummer ist bei Zollanmeldungen, also zum Beispiel bei Ausfuhr- und Einfuhrmeldungen, erforderlich (Ausführer beim Export; Empfänger beim Import). Dies gilt auch bei Anträgen auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung beim BAFA.
5. Wie erhalte ich eine EORI-Nummer?
Die EORI-Nummer erhalten Sie auf Antrag beim deutschen Zoll. Die Registrierung ist kostenlos und erfolgt elektronisch oder über ein Antragsformular.
Elektronischer Antrag
Sie können die EORI-Nummer elektronisch über das Zollportal beantragen. Hierfür benötigen Sie lediglich ein gültiges ELSTER-Zertifikat. Änderungen von Stammdaten erfolgen auch auf diesem Weg.
Schriftlicher Antrag
Alternativ können Sie die EORI-Nummer über ein Formular schriftlich bei der Generalzolldirektion, Dienstort Dresden, Stammdatenmanagement beantragen. Die Antragsformulare 0870a (Unternehmen) 0870b (Niederlassungsnummer und 0870c (Privatpersonen) sowie Informationen zum Verfahren finden Sie auf der Internetseite des deutschen Zolls. Bei Änderungen (Firmierung, Adresse, Rechtsform o.ä.) müssen Sie die Stammdaten aktualisieren.
6. Wie kann ich überprüfen, ob ich eine (gültige) EORI-Nummer habe?
Neu erteilte EORI-Nummer und die Stammdaten der Wirtschaftsbeteiligten werden in einer zentralen EU-Datenbank hinterlegt. Dies kann nur nach schriftlicher Einwilligung der Nummerninhaber erfolgen. Unternehmen, die sich nicht sicher sind, ob sie registriert sind, können dies entweder über die Zollverwaltung klären (info.eori@zoll.de). Alternativ kann die Abfrage direkt über die Datenbank der EU erfolgen.
7. Wo finde ich weitere Details, auch über die Nutzung ausländischer EORI-Nummern?
- Die deutsche Zollverwaltung informiert im Themenbereich EORI ausführlich zur EORI-Nummer.
- Einzelheiten zur Einführung der EORI-Nummer sind in der EG-Verordnung 312/2009 vom 16. April 2009 veröffentlicht.
- Ausführliche Informationen hat die EU-Kommission in den EORI-Leitlinien veröffentlicht.
Quelle: IHK Region Stuttgart
VEREINFACHTE ZOLLVERFAHREN
Diese neue Definition der Ausfuhrsendung ist praxisnah und gut zu handhaben. Sie ermöglicht es Unternehmen, häufiger als bisher von der sogenannten Kleinsendungsregelung Gebrauch zu machen.
Zu beachten ist, dass eine Aufteilung einer Gesamtsendung mit einem Wert von über 1.000 Euro in mehrere Einzelsendungen nicht zu einer Befreiung von der elektronischen Ausfuhranmeldung führt. Es ist in diesem Fall für jede einzelne Sendung eine Ausfuhranmeldung zu erstellen.
Bislang wurde der Begriff der Ausfuhrsendung entsprechend der Definition des § 2 Nr. 4 Außenwirtschaftsgesetz ausgelegt. Demnach umfasste eine Ausfuhrsendung die Waren, die ein Ausführer gleichzeitig über dieselbe Ausgangszollstelle nach demselben Bestimmungsland ausführt. Maßgeblich war also das Zielland und nicht der Empfänger. Das hat in der Praxis dazu geführt, dass Sendungen in ein Zielland aber an unterschiedliche Empfänger zusammengeführt werden mussten und nachträglich elektronische Ausfuhranmeldungen verlangt worden sind, obwohl der Wert jeder einzelnen Sendung unter 1.000 Euro lag. Die dadurch entstandenen Verzögerungen dürften nun der Vergangenheit angehören.
Zollabwicklung bei Kleinsendungen unter 1000 Euro
Stand: Juli 2024
Für Ausfuhrsendungen mit einem Warenwert bis 1.000 Euro müssen Exporteure keine elektronische Ausfuhranmeldung abgeben. Voraussetzung ist dass
- das Gewicht der Sendung 1.000 kg nicht übersteigt und
- für die Ware keine besonderen Genehmigungen erforderlich sind und
- nicht in bestimmte Embargoländer geliefert wird
- keine Ausfuhrerstattung beantragt werden soll.
Die neue Dienstvorschrift des Zolls zum Ausfuhrverfahren (VSF A 0610) definiert die Ausfuhrsendung neu auf Basis des Empfängers:
„Ausfuhrsendung umfasst die Waren, die ein Ausführer auf Grundlage eines Ausfuhrvertrags an einen Empfänger ausführt.“
Diese neue Definition der Ausfuhrsendung ist praxisnah und gut zu handhaben. Sie ermöglicht es Unternehmen, häufiger als bisher von der sogenannten Kleinsendungsregelung Gebrauch zu machen.
Zu beachten ist, dass eine Aufteilung einer Gesamtsendung mit einem Wert von über 1.000 Euro in mehrere Einzelsendungen nicht zu einer Befreiung von der elektronischen Ausfuhranmeldung führt. Es ist in diesem Fall für jede einzelne Sendung eine Ausfuhranmeldung zu erstellen.
Bislang wurde der Begriff der Ausfuhrsendung entsprechend der Definition des § 2 Nr. 4 Außenwirtschaftsgesetz ausgelegt. Demnach umfasste eine Ausfuhrsendung die Waren, die ein Ausführer gleichzeitig über dieselbe Ausgangszollstelle nach demselben Bestimmungsland ausführt. Maßgeblich war also das Zielland und nicht der Empfänger. Das hat in der Praxis dazu geführt, dass Sendungen in ein Zielland aber an unterschiedliche Empfänger zusammengeführt werden mussten und nachträglich elektronische Ausfuhranmeldungen verlangt worden sind, obwohl der Wert jeder einzelnen Sendung unter 1.000 Euro lag. Die dadurch entstandenen Verzögerungen dürften nun der Vergangenheit angehören.
Unionszollkodex
Zollkodex der Europäischen Union (UZK)
Stand: Dezember 2023
Der Zollkodex der Union, auch kurz Unionszollkodex (UZK) genannt, bildet zusammen mit der Delegierten Verordnung (DA - Delegated Act) und der Durchführungsverordnung (IA - Implementing Act) das Europäische Zollrecht. Ergänzt werden diese Rechtsakte durch eine Übergangsverordnung (TDA - Transitional Delegated Act), die einen rechtlichen Rahmen bis zur Inbetriebnahme und Anpassung der IT-Systeme an die neuen Regelungen schafft.
Mit Wirkung zum 01. Mai 2016 ersetzte der UZK den bis dahin geltenden Zollkodex (ZK) und die Zollkodex-Durchführungsverordnung (ZK-DVO).
Die aktuell gültigen Rechtsakte sind in allen Amtssprachen der Europäischen Union in verschiedenen Dateiformaten (PDF, HTML) online auf der Internetseite der Europäischen Kommission abrufbar, ebenso wie die aktuellen, konsolidierten Versionen:
- UZK - Unionszollkodex (Verordnung (EU) Nr. 952/2013 vom 09. Oktober 2013)
- DA - Delegierte Verordnung ((EU) Nr. 2015/2446 vom 28. Juli 2015)
- IA - Durchführungsverordnung ((EU) Nr. 2015/2447 vom 24. November 2015)
- TDA - Delegierte Verordnung mit Übergangsbestimmungen "TDA" ((EU) 2016/341 vom 17. Dezember 2015)
nützliche Hinweise:
- die Wortlaute der Lieferantenerklärungen finden sich im Anhang zur Durchführungsverordnung (S. 838 ff.)
- wesentliche Be- und Verarbeitungsprozesse, die einen nichtpräferenziellen Ursprung (-> Ursprungszeugnis) verleihen, finden sich im Anhang zur Delegierten Verordnung (S. 279 ff.)
"Bagatellgrenze"
Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhren im Reiseverkehr
Stand: März 2024
Unter bestimmten Voraussetzungen können Verkäufe im Einzelhandel an Privatpersonen mit Wohnsitz in einem Drittland (= außerhalb der EU) steuerfrei abgerechnet werden. Man spricht von einem “Export über den Ladentisch”. Eine Erstattung der Steuer an den Käufer durch die Finanzbehörden ist nicht möglich.
Die Steuerbefreiung wird dem Unternehmer gewährt, wenn
• der Käufer im Drittlandsgebiet ansässig ist,
• die Waren innerhalb von drei Monaten nach Kauf in das Drittlandsgebiet gelangen und
• der Gesamtwert der Lieferung einschließlich Umsatzsteuer 50 Euro übersteigt.
• der Käufer im Drittlandsgebiet ansässig ist,
• die Waren innerhalb von drei Monaten nach Kauf in das Drittlandsgebiet gelangen und
• der Gesamtwert der Lieferung einschließlich Umsatzsteuer 50 Euro übersteigt.
Die Wertgrenze von 50 EUR soll zum Ende des Jahres wieder entfallen, in dem das in Vorbereitung befindliche IT-Verfahren zur automatisierten Erteilung der Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen in Deutschland in den Echtbetrieb geht. Es gibt jedoch noch keine Hinweise darauf, wann dies der Fall sein wird.
Das Bundesfinanzministerium hat ein Merkblatt zur steuerfreien Ausfuhr im Reiseverkehr samt dem als Nachweisformular empfohlenen „Ausfuhrkassenzettel“ veröffentlicht.
Quelle: IHK Südlicher Oberrhein
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO)
Der AEO: Grundlagen, Voraussetzungen, Nutzen
Stand: Juli 2024
1. Worum geht es beim Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO)?
Ein Unternehmen, das den Status AEO (Authorized Economic Operator) besitzt, gilt als besonders zuverlässig und vertrauenswürdig und kann dafür Vergünstigungen bei der Zollabfertigung in Anspruch nehmen. Unternehmen, die in der Europäischen Union ansässig und am Zollgeschehen beteiligt sind, können diesen Status bei ihrem zuständigen Hauptzollamt beantragen. Ambitioniertes Ziel ist die Absicherung der durchgängigen internationalen Lieferkette („supply chain“) vom Hersteller einer Ware bis zum Endverbraucher gegen terroristische Anschläge. Die deutsche Zollverwaltung informiert auf ihrer Website ausführlich zum Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten oder Authorised Economic Operator.
2. Gegenseitige Anerkennung
Derzeit laufen Verhandlungen mit Drittländern, die zu einer weltweiten Anerkennung des Status führen sollen. Die gegenseitige Anerkennung besteht mit folgenden Ländern:
- Schweiz
- Norwegen
- Japan
- USA
- VR China
- Vereinigtes Königreich
- Republik Moldau
In diesen bilateralen Warenverkehren sollte durch die gegenseitige Anerkennung eine Beschleunigung der Zollabfertigung erreicht werden.
3. Gültigkeit und Varianten
Die Bewilligung eines AEO ist in allen EU-Mitgliedstaaten gültig und zeitlich nicht befristet.
Den AEO gibt es in folgenden Varianten:
- AEO-Zertifikat „Zollrechtliche Vereinfachungen/Customs“ (AEO C). Die Bedingungen für diese Variante gelten auch für die Inhaber vereinfachter Zollverfahren.
- AEO-Zertifikat „Sicherheit/Security“ (AEO S)
- AEO-Zertifikat „Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit“ (AEO C/S), früher AEO F.
4. Voraussetzungen
Die Voraussetzungen, die ein AEO erfüllen muss, hängen vom gewünschten Zertifikat und von den konkreten Umständen im Unternehmen ab. Es geht im Wesentlichen um folgendes:
- Bislang angemessene Einhaltung der Zoll- und Steuervorschriften (Artikel 39 a UZK),
- Zufriedenstellendes System für die Verwaltung der Geschäfts- und Beförderungsunterlagen, das geeignete Zollkontrollen ermöglicht (Artikel 39 b UZK),
- Nachgewiesene Zahlungsfähigkeit (Artikel 39 c UZK),
- Praktische oder berufliche Befähigungen (Artikel 39 d UZK) sowie
- Geeignete Sicherheitsstandards (Artikel 39 e UZK)- nur von AEO S zu erfüllen).
Punkt 1 bedeutet, dass es weder durch das Unternehmen noch durch verantwortliche Mitarbeiter in der Vergangenheit schwere Verstöße gegen das Zoll- oder Steuerrecht im Rahmen der Wirtschaftstätigkeit – also nicht im privaten Umfeld – gegeben haben darf. Nur für verantwortliche Personen des Unternehmens bzw. Personen, die für die Zollangelegenheiten (leitend) zuständig sind, kann der Zoll deren Steueridentifikationsnummer anfordern (EuGH-Urteil Rechtssache C-496 in 1/2019). Punkt 4 gilt als erfüllt, wenn mindestens ein/e Mitarbeiter/in im Unternehmen über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung in der Zollabwicklung verfügt.
Beim AEO S und AEO C/S muss das Personal in sicherheitsrelevanten Bereichen gegen die Antiterrorlisten der EU gescreent werden. Diese Vorschrift wurde vom Bundesfinanzhof in einem Urteil vom Juli 2012 bestätigt.
Beim AEO S und AEO C/S muss das Personal in sicherheitsrelevanten Bereichen gegen die Antiterrorlisten der EU gescreent werden. Diese Vorschrift wurde vom Bundesfinanzhof in einem Urteil vom Juli 2012 bestätigt.
5. Bewilligungspraxis/Fragebogen zur Selbstbewertung
Das Antragsverfahren beinhaltet unter anderem eine Selbsteinschätzung des Unternehmens. Dies ist das zentrale Dokument für die Bewilligung. Die Antragstellung erfolgt über den Internetantrag AEO (IAEO) im Zoll-Portal. Informationen zum Verfahren und den Zugang zum Fragebogen zur Selbstbewertung finden Sie auf der Internetseite der Zollverwaltung. Von zentraler Bedeutung für einen AEO ist die Installation eines Internen Kontrollsystems (IKS). Dies beinhaltet alle zollrelevanten Abläufe und vor allem den Umgang mit Fehlern. Weitere Informationen finden sich in den Leitlinien der EU zum AEO.
6. Welche Vorteile ergeben sich für den AEO aus dem Unionszollkodex (UZK)
Generelle Vorteile für den AEO sind seltenere Zollkontrollen sowie die grundsätzliche Möglichkeit, den Ort der Zollkontrollen zu bestimmen.
Weiterhin gelten für vereinfachte Verfahren im wesentlichen dieselben Voraussetzungen wie für den AEO C, damit wird eine Antragstellung für vereinfachte Verfahren leichter. Zwingend ist der AEO C dafür aber nicht.
Weitere Erleichterungen werden AEO eingeräumt, beispielsweise müssen bei der Beendigung offener Ausfuhrverfahren (Follow-up) keine Belege beim Ausfuhrzollamt vorgelegt werden.
Seit der Anwendbarkeit des UZK ist die Bewilligung als AEO C eine Voraussetzung für einige Verfahrenserleichterungen. Dies sind:
- Anschreibung in der Buchführung mit Gestellungsbefreiung (Einfuhr)
- Zentrale Zollabwicklung
- Eigenkontrolle
- Bewilligung einer Gesamtsicherheit für eine entstandene Zollschuld mit verringertem Betrag
Die Punkte 2 und 3 haben noch keine praktische Relevanz, der Punkt 4 hingegen kann sehr wesentlich sein, weil durch das EU-Zollrecht seit 2016 wesentlich häufiger Sicherheiten verlangt werden.
7. Fazit
- Der AEO hat sich einigermaßen etabliert, auch wenn die Vorteile nach Einschätzung von Unternehmen kaum spürbar sind.
- Viele Verfahrenserleichterungen sind ohne AEO-Bewilligung problemlos möglich.
- Eine Überlegung wert ist der AEO C wegen der Reduktion von Sicherheiten. Falls Sie zusätzliche Sicherheitsleistungen erbringen müssen, bietet sich der AEO C an.
- Der AEO-Status und die Zertifizierung zum Bekannten Versender (Luftfrachtsicherheit) laufen nicht mehr vollkommen unabhängig voneinander (Verordnung (EU) 687/2014)
- Im Rahmen von Vertragsverhandlungen zwischen Kunde und Lieferant kann der AEO ein ähnliches Thema sein wie dies beispielsweise die ISO-Zertifizierung von einigen Jahren war. Um einen Schneeballeffekt zu verhindern, besteht die Möglichkeit, dass Lieferanten ihren Kunden, die über den AEO-Status verfügen, die Einhaltung von Sicherheitsstandards mit einer Sicherheitserklärung zusichern. Damit müssen sie selbst nicht AEO werden. Hinweise zur Sicherheitserklärung gibt die Zollverwaltung auf ihrer Website.
Quelle: IHK Region Stuttgart
Dokumente
Aufbewahrungsfrist Zollpapier
Stand: Mai 2024
Die Frage nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist und der Aufbewahrungsform für Außenhandelsdokumente wird häufig gestellt, deswegen haben wir diese Informationen zusammengefasst.
1. Was sind Zolldokumente?
Zu den Zolldokumenten gehören neben den im Regelfall elektronischen Zollanmeldungen auch alle Unterlagen, die einer Zollanmeldung nach Art. 162 und Art. 163 UZK beizufügen sind, sofern die Zollbehörden auf ihre Vorlage verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurückgegeben haben.
Beim Import sind dies im Regelfall
- (elektronische) Zollanmeldung
- Handelsrechnung
- Frachtdokumente
- Präferenznachweise (Ursprungsfräferenz, EUR.1, Ursprungserklärung ,
früher auch Ursprungszeugnis Form A; Freiverkehrspräferenz: A.TR) oder - vorgeschriebene Ursprungszeugnisse.
Beim Export sind dies im Regelfall
- elektronische Zollanmeldung
- Ausfuhrgenehmigungen oder
- Nullbescheide
Diese Dokumente werden üblicherweise mit den Unterlagencodierungen auf der Zollanmeldung erfasst. Es geht nur um diejenigen Unterlagen, die zum einen gemäß elektronischem Zolltarif zwingend sind und die auch tatsächlich als Dokument vorliegen. Bei Angaben in Form von sogenannten Negativcodierungen (zum Beispiel Y901 (kein Dual-use-Gut), Y903 (kein Kulturgut) liegen keine Dokumente vor, diese Angaben müssen schlüssig nachvollziehbar sein). Die Exportrechnung muss der Zollanmeldung nicht beigefügt werden und zählt daher nicht als Zolldokument.
Beim Export werden viele Dokumente erstellt, die nicht für die Ausfuhrzollabfertigung wichtig sind, sondern im Zielland eine Wirkung entfalten sollen (Präferenznachweise, Ursprungszeugnisse, diverse Bescheinigungen). Diese für das Zielland wirksamen Dokumente sind im Original im Zielland einzureichen und liegen daher beim exportierenden Unternehmen höchstens noch als Kopie oder Datei vor. Deswegen fallen sie nicht unter die nachfolgend aufgeführten Aufbewahrungsfristen und Aufbewahrungsformen. In der Praxis werden diese Kopien mit aufbewahrt, da die Vorgangsdokumentation sinnvollerweise nicht getrennt wird.
2. Aufbewahrungsform
a) elektronisches Original: elektronisch aufbewahren
Bei elektronisch abgegebenen Zollanmeldungen (ATLAS) muss die komplette Datenkommunikation, beginnend mit dem Antrag und endend mit dem abschließenden Ausgangsvermerk (AGV) oder Alternativ-AGV aufbewahrt werden. Da diese Daten in elektronischer Form (originär elektronische Daten) erstellt werden, sind diese auch in elektronischer Form aufzubewahren. Eine Aufbewahrung in Papierform ist nicht ausreichend und allenfalls zusätzlich möglich. Der Datenverkehr (Logbuch) sollte durch das genutzte Zollprogramm aufgezeichnet werden. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Anbieter. Die Kriterien finden Sie in der Verfahrensanweisung ATLAS unter Punkt 6.2 „Archivierung/ Aufbewahrung von Unterlagen und elektronischen Daten auf Beteiligtenseite“. Bei Nutzung der IAA Plus sollten Sie das zur Verfügung gestellte zip-file pro Vorgang herunterladen und speichern (siehe Gliederungspunkt 3.6 des IAA-Plus-Handbuchs).
Bei elektronisch abgegebenen Zollanmeldungen (ATLAS) muss die komplette Datenkommunikation, beginnend mit dem Antrag und endend mit dem abschließenden Ausgangsvermerk (AGV) oder Alternativ-AGV aufbewahrt werden. Da diese Daten in elektronischer Form (originär elektronische Daten) erstellt werden, sind diese auch in elektronischer Form aufzubewahren. Eine Aufbewahrung in Papierform ist nicht ausreichend und allenfalls zusätzlich möglich. Der Datenverkehr (Logbuch) sollte durch das genutzte Zollprogramm aufgezeichnet werden. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Anbieter. Die Kriterien finden Sie in der Verfahrensanweisung ATLAS unter Punkt 6.2 „Archivierung/ Aufbewahrung von Unterlagen und elektronischen Daten auf Beteiligtenseite“. Bei Nutzung der IAA Plus sollten Sie das zur Verfügung gestellte zip-file pro Vorgang herunterladen und speichern (siehe Gliederungspunkt 3.6 des IAA-Plus-Handbuchs).
b) Ausnahme: Aufbewahrung im Papier-Original
Der Grundsatz: Unterlagen, die einer Zollanmeldung nach Art. 162 und Art. 163 UZK beizufügen sind, müssen im Original aufbewahrt werden, sofern die Zollbehörden auf ihre Vorlage verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurückgegeben haben (siehe oben). Das gilt dann, wenn es sich dabei „um amtliche Urkunden oder handschriftlich zu unterschreibende nicht förmliche Präferenznachweise handelt" (§ 147 Abs. I Nr. 4a i.V.m. § 147 Abs. II Abgabenordnung). Betroffen sind somit in der Regel die Importvorgänge (zum Beispiel Gesundheitszeugnisse, Ursprungsnachweise, unterschriebene Ursprungserklärungen, Freiverkehrsnachweis A.TR). Achtung: Falls eine Rechnung oder Handelsdokumente mit einem Zollstempel versehen sind, müssen diese ebenfalls im Original aufgehoben werden. Dies kann zum Beispiel bei Ausfuhrsendungen unter 1000 Euro der Fall sein, wenn für Umsatzsteuerzwecke die Rechnung mit einem Zollstempel versehen wird.
Der Grundsatz: Unterlagen, die einer Zollanmeldung nach Art. 162 und Art. 163 UZK beizufügen sind, müssen im Original aufbewahrt werden, sofern die Zollbehörden auf ihre Vorlage verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurückgegeben haben (siehe oben). Das gilt dann, wenn es sich dabei „um amtliche Urkunden oder handschriftlich zu unterschreibende nicht förmliche Präferenznachweise handelt" (§ 147 Abs. I Nr. 4a i.V.m. § 147 Abs. II Abgabenordnung). Betroffen sind somit in der Regel die Importvorgänge (zum Beispiel Gesundheitszeugnisse, Ursprungsnachweise, unterschriebene Ursprungserklärungen, Freiverkehrsnachweis A.TR). Achtung: Falls eine Rechnung oder Handelsdokumente mit einem Zollstempel versehen sind, müssen diese ebenfalls im Original aufgehoben werden. Dies kann zum Beispiel bei Ausfuhrsendungen unter 1000 Euro der Fall sein, wenn für Umsatzsteuerzwecke die Rechnung mit einem Zollstempel versehen wird.
c) Regelfall: Aufbewahrung auf einem Bildträger oder anderen Datenträgern
Für alle Unterlagen, die nicht gemäß b) im Original aufbewahrt werden müssen, ist die Wiedergabe auf einem Bild- oder anderen Datenträger zulässig, sofern auch alle anderen Unterlagen in dieser Form vom steuerpflichtigen Unternehmen aufbewahrt werden. Das gilt auch für alternative Nachweisdokumente im Fall offener Ausfuhranmeldungen. Dies kann unter anderem die Spediteursbescheinigung sein. Das Unternehmen kann also bei den meisten Dokumenten zwischen der Aufbewahrung im Papier-Original oder in bildlicher elektronischer Darstellung wählen.
Für alle Unterlagen, die nicht gemäß b) im Original aufbewahrt werden müssen, ist die Wiedergabe auf einem Bild- oder anderen Datenträger zulässig, sofern auch alle anderen Unterlagen in dieser Form vom steuerpflichtigen Unternehmen aufbewahrt werden. Das gilt auch für alternative Nachweisdokumente im Fall offener Ausfuhranmeldungen. Dies kann unter anderem die Spediteursbescheinigung sein. Das Unternehmen kann also bei den meisten Dokumenten zwischen der Aufbewahrung im Papier-Original oder in bildlicher elektronischer Darstellung wählen.
3. Aufbewahrungsfrist
In Deutschland kommen sechs und zehn Jahre als Aufbewahrungsfrist in Frage (zuzüglich des laufenden Kalenderjahres). Wenn Dokumente aus steuerlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, gilt immer eine Frist von zehn Jahren. Da Zolldokumente, insbesondere der Ausgangsvermerk (AGV), auch als Nachweis für eine steuerfreie Ausfuhrlieferung dienen, sind der AGV und die zugehörige Datenkommunikation (Logbuch) in ATLAS zehn Jahre aufzubewahren. Dieselbe Frist gilt für die vorzulegenden/vom Zoll zurückgegebenen beziehungsweise in der Zollanmeldung zwingend mit einer Unterlagencodierung versehenen Dokumente (siehe oben).
4. Was gilt für Lieferantenerklärungen?
Lieferantenerklärungen gehören ebenfalls zu den Dokumenten, die gemäß § 147 I AO i.V.m. § 147 III AO zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Das hat die deutsche Zollverwaltung im Dezember 2019 klargestellt. Zuvor wurde die Auffassung vertreten, dass eine Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren gilt. Grund für die geänderte Einschätzung ist, dass Lieferantenerklärungen unter Artikel 15 I UZK gesehen werden.
IHK-Einschätzung: Jede Verlängerung einer Aufbewahrungsfrist verursacht Kosten. Eine Lieferantenerklärung hat keine steuerlichen Wirkungen im Inland. Eine Überprüfung durch den Zoll ist rückwirkend nur drei Jahre (regelmäßig zuzüglich dem laufenden Jahr) im Rahmen einer Betriebsprüfung oder eines ausländischen Nachprüfungsersuchens möglich. Im Rahmen des INF4-Verfahrens könnten gegebenenfalls längere Fristen denkbar sein. Dies ist sehr selten.
IHK-Einschätzung: Jede Verlängerung einer Aufbewahrungsfrist verursacht Kosten. Eine Lieferantenerklärung hat keine steuerlichen Wirkungen im Inland. Eine Überprüfung durch den Zoll ist rückwirkend nur drei Jahre (regelmäßig zuzüglich dem laufenden Jahr) im Rahmen einer Betriebsprüfung oder eines ausländischen Nachprüfungsersuchens möglich. Im Rahmen des INF4-Verfahrens könnten gegebenenfalls längere Fristen denkbar sein. Dies ist sehr selten.
Gemäß § 147 II AO können Lieferantenerklärungen elektronisch aufbewahrt werden, da Lieferantenerklärungen weder amtliche Urkunden noch „handschriftlich zu unterschreibende nicht förmliche Präferenznachweise“ sind. Unter Präferenznachweisen versteht man die grenzüberschreitenden Nachweise wie Warenverkehrsbescheinigungen oder Ursprungserklärungen.
5. Aufbewahrungsort
Die Dokumente und Dateien müssen grundsätzlich im Inland aufbewahrt werden. Für eine Verlagerung der Buchführung ins Ausland ist eine Bewilligung des zuständigen Finanzamts und des zuständigen Hauptzollamtes erforderlich. Der Antrag kann über das Bürger- und Geschäftskundenportal gestellt werden. Dokumente, die im Original aufbewahrt werden müssen, dürfen nicht ins Ausland verlagert werden.
6. Weitere Informationen
- Der Zoll informiert im Internet über Aufbewahrungsfristen für Präferenzdokumente.
Kosteneinsparungen bei der Zollabwicklung
Passive Lohnveredelungsverkehre
Stand: März 2023
Die passiven Veredelungsverkehre bilden Fertigungsprozesse ab, bei denen Vorprodukte aus der EU in das Ausland geliefert werden, die be- oder verarbeitet wieder in die Union zurückkehren (dies gilt auch für Montagevorgänge, das Zusammenfügen von Waren und die Anpassung an andere Waren). Die richtige Anwendung passiver Veredelungsverkehre erlaubt erhebliche Kosteneinsparungen bei der Zollabwicklung.
Die passiven Veredelungsverkehre gibt es in zwei Ausprägungen: wirtschaftliche und zollamtlich bewilligte Verkehre.
Die passiven Veredelungsverkehre gibt es in zwei Ausprägungen: wirtschaftliche und zollamtlich bewilligte Verkehre.
1. Wirtschaftlicher passiver Veredelungsverkehr
Diese Form des Veredelungsverkehrs bietet sich an, wenn ausschließlich Vormaterial mit präferenziellem Ursprung in der EU zur Be- und Verarbeitung in Länder ausgeführt wird, mit denen die EU Präferenzabkommen geschlossen hat (Übersicht Präferenzabkommen). Die Veredelungsware ist bei der Wiedereinfuhr nach der Veredelung in die EU zollfrei, durch die Anwendung der entsprechenden Verfahrenscodes wird der Warenweg abgebildet. Bei formalen Schwierigkeiten mit den Präferenznachweisen kommt unter Umständen noch eine Zollreduktion bei der Wiedereinfuhr in Betracht.
Folgende Verfahrensschritte müssen eingehalten werden:
- die Ausfuhr erfolgt mit der Ausfuhranmeldung (die entsprechenden Datenfelder in der Ausfuhranmeldung sind mit den Codes für die vorübergehende Ausfuhr zu kodieren) per elektronischer Meldung in ATLAS-Ausfuhr.
- Proformarechnung
- Präferenznachweis EUR.1 (oder Ursprungserklärung auf Handelspapier bei Sendungen unter 6.000 Euro bzw. als "Ermächtigter Ausführer" ohne Wertbegrenzung.
Alle Papiere ausgestellt vom EU-ansässigen Ausführer. - Die Wiedereinfuhr in die EU nach Lohnveredelung erfolgt mit Einfuhranmeldung auf Einheitspapier oder ATLAS-Einfuhr (die entsprechenden Felder in der Einfuhranmeldung sind mit den Codes für die Wiedereinfuhr zu kodieren).
- Rechnung über Lohnkosten
- Hilfreich ist eine Kopie der Proformarechnung der ausgeführten Ware
- Präferenznachweis EUR.1 (oder Ursprungserklärung), ausgestellt vom Veredelungsbetrieb im Drittland
2. Zollamtlich bewilligter passiver Veredelungsverkehr
Dieses Verfahren bietet sich immer dann an, wenn neben Vormaterial mit Präferenzursprung auch solches ohne Präferenzursprung exportiert wird. Der zollamtlich bewilligte passive Veredelungsverkehr muss vor der Ausfuhr vom zuständigen Hauptzollamt genehmigt werden.
Es bestehen zwei Varianten des bewilligten passiven Veredelungsverkehrs:
Variante 1 (nur bei Ländern, mit denen Präferenzabkommen bestehen)
Die Be- oder Verarbeitung im Abkommensland ist ursprungsbegründend entsprechend den zugrundeliegenden Präferenzabkommen. Das bedeutet, dass die Ware bei der Wiedereinfuhr in die EU präferenzberechtigt ist. Dann ist der Ablauf folgender:
Die Be- oder Verarbeitung im Abkommensland ist ursprungsbegründend entsprechend den zugrundeliegenden Präferenzabkommen. Das bedeutet, dass die Ware bei der Wiedereinfuhr in die EU präferenzberechtigt ist. Dann ist der Ablauf folgender:
- Die Ausfuhr erfolgt mit der Ausfuhranmeldung (die entsprechenden Felder in der Ausfuhranmeldung sind mit den Codes für die vorübergehende Ausfuhr zu codieren) per elektronischer Meldung in ATLAS-Ausfuhr. Den genauen elektronischen Ablauf und Besonderheiten bei der Erledigung finden Sie unter den Downloads in der Servicespalte neben diesem Text.
- Proformarechnung
- Die im Präferenzabkommen zu veredelnde Ware ohne Präferenzursprung der EU wird im Veredelungsland zum Zollsatz fünf Prozent (für Textilwaren zehn Prozent) verzollt (sog. Draw-back-Regelung). Achtung: die Sätze können in einzelnen Abkommen abweichen!
- Für die Waren mit Präferenzursprung gilt der Präferenznachweis EUR.1 (oder Ursprungserklärung auf Handelspapier bei Sendungen unter 6.000 Euro bzw. als "Ermächtigter Ausführer" ohne Wertbegrenzung).
- Die Wiedereinfuhr in die EU nach Lohnveredelung in einem Präferenzabkommen erfolgt mit ATLAS-Einfuhr (die entsprechenden Felder in der Einfuhranmeldung sind mit den Codes für die Wiedereinfuhr zu kodieren).
- Rechnung über Lohnkosten
- Präferenznachweis EUR.1 (oder Ursprungserklärung), ausgestellt vom Veredelungsbetrieb im Präferenzabkommen, vorausgesetzt, die Vorschriften der Verarbeitungslisten für die jeweilige HS-Nummer wurden im Präferenzabkommen eingehalten und die Verzollung der Ware ohne Präferenzursprung im Präferenzabkommen wurde dem dortigen Zoll nachgewiesen.
- Die veredelte Ware ist bei der Wiedereinfuhr in die EU zollfrei!
Variante 2 (alle Länder)
- Die ins Ausland gelieferten Vormaterialien werden dort nicht verzollt (in der Regel Verfahren der aktiven Veredelung).
- Die Rücklieferung der gefertigten Ware in die EU erfolgt daher ohne Präferenznachweis.
- Im Rahmen des genehmigten passiven Veredelungsverkehrs wird bei Wiedereinfuhr in die EU der im Ausland geschaffene Mehrwert verzollt, d.h. die veredelte Ware ist bei der Wiedereinfuhr in die EU nicht vollständig zollfrei. Die Wertschöpfung des Auslandes muss verzollt werden, die gelieferten Vorprodukte werden aber nicht mehr erneut verzollt. Seit 1. Mai 2016 ist die früher mögliche Alternative der Differenzverzollung entfallen.
- Diese Variante der passiven Veredelung kann bei jedem Drittland angewendet werden.
Importe im Rahmen von passiven Veredelungsverkehren unterliegen auch Erleichterungen bei der Einfuhrumsatzsteuer. Die Angaben zum Zollwert müssen immer ab einem Warenwert von 20.000 Euro ausgefüllt werden.
Hinweis
Generell ist es wichtig, die Höhe der Ausbeute (d.h. beispielsweise wie viele Kleidungsstücke je Quadratmeter Stoff zu gewinnen sind) mit seinem Veredelungspartner im voraus festzulegen, um Streit zu vermeiden. Sollte darüber keine Einigung erzielt werden können, kann es insbesondere bei präferenzbegünstigten Waren eine Überlegung wert sein, auf die Vorteile der Veredelungsverkehre zu verzichten und stattdessen zwei Kaufgeschäfte (über die gelieferten Vorprodukte und die bezogenen Endprodukte) abzuschließen.
Generell ist es wichtig, die Höhe der Ausbeute (d.h. beispielsweise wie viele Kleidungsstücke je Quadratmeter Stoff zu gewinnen sind) mit seinem Veredelungspartner im voraus festzulegen, um Streit zu vermeiden. Sollte darüber keine Einigung erzielt werden können, kann es insbesondere bei präferenzbegünstigten Waren eine Überlegung wert sein, auf die Vorteile der Veredelungsverkehre zu verzichten und stattdessen zwei Kaufgeschäfte (über die gelieferten Vorprodukte und die bezogenen Endprodukte) abzuschließen.
3. Aktiver Veredelungsverkehr im Ausland
Normalerweise steht dem passiven Veredelungsverkehr ein aktiver Veredelungsverkehr im Fertigungsland gegenüber. Auch hierbei unterscheidet man wirtschaftliche und bewilligte aktive Veredelungsverkehre. Die Struktur entspricht spiegelbildlich dem passiven Veredelungsverkehr: Ware kommt ins Land, wird be- oder verarbeitet und verlässt das Land wieder. Eventuell im Land bleibende Vor- oder Fertigprodukte bzw. Produktionsabfälle müssen verzollt werden. Die Wiederausfuhr muss nachgewiesen werden. Um die Einrichtung der aktiven Veredelung muss sich der ausländische Veredelungspartner kümmern, da sich dieses Verfahren in einem anderen Zollgebiet abspielt.
4. Fiktives Berechnungsbeispiel
Fall: Bewilligte passive Veredelung zur Herstellung von Jacken
(KN-Code 62043290, Zollsatz 12,0 Prozent)
(KN-Code 62043290, Zollsatz 12,0 Prozent)
- Waren der vorübergehenden Ausfuhr (beigestellte Waren):
Gewebe aus Baumwolle, KN-Code 52081190, Wert: 10.000 Euro, Zollsatz 8,0 Prozent
Druckknöpfe, KN-Code 96061000, Wert: 2.000 Euro, Zollsatz 3,7 Prozent - Veredelungskosten (Material- und Lohnkosten): 8.000 Euro
- (Rück-)Transportkosten vom Veredelungsort im Ausland bis zum Unternehmen in Deutschland: 1.000 Euro
Abgaben bei beantragter Mehrwertverzollung
Zollwert der Veredelungskosten:
|
Veredelungskosten in der Ukraine:
|
8.000 Euro
|
| + (Rück-)Transportkosten bis zum Ort des Verbringens |
1.000 Euro
|
| Zollwert Veredelungskosten: | 9.000 Euro |
Abgabenberechnung:
Zollwert der Veredelungskosten x Zollsatz des Veredelungserzeugnisses
Zollwert der Veredelungskosten x Zollsatz des Veredelungserzeugnisses
9.000 Euro x 12,0 Prozent = 1.080 Euro Zoll
Nebenbemerkung:
Um Missbrauch auszuschließen, müssen drittländische Vormaterialien, die
- in der EU zollfrei sind und
- hier ausschließlich deswegen eingeführt worden sind, um die Verzollung mit dem Zollsatz des Veredelungserzeugnisses zu verhindern, doch mit verzollt werden. Dies dürfte aber ohne große praktische Auswirkungen sein, da es in der Regel logistische Gründe für die Verzollung in der EU gibt. Wenn die Einfuhr durch ein anderes Unternehmen erfolgt ist, kann die Verzollung gänzlich ausgeschlossen werden.
Um Missbrauch auszuschließen, müssen drittländische Vormaterialien, die
- in der EU zollfrei sind und
- hier ausschließlich deswegen eingeführt worden sind, um die Verzollung mit dem Zollsatz des Veredelungserzeugnisses zu verhindern, doch mit verzollt werden. Dies dürfte aber ohne große praktische Auswirkungen sein, da es in der Regel logistische Gründe für die Verzollung in der EU gibt. Wenn die Einfuhr durch ein anderes Unternehmen erfolgt ist, kann die Verzollung gänzlich ausgeschlossen werden.
5. Varianten und Fallgestaltungen
Im Rahmen der passiven Veredelung können zahlreiche Varianten abgebildet werden. Insbesondere Verfahrenserleichterungen (Anschreibeverfahren A7), Teileinfuhren, Ausbesserungen und ähnliches. Die individuell benötigen Varianten und deren zollrechtliche Abbildung sollte mit dem Hauptzollamt besprochen werden.
Zollverfahren und Zollwert
Abfertigung von Reparatursendungen: Verfahrensalternativen und Zollwert
Stand: Januar 2024
Es gibt unterschiedliche Methoden, wie mit aus dem Ausland kommenden Reparatursendungen zolltechnisch umgegangen werden kann. Zur Wahl stehen grundsätzlich folgende Verfahren:
- Abfertigung zum freien Verkehr als Rückware
- Abfertigung zum freien Verkehr
- Abfertigung zur aktiven Ausbesserung
Jedes dieser Verfahren hat seine Vor- und Nachteile. Der Einführer kann frei entscheiden, welches Verfahren er wählt, sofern die jeweiligen Voraussetzungen gegeben sind.
1. Abfertigung zum freien Verkehr als Rückware
Vorteile:
- es fallen keine Eingangsabgaben an, weder Zoll noch Einfuhrumsatzsteuer
- die Ware ist im freien Verkehr, sie unterliegt keiner zollamtliche Überwachung, das heißt mit ihr kann beliebig verfahren werden und sie muss nicht innerhalb einer bestimmten Frist wieder ausgeführt werden
- elektronische Zollanmeldungen (Einfuhr, Wiederausfuhr)
Die Abfertigung als Rückware ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich: - die ursprüngliche Ausfuhr der zu reparierenden Ware ist vor maximal drei Jahren erfolgt, wobei Ausnahmen von der Frist möglich sind
- Die damalige Ausfuhr muss belegt werden können, deswegen sind meist der damalige Ausführer und der Einführer der Reparatursendung identisch (zwingend, wenn keine Einfuhrumsatzsteuer entstehen soll)
- Die Ware kommt im unveränderten Zustand aus dem Ausland zurück: sie ist nicht weiter verarbeitet, sondern lediglich benutzt worden.
Unter www.zoll.de finden sich weitere Details, auch zur Abfertigungsprozedur.
Häufig stellt die Abfertigungsvariante als Rückware eine gute Möglichkeit für den Umgang mit Reparatursendungen dar.
Weitere Varianten für die Abfertigung von Reparatursendungen sind folgende:
2. Abfertigung zum freien Verkehr
Vorteile:
- die Ware ist im freien Verkehr, sie unterliegt keiner zollamtliche Überwachung, das heißt mit ihr kann beliebig verfahren werden und sie muss nicht innerhalb einer bestimmten Frist wieder ausgeführt werden
- elektronische Zollanmeldungen (Einfuhr, Wiederausfuhr)
- es muss keine frühere Ausfuhr der zu reparierenden Ware belegt werden oder gegeben sein, die Dreijahresfrist spielt keine Rolle
- die Ware kann im Ausland verändert worden sein
Nachteile:
- Zoll fällt an, ein präferenzieller Ursprung kann für zurückkehrende EU-Ware regelmäßig nicht genutzt werden (Ausnahme: Sendungen aus der Schweiz oder Kanada), zu beachten ist aber, dass die Zollsätze häufig sehr niedrig sind.
- Einfuhrumsatzsteuer fällt an, diese kann in der Regel vom reparierenden Unternehmen als Vorsteuer geltend gemacht werden. Voraussetzung: Die Wiederausfuhr kann nachgewiesen werden. Einzelheiten sind in Abschnitt 15.8 (8) Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) enthalten.
3. Abfertigung zur aktiven Ausbesserung
Vorteile:
- es fallen keine Eingangsabgaben an, weder Zoll noch Einfuhrumsatzsteuer
- es muss keine vorangehende Ausfuhr der zu reparierenden Ware belegt werden oder gegeben sein, die Dreijahresfrist spielt keine Rolle
- die Ware kann im Ausland verändert worden sein
Nachteile:
- die Ware ist unter zollamtlicher Überwachung, es besteht eine Wiederausfuhrfrist,
- für die Zölle muss eine Sicherheit hinterlegt werden. Beträgt der berechnete Sicherheitsbetrag nicht mehr als 1000 Euro, verzichtet der Zoll in der Regel auf die Erhebung. Die Sicherheit kann in bar, per Überweisung oder bei regelmäßigen Verfahren als Gesamtsicherheit für alle Vorgänge geleistet werden.
Für die aktive Ausbesserung ist der Abwicklungsaufwand im Unternehmen am höchsten. Bei regelmäßigen Verfahren – wenn eine förmliche Bewilligung des jeweiligen Hauptzollamts vorliegt – wurden die papiergestützen Informationsblätter (INF) zum 1. Juni 2020 durch Einführung des Standardinformationsaustauschs INF über das EU Customs Trader Portal (EUCTP) ersetzt.
Hinweis: Eine aktive Ausbesserung für zollfreie Waren ist in der Regel nur möglich, wenn die Einfuhrumsatzsteuer nicht als Vorsteuer abgezogen werden kann.
Zollwert bei Reparatursendungen
Der tatsächliche Zollwert der defekt eingeführten Ware ist naturgemäß unbekannt, weil der Schaden meist nicht klar ist. Es ist sinnvoll, als Unternehmen anhand objektiver Kriterien diesen Zollwert regelgebunden festzulegen. Parameter hierzu können sein:
- ursprünglicher Kaufpreis
- Nutzungsdauer
- übliche Abnutzung
- bekannte Schadenshöhen aus der Vergangenheit.
Bei einzelnen Reparatursendungen erfolgt die Zollwertfestsetzung bei der aktiven Ausbesserung im Rahmen der Zollabfertigung mit dem Zollamt. Bei fortlaufenden Reparaturverkehren kann eine Vorabfestlegung mit dem Hauptzollamt sinnvoll sein, unabhängig vom gewählten Verfahren.
Brexit: Besonderheiten bei Reparatursendungen mit Großbritannien und Japan
In den beiden Handelsabkommen mit Großbritannien und Japan ist die Besonderheit enthalten, dass Reparatursendungen grundsätzlich zollfrei gestellt werden, unabhängig vom Ursprung der zu reparierenden Ware. Leider klingt das besser als es ist: Für die praktische Anwendung sieht die Zollverwaltung die Anmeldung zur aktiven oder passiven Veredelung vor.
selbst recherchieren
Access2Markets
Stand: Juli 2024
Unter einer Adresse Zollsätze, Einfuhrbestimmungen, zuständige Behörden, Informationen zu Handelsabkommen recherchieren – das geht mit Access2Markets, dem Außenhandelsportal der EU-Kommission. Ziel der Anwendung ist es, allen Unternehmen den Zugang zu internationalen Märkten zu erleichtern.
Die Datenbank Access2Markets beinhaltet bereits Daten zu Zöllen und Einfuhrbestimmungen für 135 Drittstaaten, darunter auch kleinere Länder wie Antigua und Barbuda, Eswatini oder die Seychellen. Gerade bei kleineren Ländern ist es sonst oft schwierig, verlässliche Informationen zu erhalten.
Ein Erklärvideo der EU-Kommission führt Sie durch die Online-Anwendung.
Der Bereich “My Trade Assistant” liefert die wesentlichen Informationen:
Exporte und Importe
Im Bereich “Waren und ROSA” sind Daten für den Import in die EU (Trade Helpdesk) und den Export in Drittländer enthalten. Auch Details für innergemeinschaftliche Lieferungen können recherchiert werden, etwa besondere Verbrauchsteuersätze in einzelnen EU-Mitgliedsstaaten.
Tipps für die Exportrecherche in Access2Markets
- Es ist erforderlich, ein Exportland einzugeben. Dies sollte immer ein EU-Staat sein, auch wenn die Ware tatsächlich nicht aus der EU in ein Drittland geht, beispielsweise bei Transitgeschäften.
- Es ist ebenfalls erforderlich, die Ware bis auf die einzelne Tariflinie zu definieren, das heißt eventuell bis zur zehnten Stelle der Warennummer, je nach Zielland. Die vierstellige Position reicht nicht aus.
Ursprungsregeln/ROSA
Schrittweise werden die präferenziellen Ursprungsregeln aller EU-Handelsabkommen integriert. Weiterhin ist ein Vergleich der Ursprungsregeln unterschiedlicher EU-Handelsabkommen möglich, so wie dies auch auf der WuP Online-Seite des deutschen Zolls möglich ist. ROSA ist eine interaktive Checkliste, mit deren Hilfe Unternehmen ermitteln können, welche Regeln ihre Waren erfüllen müssen, damit diese einen präferenziellen Ursprung erhalten. Das Ergebnis kann dokumentiert und ausgedruckt werden. Ein Ursprungsrechner ist nicht enthalten. Zollabbaustufen aus Handelsabkommen sind unter dem Punkt “Zölle” im Trade Assistant integriert.
Sanktionen der EU und gegen die EU
Sanktionen der EU gegen Drittländer sind mit den Importinformationen der jeweiligen Drittländer verknüpft. Diese Informationen sind nur ein erster Anhaltspunkt und ersetzen keine genaue Prüfung durch das exportierende Unternehmen. Vorübergehend wurden die russischen und belarusischen Sanktionen gegen die EU zur Information mit aufgenommen. Die EU-Sanktionen gegen Russland und Belarus haben wir für Sie zusammengestellt.
Handelsstatistiken
Es sind sämtliche Handelsdaten der EU für den Import oder Export auf Produkt- und Länderebene verfügbar. Es kann auf Basis der einzelnen Mitgliedsstaaten recherchiert werden oder für die gesamte EU.
Trade barriers
Bestehende Handelsbarrieren im Ausland können direkt an die Generaldirektion Handel der EU gemeldet werden. Diese Funktion ist im Trade Assistant unter „Trade Barriers” integriert. Die zentrale Anlaufstelle der EU zur Meldung von Handelsbarrieren wird auf der Startseite angezeigt. Dort können Sie sich beschweren, wenn Sie mit Handelshemmnissen in Drittländern konfrontiert sind.
Dienstleistungen und Investitionen (im Aufbau)
Seit Mai 2022 steht ein Handelsassistent für Dienstleistungen und Investitionen zur Verfügung. Dieser Bereich enthält Informationen über die Anforderungen, die EU-Unternehmen erfüllen müssen, um ihre Dienstleistungen in Länder außerhalb der EU zu exportieren beziehungsweise zu erbringen. Derzeit liegen Informationen über die Erbringung von Dienstleistungen im Rechts- und Seeverkehr in Kanada und im Vereinigten Königreich vor. Nach und nach werden weitere Sektoren und Länder hinzugefügt.
Öffentliche Auftragsvergabe (im Aufbau)
Der Handelsassistent für die Auftragsvergabe ist nun sichtbarer. Der Handelsassistent kann EU-Unternehmen dabei helfen, herauszufinden, wie sie an öffentlichen Ausschreibungen außerhalb der EU teilnehmen können. Für Kanada und Japan liegen derzeit Informationen vor.
Quelle: IHK Region Stuttgart