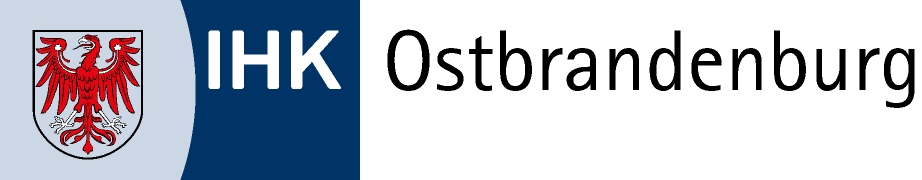Wo der Küchenchef erntet
Milan heißt die Möhre und sie passt in keine EU-Norm. Mal lang und schlank, mal klein und knubbelig. Aus einem Berg frisch geernteter, intensiv duftender Möhren sucht sich Christian Bauer, Küchenchef des Restaurants „Wilde Klosterküche“ in Neuzelle, die passenden aus. Christian Bauer ist Stammkunde in der Marktgärtnerei Vielseitenhof in Leißnitz bei Beeskow. Ihr Gemüse habe deutlich mehr Geschmack als die übliche Supermarktware, sagt Bauer. „Wer braucht schon eine Möhre, die nicht nach Möhre schmeckt?"
Der Küchenchef ist vor Kurzem mit einem Stern ausgezeichnet worden – dem Grünen Stern des renommierten Restaurantführers Guide Michelin. Es ist nicht die erste Würdigung, die sich das Team der Klosterküche erkocht hat, aber die bisher bedeutendste. Den Grünen Stern gibt es für Restaurants, in denen nicht nur exzellent, sondern auch besonders umweltbewusst gekocht wird. Dazu zählt, dass Lebensmittel nicht verschwendet und die Rohstoffe saisonal und regional bezogen werden.
Zum Michelin-Stern hat auch die Marktgärtnerei mit ihren Möhren beigetragen. Gärtner Marian Mietchen hat sich selbstständig gemacht und eine Gründungsberatung der IHK erhalten. Jetzt baut er auf dem Hof seiner Familie Gemüse an, darunter viele alte Sorten. Vor ein paar Jahren war er mal in der Wilden Klosterküche essen und hat seine Telefonnummer hinterlassen. Aus diesem ersten Kontakt hat sich ein freundschaftliches Verhältnis zu Christian Bauer entwickelt. Jeden Donnerstag kommt der Küchenchef vorbei und erntet selbst. „Das ist entspannend", sagt er. „Luxus". Bauer schneidet Zitronenbasilikum ab und packt es neben gelbe Sonnenblumen, lila Malven, orange Ringelblumen und pinkfarbene Cosmea-Blüten in eine Kiste. Die Blüten geben Suppen und Desserts einen kulinarischen und optischen Kick.
Anbauplan vor Saisonstart
Gärtner und Küchenchef verständigen sich vor Saisonstart auf einen Anbauplan – der eine kann sicher sein, was er bekommt, der andere hat eine Abnahmegarantie. Nicht alles, was Christian Bauer auf den Teller bringen will, kann er in Leißnitz ernten. Kohl zum Beispiel baut Marian Mietchen nicht an. „Solche Kulturen belegen ein Beet für ein Jahr, das ist für mich nicht wirtschaftlich." Mietchen braucht möglichst drei schnell wachsende Kulturen pro Beet und Saison. Außerdem gedeiht auch nicht jedes Gemüse auf den Leißnitzer Böden in der Qualität, die der Küchenchef gern hätte.
Ich feilsche nicht. Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun." Christian Bauer, Wilde Klosterküche Neuzelle
Das Team der Wilden Klosterküche hat sich deshalb über Jahre ein großes Netzwerk an Lieferanten aufgebaut: Sellerie und Blumenkohl kommen aus Sachsen, Kräuter aus dem Garten des Klosters Neuzelle. Die Lieferwege sollen möglichst nicht länger als 50 Kilometer sein. Das gilt auch für Fleisch und Fisch. Aal, Saibling oder Forelle bezieht die Klosterküche aus der Beeskower Region. Biorind aus dem 45 Kilometer entfernten Briesen, Fair-Mast-Eier und Schweinefleisch aus dem Kreis Spree-Neiße. Die Produkte stammen aus kleinen Betrieben, nicht aus Massentierhaltung. Das Netz aus regionalen Produzenten aufzubauen, sei nicht einfach gewesen, sagt Bauer. „Das hat viel mit persönlichen Kontakten und gegenseitigem Vertrauen zu tun".
Verzicht auf Massenware hat seinen Preis
Allerdings hat die Regionalität einen Haken: Hiesige Gemüsebauern liefern nur von Frühjahr bis Herbst. Um im Winter nicht nur Wurzelgemüse aufzutischen, konserviert Christian Bauer einen Teil der Ernte aus dem Sommer. Gemüse und Kräuter werden vor allem schockgefrostet oder fermentiert, wodurch sich die Aromen teils sogar intensivieren lassen. Außerdem ist auch nicht alles regional zu bekommen: Salz, Pfeffer, Gewürze wie Vanille, Zimt und Kardamom oder Zitronen gehören dazu, ebenso wie etwa Trüffel oder Meeresfrüchte für spezielle Menüs auf Kundenwunsch.
Der Verzicht auf Massenware hat aber seinen Preis: 7,50 Euro kostet das Kilo Bohnen in der Leißnitzer Marktgärtnerei, vier Euro die Zucchini, sowohl für private Kunden als auch Gastronomen. Gärtner Mietchen orientiert sich an gängigen Preisen vergleichbarer Produzenten. Er zieht seine Pflanzen selbst, auf seinem Hof gibt es kein Gerät mit Motor – alles ist Handarbeit. „Ich feilsche nicht“, sagt Christian Bauer. „Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun." Allerdings zahlt auch ein Sterne-Restaurant nicht jeden Preis. Bestimmte Fischarten aus der Region zu bekommen, sei gegenwärtig schwierig, erläutert er. Sie seien zu teuer, das könne er seinen Gästen nicht zumuten. Bauer weicht dann mitunter auf Fisch aus zertifiziertem und handfiletiertem Leinenfang aus anderen Ländern aus – ein Kompromiss.
Auch die Schwarte lässt sich veredeln
Woher Fisch, Fleisch und Gemüse stammen, das steht auf der Speisekarte der Wilden Klosterküche in Neuzelle. Ein Hauptgericht ist a la carte ab 29 Euro zu haben, ein Menü (3-Gänge vegetarisch) ab 59 Euro. Beim Servieren erzählt das Küchenteam seinen Gästen, woher Karotte oder Schweinefleisch kommen. Und dass das Fleisch teurer ist, weil das Tier nicht nur wenige Monate alt wurde, sondern mehr als ein Jahr gut gelebt habe. Wie die Küche mit den Kunden kommuniziert, hat der Guide Michelin bei seiner Sterne-Wertung gleichfalls betrachtet. Ebenso wie das Einsparen von Abfällen. Von Pflanze und Tier soll möglichst alles verwertet werden. „Man kann alles so veredeln, dass es zum Edelteil wird", ist Bauer überzeugt. Selbst die Schweineschwarte. Daraus kocht er eine Beilage. Anderes wird in der hauseigenen Blut- und Leberwurst verarbeitet.
Von den Möhren aus Leißnitz hat Christian Bauer auch das Blattgrün verwendet, es getrocknet und pulverisiert. Dann hat er den Möhren mehr als die Hälfte ihrer Flüssigkeit entzogen, sie in den pulverisierten Blättern gewälzt und zu einer Rolle geformt. Davon schneidet er tieforange, dunkel marmorierte Scheiben ab. Garniert mit Dickmilch und Kräutern, angerichtet mit Püree und einer Sauce aus dem Saft der Möhren wird daraus die „Leißnitzer Karotte“, ein Zwischengang auf der Speisekarte.
Mehr Reichweite mit Grünem Stern
Wie das Gericht zubereitet wird, können die Gäste sehen. Eine Glasscheibe trennt den Gastraum von der Küche. In einer Ecke dieses großen Schaufensters, auf der Küchenseite, steht der Grüne Michelin-Stern – in Form eines grünen Kleeblatts. Diesen Stern zu erreichen, das sei “eine Herzensangelegenheit“, gewesen, bekennt der Küchenchef. Er hat sein Handwerk im Seehotel Wendisch-Rietz gelernt. Danach hat der gebürtige Beeskower lange in Berlin gearbeitet, bevor es ihn zurück in die Heimat zog.
Vom Michelin-Stern verspricht sich das Restaurant in der Grenzregion, 100 Kilometer von Berlin entfernt, mehr Reichweite. Seine Kundschaft kommt aus Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Berlin – und aus Neuzelle. Manche Gäste sprechen Christian Bauer auf den Grünen Stern in seiner Küche an. Für ihn ist er ein Ansporn: Neben dem Grünen Kleeblatt wäre noch Platz für einen klassischen Michelin-Stern.
FORUM/Ina Matthes
Kontakt

Manuela Neumann
Referentin Tourismus
Regionalcenter Berliner Umland