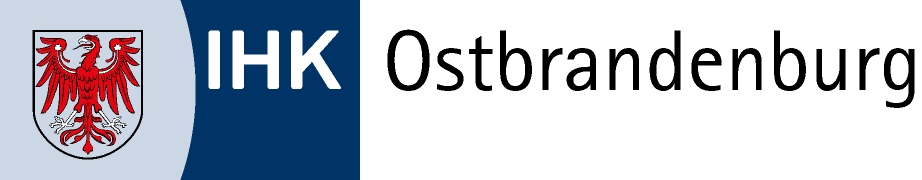Hinweise zum Report
Bearbeitungszeitraum für die Durchführung und Dokumentation von Reporten
| Die Abgabe des Reportes hat bis spätestens zum Tag der schriftlichen Abschlussprüfung Teil 2 zu erfolgen. Der Report beziehen sich auf die tatsächlich durchgeführte Fachaufgabe in der gewählten Wahlqualifikation. Diese Prozesse werden im Betrieb zum Teil lange vor dem Prüfungstermin durchlaufen. Deshalb sollten die Reporte zeitnah zu der jeweiligen Fachaufgabe verfasst werden. Kurz vor dem Abgabetermin ist es sinnvoll, die Reporte noch einmal zu überarbeiten. |
Formale Hinweise und Aufbau der Dokumentation
Hinweis: Die Dokumentation ist in einem Schnellhefter abzulegen.(ungebunden; kein Ordner; keine Folien)
|
Inhaltliche Hinweise für die Erstellung der Reporte
Welche Fragestellungen/Inhalte in diesen Gliederungspunkte beschrieben und reflektiert werden können, wird nachfolgend exemplarisch aufgeführt.
1. Beschreibung der Aufgabenstellung
2. Beschreibung der Zielsetzung
Wie kann die Zielsetzung beschrieben werden?
3. Beschreibung der Planung
4. Beschreibung der Durchführung
Darstellung des Durchführungsprozesses unter Berücksichtigung, wie die geplanten Punkte (siehe Punkt 3) tatsächlich umgesetzt wurden, z. B.:
5. Beschreibung des Ergebnisses
Beschreibung des Ergebnisses der bearbeiteten Aufgaben anhand beispielsweise folgender Punkte:
6. Reflexion des Prozesses, der zum Ergebnis geführt hat (Auswertung)
Was wurde aus der Bearbeitung der Aufgabe gelernt?
|
Abgabe der Reporte
|
Die Abgabe der Reporte erfolgt über das Azubi-Infocenter bis zum Tag der schriftlichen Prüfung. Eine vorherige Genehmigung durch den Prüfungsausschuss erfolgt nicht.
Sie benötigen für die weitere Bearbeitung der Reportvariante folgende Formulare:
Die Dokumentation der Reporte ist zudem vom Prüfling in 4-facher Ausfertigung (je Report) zur schriftlichen Prüfung bei der zuständigen Aufsicht abzugeben.
Eine termingerechte und ordnungsgemäße Übergabe der Dokumentation durch den Prüfungsteilnehmer ist sicherzustellen. Wer seine Reporte nicht rechtzeitig abgibt, kann nicht an der mündlichen Prüfung teilnehmen. Die Prüfungsleistung wird dann mit null Punkten bewertet.
|
Fallbezogenes Fachgespräch
|
Laut Ausbildungsordnung wird mit dem Prüfling ein Fachgespräch von höchstens 20 Minuten geführt. Grundlage des fallbezogenen Fachgespräches ist der im Vorfeld erstellte praxisbezogene Report. Das Fallbezogene Fachgespräch wird mit einer mündlichen Darstellung von Aufgabe und Lösungsweg des Prüflings (max. 5 Minuten) eingeleitet. Eine Präsentation des Reportes ist nicht vorgesehen.
Bewertet werden folgenden Kriterien, die sich aus der Verordnung ergeben, bewertet.
Das Fachgespräch wird nach der schriftlichen Prüfung durchgeführt. Dazu wird gesondert durch die IHK Ostbrandenburg eingeladen. Der Zeitraum für das Fachgespräch liegt in dem Zeitraum Juni bis August bei einer Sommerprüfung und Januar bis Februar bei einer Winterprüfung.
|