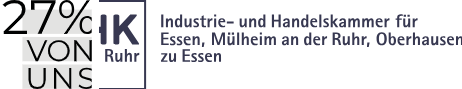Genehmigung des Sommerurlaubs
Die Sommerurlaubsplanung stellt die meisten Arbeitgeber jedes Jahr wieder vor große Herausforderungen. Eine gute und rechtzeitige Planung ist dabei für einen reibungslosen Betriebsablauf unerlässlich. Welche Grundsätze Sie als Arbeitgeber bei der Planung beachten sollten, wird im Folgenden dargestellt. Die Ausführungen beziehen sich auf die gesetzlichen Regelungen, von denen teilweise durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder individualvertragliche Regelungen abgewichen werden kann.
Urlaubsgewährung
Jeder Arbeitnehmer hat nach Ablauf einer sechsmonatigen Wartefrist einen Anspruch auf vollen Urlaub. Diese Frist beginnt nicht bereits mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages, sondern erst mit dem Tag, an dem die Arbeit aufgenommen wird. Vor Ablauf der Frist besteht ein Anspruch auf sog. Teilurlaub. Der Anspruch auf Urlaub bedeutet jedoch nicht, dass der Arbeitnehmer den Urlaub nehmen kann, wann er will. Eine Selbstbeurlaubung des Arbeitnehmers kann sogar einen Kündigungsgrund darstellen.
Eine Ablehnung eines Urlaubswunsches kommt aber nur aufgrund dringlicher betrieblicher Belange oder aufgrund vorrangiger Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer in Betracht.
Dringliche betriebliche Belange
Für die Begründung entgegenstehender dringlicher betrieblicher Belange genügt es nicht, dass Störungen im Betrieb zu erwarten sind, da diese in der Regel mit dem Fehlen eines Mitarbeiters einhergehen. Es müssen über eine Störung hinausgehende Beeinträchtigungen vorliegen.
Ein Beispiel für das Vorliegen dringlicher betrieblicher Gründe ist ein unvorhergesehener Personalengpass, der aufgrund eines hohen Krankenstandes oder wegen unvorhergesehener Kündigungen anderer Arbeitnehmer auftritt. Ebenso kommt die Eigenart der Branche als betrieblicher Grund in Betracht, zum Beispiel vorliegen, wenn die Hauptsaison des Betriebes in den Zeitraum des Urlaubswunsches fällt.
In den Fällen dringender betrieblicher Belange muss der Arbeitgeber die Umstände des Einzelfalls betrachten und die widerstreitenden Interessen gegeneinander abwägen.
Kollidierende Urlaubswünsche von Arbeitnehmern
Ein besonders häufiges Problem ist, dass die Urlaubswünsche verschiedener Arbeitnehmer miteinander kollidieren. Die Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer rechtfertigen die Verweigerung des Urlaubs nur, wenn aus betrieblichen Gründen nicht jeder Urlaubswunsch erfüllt werden kann. Welcher Urlaubswunsch Vorrang hat, ist allein unter urlaubsrechtlichen Gesichtspunkten zu bewerten. Dazu zählen u.a. die Urlaubsmöglichkeit des Partners des Arbeitnehmers oder die Ferienzeit schulpflichtiger Kinder.
Die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer schulpflichtige Kinder hat, begründet jedoch nicht zwangsläufig einen Vorrang gegenüber Arbeitnehmern ohne Kinder; auch die bisherige Urlaubsgewährung und die Dauer der Betriebszugehörigkeit sind zu berücksichtigen.
Für den seltenen Fall, dass der Arbeitnehmer keine Urlaubswünsche angibt, ist der Arbeitgeber berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Urlaubszeitraum von sich aus zu bestimmen. Der Arbeitnehmer ist aber nicht gezwungen sich an die Vorgaben seines Arbeitgebers zu halten. Er kann auch dann noch seine Wünsche äußern und den vom Arbeitgeber festgelegten Urlaub ablehnen.
Dauer des Urlaubs
Das Bundesurlaubsgesetz sieht einen jährlichen Mindesturlaub von 24 Werktage vor. Es geht dabei von einer sechs-Tage-Woche aus. Bei weniger Arbeitstagen von fünf Tagen verringert sich die gesetzliche Mindestanzahl entsprechend: Bei einer wöchentlichen Arbeitsleistung von fünf Tagen ergibt sich ein MIndesturlaub bon 20 Tagen.
Der Gesetzgeber geht grundsätzlich von einer zusammenhängenden Gewährung des Urlaubs aus. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer seinen Urlaub zusammenhängend zu gewähren, soweit nicht dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubsanteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen. Der Arbeitnehmer muss selbstverständlich nicht immer mindestens zwölf Werktage am Stück nehmen, sondern kann seinen Urlaub freiwillig stückeln.
Rückgängigmachung des Urlaubs
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich an seine Entscheidung, dem Arbeitnehmer für einen bestimmten Zeitraum Urlaub zu gewähren, gebunden. Gesetzlich ist keine Rückgängigmachung in Form eines Widerrufs vor Beginn des Urlaubs oder ein Rückruf während des Urlaubs vorgesehen. Auch die Rechtsprechung geht sehr restriktiv mit diesem Thema um:
Es ist anerkannt, dass eine einvernehmliche Rückgängigmachung möglich ist, z.B. weil sich die Urlaubspläne des Arbeitnehmers geändert haben. Der Arbeitgeber kann den Urlaub nur in absoluten Notfällen oder wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber bzgl. des Urlaubsanspruchs arglistig getäuscht hat, widerrufen.
Diese Grundsätze kann der Arbeitgeber auch nicht durch vertragliche Regelungen ausschließen. Eine Abrede zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer während seines Urlaubs zurückrufen kann, ist unwirksam.
Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld
Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld werden häufig verwechselt. Das Urlaubsentgelt betrifft den gewöhnlichen Lohnanspruch, der während des Urlaubs des Arbeitnehmers fortbesteht. Dieser bemisst sich an dem Durchschnitt des Arbeitseinkommens der letzten 13 Wochen vor dem Urlaub. Bei der Bemessung bleiben Überstunden und Kürzungen etwa aufgrund von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen o.ä. außer Betracht.
Urlaubsgeld ist eine darüber hinausgehende Bezahlung, die gesetzlich nicht vorgesehen ist, aber aufgrund von tarifvertraglichen, betrieblichen oder individualvertraglichen Regelungen zusätzlich gezahlt werden kann.
Weitere Informationen zum Thema "Urlaubsrecht" erhalten Sie unter Dok.-Nr. 25359.
Stand: Juli 2025