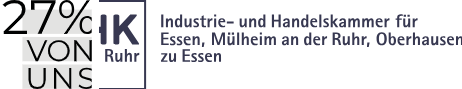Strompreis-Umlagen-Rechner
Der IHK-Strompreis-Umlagen-Rechner ist aktualisiert worden. Damit können Unternehmen und Bürger selbst errechnen, wie viel sie für die Umlagen für Erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, Offshore-Haftung, abschaltbare Lasten und atypische Netznutzung zahlen müssen. Seit vielen Jahren bieten die Industrie- und Handelskammern das von der IHK Detmold bereitgestellte Excel-Tool kostenfrei an.