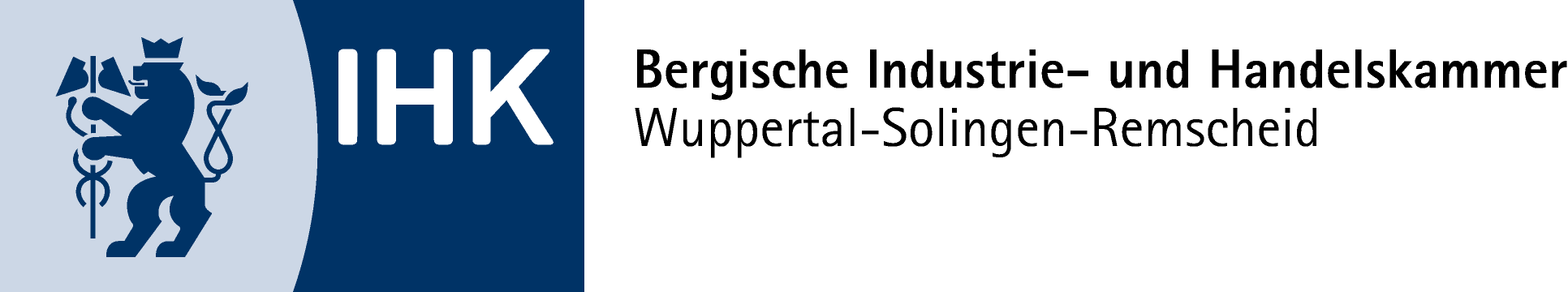Finanzierungsformen der Verkehrswege
Finanzierungsformen für Verkehrsinfrastruktur
Finanzierung aus Steuern
Die Verkehrsinfrastrukturinvestitionen werden aus Haushaltsmitteln von Bund, Ländern und Kommunen bezahlt. Gleichzeitig wird z.B. der Kraftfahrzeugverkehr zur Steuerzahlung (Kfz-Steuer, Mineralölsteuer, Ökosteuer etc.) verpflichtet. Diese Steuereinnahmen, die die Wegekosten des Kraftfahrzeugverkehrs erheblich überschreiten, fließen aber - entsprechend der traditionellen finanzwirtschaftlichen Lehre (Non-Affektationsprinzip) - nicht zweckgebunden in den allgemeinen Staatshaushalt. Der Umfang der Investitionen in Verkehrswege ist deshalb ständig abhängig von den - vielen Einflüssen ausgesetzten - jährlichen Haushaltsbeschlüssen der Parlamente.
Finanzierung über Gebühren/Entgelte
Zeitbezogene Benutzungsgebühren (Lkw-Autobahngebühr / Vignette)
Die zeitbezogene Autobahngebühr wird nicht wie eine Maut vor Ort erhoben, sondern in Form einer Plakette für einen bestimmten Zeitraum erworben. Dieses wenig flexible Instrument berücksichtigt keine Fahrleistungen und ist vom Erfassungsaufwand gering.
Streckenabhängige Straßenbenutzungsgebühren (Road-Pricing/Maut)
Road-Pricing ist ein Instrument zur Lenkung der Nachfrage über den Preis. Die Hauptfunktion liegt in der Steuerung der Nachfrage nach Verkehrsinfrastrukturleistungen im Sinne einer effizienten Nutzung der Infrastruktur. Die Infrastrukturkosten sollen streckenbezogen und nutzungsabhängig dem Verursacher angelastet werden. Seit dem 1. Januar 2005 werden in Deutschland fahrleistungsabhängige Gebühren (Maut für schwere Lkw) erhoben. Die Einnahmen aus diesen Gebühren werden zweckgebunden für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur verwendet.
Finanzierung aus Steuern
Die Verkehrsinfrastrukturinvestitionen werden aus Haushaltsmitteln von Bund, Ländern und Kommunen bezahlt. Gleichzeitig wird z.B. der Kraftfahrzeugverkehr zur Steuerzahlung (Kfz-Steuer, Mineralölsteuer, Ökosteuer etc.) verpflichtet. Diese Steuereinnahmen, die die Wegekosten des Kraftfahrzeugverkehrs erheblich überschreiten, fließen aber - entsprechend der traditionellen finanzwirtschaftlichen Lehre (Non-Affektationsprinzip) - nicht zweckgebunden in den allgemeinen Staatshaushalt. Der Umfang der Investitionen in Verkehrswege ist deshalb ständig abhängig von den - vielen Einflüssen ausgesetzten - jährlichen Haushaltsbeschlüssen der Parlamente.
Finanzierung über Gebühren/Entgelte
Zeitbezogene Benutzungsgebühren (Lkw-Autobahngebühr / Vignette)
Die zeitbezogene Autobahngebühr wird nicht wie eine Maut vor Ort erhoben, sondern in Form einer Plakette für einen bestimmten Zeitraum erworben. Dieses wenig flexible Instrument berücksichtigt keine Fahrleistungen und ist vom Erfassungsaufwand gering.
Streckenabhängige Straßenbenutzungsgebühren (Road-Pricing/Maut)
Road-Pricing ist ein Instrument zur Lenkung der Nachfrage über den Preis. Die Hauptfunktion liegt in der Steuerung der Nachfrage nach Verkehrsinfrastrukturleistungen im Sinne einer effizienten Nutzung der Infrastruktur. Die Infrastrukturkosten sollen streckenbezogen und nutzungsabhängig dem Verursacher angelastet werden. Seit dem 1. Januar 2005 werden in Deutschland fahrleistungsabhängige Gebühren (Maut für schwere Lkw) erhoben. Die Einnahmen aus diesen Gebühren werden zweckgebunden für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur verwendet.
Private Vorfinanzierung (Konzessionsmodell)
Eine private Vorfinanzierung findet bislang bei 27 Bundesfernstraßenmaßnahmen und in Nordrhein-Westfalen auch bei zwei Landesstraßen statt. Dazu gehört auch der Tunnel Burgholz (L 418) in Wuppertal als Teil der Wuppertaler Südtangente der im März 2006 für den Verkehr freigegeben wurde. Im Bereich der Schienenwege wird das Vorhaben Nürnberg - Ingolstadt - München durch die DB AG vorfinanziert. Neue Vorfinanzierungen werden derzeit jedoch nicht vorgenommen, da die Refinanzierung durch Haushaltsmittel in Anbetracht der sonstigen Verpflichtungen der Verkehrshaushalte die Handlungsspielräume auf Jahre zusätzlich einengen würden.
Mitfinanzierung
Eine Mitfinanzierung von Bundesprojekten durch das jeweilige Land erfolgt nur in Einzelfällen, wenn das Landesinteresse eindeutig dominiert. In Nordrhein-Westfalen gibt es derartige Fälle bislang nicht.
Betreibermodelle
Eine weitere alternative Finanzierungsform sind Betreibermodelle, bei denen wesentliche Aufgaben (Finanzierung, Bau, Betrieb, Erhaltung) an Private übertragen werden. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) wendet das Betreibermodell inzwischen in zwei unterschiedlichen Formen an:
1. Betreibermodell für den mehrstreifigen Autobahnausbau (A-Modell):
Private übernehmen für bestimmte stark belastete Autobahnen den mehrstreifigen Ausbau ("6er-Modell"). Dieses Modell ist Teil des BMVBW-Programms "Bauen jetzt - Investitionen beschleunigen". Zur weiteren Umsetzung ist kein eigenes Bundesgesetz nötig. Es genügt das Einvernehmen mit dem jeweiligen Bundesland.
Dieses Modell wird durch folgenden Merkmale geprägt:
Der Ausbau zusätzlicher Fahrstreifen, die Erhaltung (aller Fahrstreifen), der Betrieb (aller Fahrstreifen) und die Finanzierung werden an einen Privaten übertragen.
Das Gebührenaufkommen der schweren Lkw im auszubauenden Streckenabschnitt wird für eine Weiterleitung an den Privaten vorgesehen.
Die durch die Nutzung der Pkw/leichten Lkw entstehenden Infrastrukturkosten werden in Form einer Anschubfinanzierung (ca. 50 Prozent der sonst üblichen Baukosten) aus dem Straßenbauhaushalt des Bundes aufgebracht.
Seit Einführung der LKW-Maut zum 1. Januar 2005 wird der sechsstreifige Ausbau der A 8 zwischen München und Augsburg als erstes von bundesweit fünf Pilotprojekten realisiert.
Eine private Vorfinanzierung findet bislang bei 27 Bundesfernstraßenmaßnahmen und in Nordrhein-Westfalen auch bei zwei Landesstraßen statt. Dazu gehört auch der Tunnel Burgholz (L 418) in Wuppertal als Teil der Wuppertaler Südtangente der im März 2006 für den Verkehr freigegeben wurde. Im Bereich der Schienenwege wird das Vorhaben Nürnberg - Ingolstadt - München durch die DB AG vorfinanziert. Neue Vorfinanzierungen werden derzeit jedoch nicht vorgenommen, da die Refinanzierung durch Haushaltsmittel in Anbetracht der sonstigen Verpflichtungen der Verkehrshaushalte die Handlungsspielräume auf Jahre zusätzlich einengen würden.
Mitfinanzierung
Eine Mitfinanzierung von Bundesprojekten durch das jeweilige Land erfolgt nur in Einzelfällen, wenn das Landesinteresse eindeutig dominiert. In Nordrhein-Westfalen gibt es derartige Fälle bislang nicht.
Betreibermodelle
Eine weitere alternative Finanzierungsform sind Betreibermodelle, bei denen wesentliche Aufgaben (Finanzierung, Bau, Betrieb, Erhaltung) an Private übertragen werden. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) wendet das Betreibermodell inzwischen in zwei unterschiedlichen Formen an:
1. Betreibermodell für den mehrstreifigen Autobahnausbau (A-Modell):
Private übernehmen für bestimmte stark belastete Autobahnen den mehrstreifigen Ausbau ("6er-Modell"). Dieses Modell ist Teil des BMVBW-Programms "Bauen jetzt - Investitionen beschleunigen". Zur weiteren Umsetzung ist kein eigenes Bundesgesetz nötig. Es genügt das Einvernehmen mit dem jeweiligen Bundesland.
Dieses Modell wird durch folgenden Merkmale geprägt:
Der Ausbau zusätzlicher Fahrstreifen, die Erhaltung (aller Fahrstreifen), der Betrieb (aller Fahrstreifen) und die Finanzierung werden an einen Privaten übertragen.
Das Gebührenaufkommen der schweren Lkw im auszubauenden Streckenabschnitt wird für eine Weiterleitung an den Privaten vorgesehen.
Die durch die Nutzung der Pkw/leichten Lkw entstehenden Infrastrukturkosten werden in Form einer Anschubfinanzierung (ca. 50 Prozent der sonst üblichen Baukosten) aus dem Straßenbauhaushalt des Bundes aufgebracht.
Seit Einführung der LKW-Maut zum 1. Januar 2005 wird der sechsstreifige Ausbau der A 8 zwischen München und Augsburg als erstes von bundesweit fünf Pilotprojekten realisiert.
2. Betreibermodell gemäß Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (F-Modell):
Der Bau, die Erhaltung, der Betrieb und die Finanzierung von Bundesstraßen können gemäß Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz seit 1994 auch an Private übertragen werden. Allerdings ist dieses Betreibermodell auf den Neubau von Brücken, Tunnel und Gebirgspässen von Bundesfernstraßen sowie auf mehrstreifige Bundesstraßen mit getrennten Fahrbahnen für den Richtungsverkehr beschränkt. Zur Refinanzierung der Maßnahme erhält der private Betreiber das Recht, Mautgebühren zu erheben. Der Bund leistet dazu eine Anschubfinanzierung von bis zu 20 Prozent der Baukosten, falls das Projekt in den vordringlichen Bedarf des Bundesfernstraßenbedarfsplans eingestuft ist. Vorteil dieses Betreibermodells ist, dass Projekte, die aus herkömmlicher Haushaltsfinanzierung heraus auf absehbare Zeit nicht zu realisieren sind, schnell gebaut werden können.