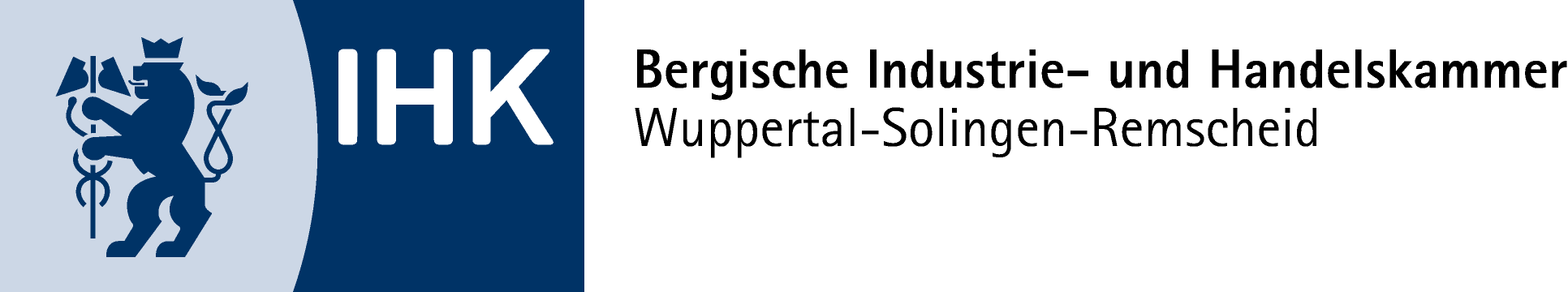Produkthaftung
Produkthaftung
Allgemeines
Unter dem Begriff „Produkthaftung“ verbirgt sich die Verantwortlichkeit des Herstellers einer Sache für Schäden, die bei der Benutzung dieses Produktes entstehen. Die wichtigste Anspruchsgrundlage für einen geschädigten Verbraucher ist das Produkthaftungsgesetz, das aufgrund einer EWG-Richtlinie erlassen wurde. Vergleichbare Rechtsvorschriften existieren somit auch in den übrigen Ländern der Europäischen Union. Neben diesem Gesetz kommen im Einzelfall weitere vertragliche oder gesetzliche Haftungsvorschriften in Betracht.
Unter dem Begriff „Produkthaftung“ verbirgt sich die Verantwortlichkeit des Herstellers einer Sache für Schäden, die bei der Benutzung dieses Produktes entstehen. Die wichtigste Anspruchsgrundlage für einen geschädigten Verbraucher ist das Produkthaftungsgesetz, das aufgrund einer EWG-Richtlinie erlassen wurde. Vergleichbare Rechtsvorschriften existieren somit auch in den übrigen Ländern der Europäischen Union. Neben diesem Gesetz kommen im Einzelfall weitere vertragliche oder gesetzliche Haftungsvorschriften in Betracht.
Mit dem Produkthaftungsgesetz hat der Gesetzgeber eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung eingeführt. Der Hersteller ist auch dann verantwortlich, wenn ihm weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Außerdem verbietet das Gesetz dem Hersteller, die Ersatzpflicht in Vereinbarungen mit dem Verbraucher im voraus einzuschränken oder auszuschließen.
Anspruchsvoraussetzungen
Voraussetzung für die Haftung ist zunächst das Vorliegen eines fehlerhaften Produkts. Produkt ist jede bewegliche Sache, auch wenn sie Teil einer anderen Sache ist, sowie Elektrizität. Dieses Produkt muss einen Fehler aufweisen. Ein Fehler liegt dann vor, wenn das Produkt nicht die Sicherheit bietet, die der Verbraucher erwarten kann. Für die Frage der Erwartungshaltung wird auf die Sicht eines verständigen Verbrauchers abgestellt, wobei es insbesondere auf folgende Kriterien ankommt:
Voraussetzung für die Haftung ist zunächst das Vorliegen eines fehlerhaften Produkts. Produkt ist jede bewegliche Sache, auch wenn sie Teil einer anderen Sache ist, sowie Elektrizität. Dieses Produkt muss einen Fehler aufweisen. Ein Fehler liegt dann vor, wenn das Produkt nicht die Sicherheit bietet, die der Verbraucher erwarten kann. Für die Frage der Erwartungshaltung wird auf die Sicht eines verständigen Verbrauchers abgestellt, wobei es insbesondere auf folgende Kriterien ankommt:
- Darbietung des Produkts
In Bedienungsanleitungen, sonstigen Produktbeschreibungen, Hinweisen auf Ware und Verpackung und Werbeaussagen wird dem Verbraucher das Produkt dargestellt. Wichtig ist, dass der Kunde die Erklärungen nicht missverstehen kann. Deswegen ist eine wahre, genaue und ausführliche Gebrauchsanweisung von besonderer Bedeutung. - Gebrauch des Produkts, mit dem billigerweise gerechnet werden kann
Das Produkt muss für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, aber auch für damit zusammenhängende und vorhersehbare Behandlungen, ausreichend sicher sein. Für einen nicht vorhersehbaren, missbräuchlichen Fehlgebrauch haftet der Hersteller aber nicht. - Zeitpunkt des Inverkehrbringens
Entscheidend ist schließlich auch der Zeitpunkt, zu dem das Produkt in den Verkehr gebracht wird. Wenn sich erst später das Maß an Sicherheit verschärft, z.B. durch neue Techniken, dann soll dies dem Hersteller nicht rückwirkend zur Last zu legen sein. Wohl aber wird er seine neuen Produkte dem Stand anpassen müssen.
Durch den Fehler muss entweder ein Mensch getötet oder verletzt oder eine (andere) Sache beschädigt worden sein, die für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt ist und verwendet wurde. Das Gesetz erfasst also nicht solche Sachen, die betrieblich verwendet werden.
Haftungsausschluss
Unter bestimmten Umständen ist der Hersteller von der Haftung befreit. Das ist der Fall, wenn:
Unter bestimmten Umständen ist der Hersteller von der Haftung befreit. Das ist der Fall, wenn:
- er das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat, d. h. nicht in die Verteilerkette gebracht oder einer anderen Person außerhalb der Herstellersphäre übergeben hat;
- der Fehler erst später entstanden ist, z. B. durch weitere Bearbeitung oder durch unfachmännische Behandlung durch den Verbraucher;
- die fehlerhafte Sache nicht zu wirtschaftlichen Zwecken hergestellt und vertrieben wurde
(z. B. Hobbybastler); - der Hersteller das Produkt streng nach gesetzlichen Vorschriften hergestellt hat oder den Fehler nach dem allgemeinen und objektiven (nicht dem subjektiven) Stand der Wissenschaft und Technik nicht erkennen konnte, als er es in den Verkehr brachte.
- Der Zulieferer wird dann von einer Haftung befreit, wenn er das Teilprodukt nach den Vorgaben des Bestellers hergestellt hat oder der Fehler erst durch den Einbau in das Endprodukt entstanden ist.
Herstellerhaftung
Schadensersatzpflichtig ist der Hersteller des Produktes. Das Gesetz fasst diesen Begriff aber sehr weit. „Hersteller“ im Sinne dieser Vorschriften sind:
Schadensersatzpflichtig ist der Hersteller des Produktes. Das Gesetz fasst diesen Begriff aber sehr weit. „Hersteller“ im Sinne dieser Vorschriften sind:
- der Hersteller im eigentlichen Sinne, also derjenige, der das Endprodukt hergestellt hat, auch wenn er das Produkt nur aus Einzelteilen zusammengestellt hat;
- der Hersteller eines Teilprodukts, Grundstoffs oder Materials, wenn das von ihm gelieferte Teilprodukt fehlerhaft war;
- der sog. Quasi-Hersteller; das ist derjenige, der das Produkt unter seinem Namen, seiner Marke oder sonstigem Zeichen in den Verkehr bringt;
- der Importeur, der die Sache in den Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums (EU-Staaten zuzüglich Norwegen, Liechtenstein und Island) einführt;
- der Händler, soweit der Hersteller nicht erkennbar ist und er weder diesen noch seinen Vorlieferanten innerhalb eines Monats benennt.
Alle „Hersteller“ haften jeweils auf den vollen Schaden, auch wenn mehrere gleichzeitig haftbar sind. Der Geschädigte kann sich einen beliebigen aussuchen. Im Innenverhältnis findet dann ein Ausgleich nach den Anteilen der Verursachung statt.
Beweisfragen
Der Geschädigte muss den Fehler, den Schaden und den Ursachenzusammenhang zwischen Fehler und Schaden beweisen. Er braucht aber nur nachzuweisen, dass im Zeitpunkt des Schadens ein Fehler vorliegt und nicht etwa, wann der Fehler entstanden ist. Kann er dies, ist die Haftung des Herstellers begründet. Der Hersteller trägt die Beweislast für mögliche Entlastungsgründe. Der Zulieferer kann sich außerdem entlasten, indem er beweist, dass der Fehler erst durch den Einbau in ein Endprodukt oder durch die Anweisung des Herstellers entstanden ist.
Der Geschädigte muss den Fehler, den Schaden und den Ursachenzusammenhang zwischen Fehler und Schaden beweisen. Er braucht aber nur nachzuweisen, dass im Zeitpunkt des Schadens ein Fehler vorliegt und nicht etwa, wann der Fehler entstanden ist. Kann er dies, ist die Haftung des Herstellers begründet. Der Hersteller trägt die Beweislast für mögliche Entlastungsgründe. Der Zulieferer kann sich außerdem entlasten, indem er beweist, dass der Fehler erst durch den Einbau in ein Endprodukt oder durch die Anweisung des Herstellers entstanden ist.
Haftungsumfang, Erlöschen und Verjährung
Bei Personenschäden ist die Ersatzpflicht für denselben Fehler auf insgesamt 85 Millionen € begrenzt; der Verantwortliche muss die Heilungskosten und sonstige Vermögensnachteile ersetzen sowie Schmerzensgeld bezahlen. Sachschäden sind nicht begrenzt, doch muss der Geschädigte eine Selbstbeteiligung bis 500 € übernehmen. Kennt der Geschädigte den Schaden, den Fehler und die Person des Ersatzpflichtigen, muss er den Anspruch innerhalb von drei Jahren geltend machen, sonst ist er verjährt. Außerdem erlischt der Produkthaftungsanspruch nach zehn Jahren seit Inverkehrbringen des Produkts, soweit nicht ein Verfahren bereits anhängig oder entschieden ist.
Bei Personenschäden ist die Ersatzpflicht für denselben Fehler auf insgesamt 85 Millionen € begrenzt; der Verantwortliche muss die Heilungskosten und sonstige Vermögensnachteile ersetzen sowie Schmerzensgeld bezahlen. Sachschäden sind nicht begrenzt, doch muss der Geschädigte eine Selbstbeteiligung bis 500 € übernehmen. Kennt der Geschädigte den Schaden, den Fehler und die Person des Ersatzpflichtigen, muss er den Anspruch innerhalb von drei Jahren geltend machen, sonst ist er verjährt. Außerdem erlischt der Produkthaftungsanspruch nach zehn Jahren seit Inverkehrbringen des Produkts, soweit nicht ein Verfahren bereits anhängig oder entschieden ist.
Maßnahmen zur Risikobegrenzung
Die Haftung ist zwar verschuldensunabhängig. Durch geeignete Maßnahmen kann aber das Risiko der Inanspruchnahme vermindert werden. Das kann beispielsweise die Einführung eines Qualitätssicherungssystems, die regelmäßige Überwachung von Betriebsabläufen, die gewissenhafte Auswahl der Grundprodukte und der Zulieferer sein. Das gilt vor allem für Importeure und „Quasi-Hersteller“. Händlern ist anzuraten, die Herkunft der Waren zu dokumentieren. Wichtig sind die ständige Beobachtung der Entwicklung von Wissenschaft und Technik, aber auch die Beachtung von Kundenreklamationen und Testergebnissen. Gebrauchsanweisungen und Betriebsanleitungen müssen sorgfältig formuliert werden, die Werbung darf keine missverständlichen Zusicherungen oder falschen Versprechungen enthalten. Auch die am Vertrieb des Produkts Beteiligten (Handelsvertreter, Groß- und Einzelhandel) sollten gut informiert sein. Hinzu kommt die Dokumentation des Zeitpunkts, zu dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde. Schließlich ist zu empfehlen, eine Haftpflicht-Versicherung abzuschließen.
Die Haftung ist zwar verschuldensunabhängig. Durch geeignete Maßnahmen kann aber das Risiko der Inanspruchnahme vermindert werden. Das kann beispielsweise die Einführung eines Qualitätssicherungssystems, die regelmäßige Überwachung von Betriebsabläufen, die gewissenhafte Auswahl der Grundprodukte und der Zulieferer sein. Das gilt vor allem für Importeure und „Quasi-Hersteller“. Händlern ist anzuraten, die Herkunft der Waren zu dokumentieren. Wichtig sind die ständige Beobachtung der Entwicklung von Wissenschaft und Technik, aber auch die Beachtung von Kundenreklamationen und Testergebnissen. Gebrauchsanweisungen und Betriebsanleitungen müssen sorgfältig formuliert werden, die Werbung darf keine missverständlichen Zusicherungen oder falschen Versprechungen enthalten. Auch die am Vertrieb des Produkts Beteiligten (Handelsvertreter, Groß- und Einzelhandel) sollten gut informiert sein. Hinzu kommt die Dokumentation des Zeitpunkts, zu dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde. Schließlich ist zu empfehlen, eine Haftpflicht-Versicherung abzuschließen.