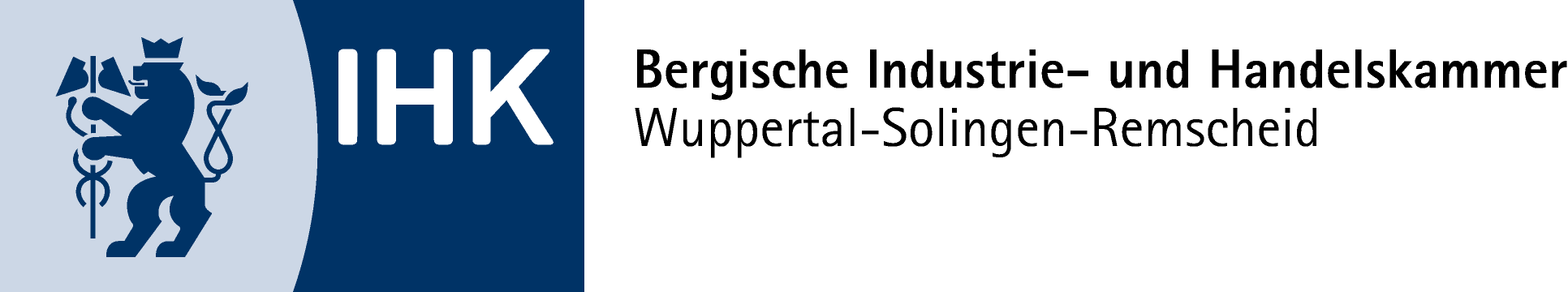Das neue Sanierungs- und Insolvenzrecht
Bislang hat fast jedes Unternehmen in der Krise den Insolvenzantrag zu spät gestellt. Angst vor Kontrollverlust über das eigene Unternehmen und davor, dass ein unbekannter, faktisch häufig nicht erreichbarer Insolvenzverwalter die Geschicke des Unternehmens steuert, waren häufig der Grund dafür. Das soll sich mit dem am 1. März 2012 in Kraft getretenen Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, kurz ESUG genannt, ändern. Sanierungsfähige Unternehmen erhalten eine realistische Möglichkeit zur Eigenverwaltung, Gläubiger sollen von Beginn an mehr in die Gestaltung des Insolvenzverfahrens eingebunden werden. Vor allem die folgenden wesentlichen Änderungen sollten Schuldner und Gläubiger kennen.
1. Vorläufiger Gläubigerausschuss
Nach bisherigem Recht konnte ein Gläubigerausschuss erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingesetzt werden. Künftig besteht die Möglichkeit, bereits im Eröffnungsverfahren - also gleich nach der Antragstellung - einen vorläufigen Gläubigerausschuss einzusetzen. Er muss vom Insolvenzgericht zwingend eingerichtet werden, wenn die Bilanzsumme des Unternehmens mindestens 4.840.000 Euro und der Umsatz mindestens 9.688.000 Euro betragen sowie das Unternehmen durchschnittlich 50 Arbeitnehmer beschäftigt. Nur zwei der drei Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein. Werden diese Schwellenwert nicht erreicht, kann auf Antrag des Schuldners oder eines Gläubigers ein vorläufiger Gläubigerausschuss eingesetzt werden.
2. Gläubigerbeteiligung bei der Verwalterbestellung
Nach bisherigem Recht war das Insolvenzgericht bei der Bestellung des Insolvenzverwalters grundsätzlich nicht an die Vorschläge der Gläubiger oder des Schuldners gebunden, sondern traf seine Entscheidung nach eigenem Ermessen. Die für die Gläubiger entscheidende Neuerung besteht künftig in dem Recht des vorläufigen Gläubigerausschusses, sich zu den Anforderungen, die an den Insolvenzverwalter zu stellen sind und zu dessen Person gegenüber dem Insolvenzgericht zu äußern. Einigt sich der Gläubigerausschuss auf einen Insolvenzverwalter, muss das Insolvenzgericht diesen bestellen, es sei denn, er wäre grundsätzlich ungeeignet. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn er in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Schuldner oder einem Gläubiger stehen würde. Im Übrigen hat das Gericht bei der Auswahl des Insolvenzverwalters die vom vorläufigen Gläubigerausschuss beschlossenen Anforderungen an die Person des Verwalters zu Grunde zu legen.
3. Eigenverwaltung
Bereits die 1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung hat das Sanierungsinstrument der Eigenverwaltung möglich gemacht, genutzt wurde es aber nur in wenigen Fällen. Dies lag zum einen daran, dass die Gläubiger der Eigenverwaltung ausdrücklich zustimmen mussten, zum anderen, dass Eigenverwaltung erst mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens angeordnet werden konnte. Künftig kann Eigenverwaltung bereits vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens angeordnet werden. Die Anordnung setzt nur noch voraus, dass der Schuldner Eigenverwaltung beantragt und keine Umstände bekannt sind, dass die Anordnung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird. Votiert der vorläufige Gläubigerausschuss für die Anordnung, wird vom Gesetz fingiert, dass es keine solchen Umstände gibt. Das Gericht bestimmt sodann einen so genannten vorläufigen Sachwalter, der nur eine überwachende Funktion hat. Die Sanierung kann also von der eigenen Geschäftsführung ohne Zustimmung eines Dritten (nach bisherigem Recht des vorläufigen Insolvenzverwalters) betrieben werden.
4. Schutzschirmverfahren
Gänzlich neu ist, dass der Schuldner neben der Eigenverwaltung einen so genannten Schutzschirm beantragen kann. Das heißt, der Schuldner erhält durch Beschluss des Gerichts die Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten unter Aufsicht eines vorläufigen Sachwalters und frei von Vollstreckungsmaßnahmen in Eigenverwaltung ein Sanierungskonzept auszuarbeiten, das anschließend als Insolvenzplan umgesetzt werden kann.
5. Insolvenzplanverfahren
Das Insolvenzplanverfahren macht es möglich, zur Gläubigerbefriedigung und zur Verteilung der Insolvenzmasse von den Vorschriften der Insolvenzordnung abweichende Regelungen zu treffen. Insolvenzpläne haben bereits in der Vergangenheit vielfach zu wesentlich besseren Quoten zu Gunsten der Gläubiger geführt. Ein wesentliches Hindernis für das Zustandekommen eines Insolvenzplanes war aber, dass die Anteilseigner (Gesellschafter) am Insolvenzplanverfahren nicht beteiligt waren. Ihre Rechte blieben vom Insolvenzplan unberührt, da es an einer Verknüpfung der Insolvenzplanregelungen zum Gesellschaftsrecht fehlte. Viele Insolvenzpläne scheiterten deshalb an den Widerständen der Altgesellschafter. Neu ist das sogenannte Debt-Equity-Swap. Danach können Gläubiger künftig ihre Forderungen in Gesellschaftsrechte am insolventen Unternehmen umwandeln und damit an der Zukunft des Unternehmens partizipieren. Durch eine moderate Beschränkung der Rechtsmittel gegen die Planbestätigung sollen Gläubiger des Weiteren künftig nicht mehr in rechtsmissbräuchlicher Weise das Wirksamwerden des Planes verhindern können.
Hinweis
Dieses Merkblatt soll als Service Ihrer IHK nur erste Hinweise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
Stand: Januar 2014
1. Vorläufiger Gläubigerausschuss
Nach bisherigem Recht konnte ein Gläubigerausschuss erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingesetzt werden. Künftig besteht die Möglichkeit, bereits im Eröffnungsverfahren - also gleich nach der Antragstellung - einen vorläufigen Gläubigerausschuss einzusetzen. Er muss vom Insolvenzgericht zwingend eingerichtet werden, wenn die Bilanzsumme des Unternehmens mindestens 4.840.000 Euro und der Umsatz mindestens 9.688.000 Euro betragen sowie das Unternehmen durchschnittlich 50 Arbeitnehmer beschäftigt. Nur zwei der drei Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein. Werden diese Schwellenwert nicht erreicht, kann auf Antrag des Schuldners oder eines Gläubigers ein vorläufiger Gläubigerausschuss eingesetzt werden.
2. Gläubigerbeteiligung bei der Verwalterbestellung
Nach bisherigem Recht war das Insolvenzgericht bei der Bestellung des Insolvenzverwalters grundsätzlich nicht an die Vorschläge der Gläubiger oder des Schuldners gebunden, sondern traf seine Entscheidung nach eigenem Ermessen. Die für die Gläubiger entscheidende Neuerung besteht künftig in dem Recht des vorläufigen Gläubigerausschusses, sich zu den Anforderungen, die an den Insolvenzverwalter zu stellen sind und zu dessen Person gegenüber dem Insolvenzgericht zu äußern. Einigt sich der Gläubigerausschuss auf einen Insolvenzverwalter, muss das Insolvenzgericht diesen bestellen, es sei denn, er wäre grundsätzlich ungeeignet. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn er in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Schuldner oder einem Gläubiger stehen würde. Im Übrigen hat das Gericht bei der Auswahl des Insolvenzverwalters die vom vorläufigen Gläubigerausschuss beschlossenen Anforderungen an die Person des Verwalters zu Grunde zu legen.
3. Eigenverwaltung
Bereits die 1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung hat das Sanierungsinstrument der Eigenverwaltung möglich gemacht, genutzt wurde es aber nur in wenigen Fällen. Dies lag zum einen daran, dass die Gläubiger der Eigenverwaltung ausdrücklich zustimmen mussten, zum anderen, dass Eigenverwaltung erst mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens angeordnet werden konnte. Künftig kann Eigenverwaltung bereits vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens angeordnet werden. Die Anordnung setzt nur noch voraus, dass der Schuldner Eigenverwaltung beantragt und keine Umstände bekannt sind, dass die Anordnung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird. Votiert der vorläufige Gläubigerausschuss für die Anordnung, wird vom Gesetz fingiert, dass es keine solchen Umstände gibt. Das Gericht bestimmt sodann einen so genannten vorläufigen Sachwalter, der nur eine überwachende Funktion hat. Die Sanierung kann also von der eigenen Geschäftsführung ohne Zustimmung eines Dritten (nach bisherigem Recht des vorläufigen Insolvenzverwalters) betrieben werden.
4. Schutzschirmverfahren
Gänzlich neu ist, dass der Schuldner neben der Eigenverwaltung einen so genannten Schutzschirm beantragen kann. Das heißt, der Schuldner erhält durch Beschluss des Gerichts die Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten unter Aufsicht eines vorläufigen Sachwalters und frei von Vollstreckungsmaßnahmen in Eigenverwaltung ein Sanierungskonzept auszuarbeiten, das anschließend als Insolvenzplan umgesetzt werden kann.
5. Insolvenzplanverfahren
Das Insolvenzplanverfahren macht es möglich, zur Gläubigerbefriedigung und zur Verteilung der Insolvenzmasse von den Vorschriften der Insolvenzordnung abweichende Regelungen zu treffen. Insolvenzpläne haben bereits in der Vergangenheit vielfach zu wesentlich besseren Quoten zu Gunsten der Gläubiger geführt. Ein wesentliches Hindernis für das Zustandekommen eines Insolvenzplanes war aber, dass die Anteilseigner (Gesellschafter) am Insolvenzplanverfahren nicht beteiligt waren. Ihre Rechte blieben vom Insolvenzplan unberührt, da es an einer Verknüpfung der Insolvenzplanregelungen zum Gesellschaftsrecht fehlte. Viele Insolvenzpläne scheiterten deshalb an den Widerständen der Altgesellschafter. Neu ist das sogenannte Debt-Equity-Swap. Danach können Gläubiger künftig ihre Forderungen in Gesellschaftsrechte am insolventen Unternehmen umwandeln und damit an der Zukunft des Unternehmens partizipieren. Durch eine moderate Beschränkung der Rechtsmittel gegen die Planbestätigung sollen Gläubiger des Weiteren künftig nicht mehr in rechtsmissbräuchlicher Weise das Wirksamwerden des Planes verhindern können.
Hinweis
Dieses Merkblatt soll als Service Ihrer IHK nur erste Hinweise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
Stand: Januar 2014