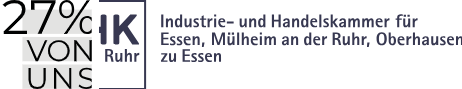Verkehr/Infrastruktur
Vorschläge der IHK
- Einführung des Jobtickets auch für KMUs
- Nachdrückliche und klare Signale aus der kommunalen Politik für eine Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur in der MEO-Region
- Zufahrtsbeschränkungen und -verbote kritisch hinterfragen
- Der Flughafen Essen/Mülheim ist in die Lage zu versetzen, die vom Markt nachgefragten Verkehrsangebote für eine Business-Aviation-Flotte auch schaffen zu können
- Schnelle Realisierung des RRX
Die MEO-Region profitiert dank ihrer zentralen Lage im Ballungsraum Ruhr und in Mitteleuropa von dem sehr dichten und weit verzweigten Verkehrsnetz, das die Ruhrregion erschließt. Mehr als elf Mio. Einwohner erreichen die MEO-Region innerhalb einer Reisezeit von einer Stunde mit dem Auto und mehr als neun Mio. Einwohner mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch im europaweiten Vergleich gehören Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen zu den am besten angeschlossenen Standorten. Allerdings kommt es vor allem im überregionalen Straßennetz der Region regelmäßig zu Staus durch nicht ausreichend leistungsfähige Verkehrsknoten, fehlende Lückenschlüsse und noch nicht beseitigte Engpässe. Ausweichverkehre führen dann zu temporären Überlastungen auch im nachgeordneten Straßennetz. Die grundsätzlich gute Erreichbarkeit der MEO-Region im Schienenpersonen- und Schienengüterverkehr leidet unter Engpässen und Qualitätsmängeln in der vorhandenen Eisenbahninfrastruktur. Das Angebot im öffentlichen Verkehr mit Bus und Bahn ist in zahlreichen Punkten für Berufspendler und Einzelhandelskunden nicht attraktiv genug im Vergleich zur Nutzung des eigenen Pkw.
Aktuelle Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums für das Jahr 2025 gehen weiterhin von einer erheblichen Zunahme des Verkehrsaufkommens insbesondere im Güterverkehr aus. Für eine prosperierende MEO-Region ist deshalb die Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur – auch im Ballungsraum Ruhrgebiet – unausweichlich. Das verlangt eine maßvolle Erweiterung des bestehenden Netzes. Es muss darum gehen, u. a. das bestehende Straßennetz zu stärken und an wichtigen Stellen zu ergänzen, wie den schon seit Jahren geforderten Lückenschluss der A52 zwischen dem Autobahndreieck Essen-Ost und der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Buer/West sowie den Ruhralleetunnel in Essen als Teilstück der Autobahn A44. Hierzu bedarf es aber nachdrücklicher und klarer Signale aus der kommunalen Politik.
Umsetzung wichtiger Verkehrsprojekte dringend notwendig
Ein hohes Entlastungspotenzial für den Straßenverkehr liegt in leistungsfähigeren Regionalbahnverbindungen zwischen dem Ruhrgebiet und der Rheinschiene. Die adäquate Lösung – auch für die MEO-Region – wäre der „Rhein-Ruhr-Express“. Seine Realisierung sollte deshalb zeitnäher als geplant erfolgen.
Eine an den Mobilitätsbedürfnissen der Wirtschaft und der Bevölkerung in der MEO-Region orientierte Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur ist allerdings kostenintensiv und erfordert zusätzliche finanzielle Mittel vom Bund und vom Land. Dabei steht die MEO-Region im Wettbewerb mit anderen regionalen Akteuren. Zusätzliche finanzielle Mittel zu akquirieren wird deshalb nur dann gelingen, wenn hiermit auch positive verkehrliche Auswirkungen für den Ballungsraum Ruhr, gegebenenfalls auch für Nordrhein-Westfalen, verbunden sind. Der von der Wirtschaft geforderte A52-Lückenschluss in Essen ist ein solches Beispiel. Die IHK bietet ihre Hilfe an, um eine deutlich stärkere Berücksichtigung der MEO-Region bei der Mittelzuweisung zu erreichen.
Anforderungen an ÖPNV/SPNV verändern sich
Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ergeben sich hinsichtlich der Folgen des demografischen Wandels besondere Herausforderungen. Zurückgehende Einwohner- und Schülerzahlen werden unter sonst gleichen Umständen auch die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verringern und zu sinkenden Einnahmen der Verkehrsunternehmen führen. Bis zum Jahre 2019 sieht sich die Stadt Essen mit einem Rückgang der Schülerzahlen mit 7,7 Prozent, Mülheim an der Ruhr mit 12,9 Prozent und Oberhausen sogar mit 14,6 Prozent konfrontiert. Gleichzeitig nimmt der Investitionsbedarf zur Anpassung des öffentlichen Verkehrsangebotes an die Bedürfnisse der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Gruppe älterer Menschen zu. Aber nicht nur für diese Zielgruppe ist das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement in der MEO-Region (Verkehrsleitsysteme, Mobilitätsberatung, zielgruppenspezifische Mobilitätsangebote) konsequent weiter zu entwickeln. Durch Einführung bzw. Ausweitung eines nutzerorientierten Qualitätsmanagementkonzeptes, das zu einer spürbaren Steigerung der Service- und Bedienungsqualität und hohen Kundenzufriedenheit führt, lassen sich auch neue Kunden für den ÖPNV gewinnen. Berufspendler könnten, sofern sie in größerer Zahl vom Auto auf den ÖPNV umsteigen, die durch zurückgehende Schülerzahlen entstehende Nachfragelücke teilweise ausgleichen. Jobtickets mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis auch für kleine und mittelständische Unternehmen mit 2 bis 49 Beschäftigten könnten den „Run“ auf die öffentlichen Verkehrsmittel verstärken. Die IHK bietet an, hierfür bei ihren Mitgliedsunternehmen zu werben und sich als „Dachorganisation“ an der Umsetzung eines solchen Projektes aktiv zu beteiligen.
ÖPNV und öffentliche Vermietsysteme besser vernetzen
Für die Städte in der MEO-Region ist die flächendeckende Gewährleistung einer emissionsarmen, zuverlässigen und kostengünstigen Mobilität eine zentrale Herausforderung. Hierzu gehört, das ÖPNV-Liniennetz auch an neue Gewerbe- und Einkaufsstandorte nachfrageorientiert anzupassen und ggf. neu auszurichten. Kommunale Grenzen dürfen nicht mehr, wie zwischen Essen und Oberhausen bei der Straßenbahnlinie 105, den Linienweg bestimmen. Der verstärkte Ausbau von multimodalen Umsteigemöglichkeiten könnte ein wichtiger ergänzender Beitrag auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität sein. Beispielsweise wäre die Umsetzung eines flächendeckenden Netzes von flexibel mietbaren Elektromobilen innerhalb der MEO-Region vorstellbar. Aber auch die stärkere Vernetzung von Fahrrad-Vermietsystemen oder Carsharing mit dem ÖPNV ist weiter voranzutreiben. Diese Maßnahmen könnten einerseits dazu beitragen, Teile des Berufspendleraufkommens von der Straße auf den ÖPNV zu verlagern und dadurch Belastungen auf den Autobahnen oder anderen wichtigen Straßen zu reduzieren. Andererseits garantiert eine gute Auslastung das Funktionieren eines multimodalen Systems und kann so Mobilitätsbedürfnisse von Menschen aller Altersgruppen befriedigen.
Bedarfsgerechter Ausbau kommunaler Straßennetze
Auch bei positiver Weiterentwicklung des ÖPNV wird zukünftig ein erheblicher Anteil des Verkehrs mit dem Kraftfahrzeug abgewickelt werden. Nicht zuletzt unter dem Aspekt der Emissionsreduzierung ist im Zuge aller Maßnahmen das Ziel eines möglichst reibungslosen Verkehrsflusses anzustreben. Die innerstädtischen Zentren in der MEO-Region müssen mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar bleiben.
Die bewusste Herbeiführung von Verkehrswiderständen, etwa mit der Zielsetzung, den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu forcieren, hat sich als untaugliches Instrument erwiesen. Hierzu gehört auch die gezielte Verknappung eines zentrumsnahen Parkraumangebots. Vor diesem Hintergrund ist auch die flächendeckende Umweltzone Ruhr weiterhin kritisch zu beurteilen. Derartige Zufahrtsbeschränkungen und -verbote verteuern den Verkehr für Wirtschaft und Bevölkerung. Sie führen zu unerwünschten Verlagerungseffekten in nachrangige Straßennetze mit entsprechenden negativen Folgen für die Umwelt und die Verkehrssicherheit.
Auch Maßnahmen zur Verteuerung des innerstädtischen Verkehrs etwa durch eine sog. City-Maut sind kontraproduktiv. Sie würden den innerstädtischen Einzelhandel schwächen und Ansiedlungen „auf der grünen Wiese“ fördern. Dies widerspricht den geltenden städtebaulichen Zielen der Landesplanung in NRW. Stattdessen müssen die finanziellen Mittel für den Erhalt und den bedarfsgerechten Ausbau kommunaler Verkehrsinfrastrukturen in den Städten der MEO-Region gesichert und erhöht werden.
Flughafen Essen/Mülheim wird sich auf Marktveränderungen einstellen müssen
Der Flughafen Essen/Mülheim kann seine Potenziale unter den aktuellen genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die heimische Wirtschaft als Business-Airport nicht ausspielen, weil ein Düsenflugverbot und die fehlende Instrumentierung dies verhindern. Doch die Qualität der Verkehrsinfrastruktur wird in der Zukunft Standortentscheidungen immer stärker beeinflussen.
Es ist jedoch erkennbar, dass der Markt des Business-Flugverkehrs vor einem nachhaltigen Umbruch steht: Die Marktreife der sog. leichten Jet-Flugzeuge, die zu deutlich geringeren Kosten bei Investitionen und Betrieb fast alle wesentlichen Ziele im europäischen Umland erreichen können, ist gestiegen. Dies wird zu einer völligen Veränderung der Fluggewohnheiten führen. Da moderne Jet-Flugzeuge nicht nur den Management-Bedürfnissen entsprechen, sondern darüber hinaus aufgrund ihrer geringen Geräuschemissionen nicht mehr mit den bisherigen Maschinen vergleichbar sind, müsste die Stationierung einer solchen Flotte der Business-Aviation auch für die Kritiker eines regulären Flugbetriebs akzeptabel sein.
Die MEO-Region verfügt mit dem auf der Stadtgrenze Essen/Mülheim gemeinsam von beiden Städten betriebenen Flughafen über ideale Voraussetzungen, eine „Private Air“ zugunsten der hier ansässigen weltweit agierenden Konzerne und Mittelständler zu entwickeln. Der Standort ist ohne Verkehrsstaus zügig zu erreichen, und es sind reichlich Slots – also Zeitfenster für Starts und Landungen – vorhanden, die auf dem ansonsten in Betracht kommenden internationalen Flughafen Düsseldorf immer schwerer zu erhalten sind. Ein weiterer großer Nachteil eines internationalen Flughafens wie Düsseldorf, nämlich die Einbeziehung der „Private Air“ in die mittlerweile zeitaufwändigen Sicherheitsvorkehrungen, die neben den genannten Slots die Vorteile des privaten Flugverkehrs oft aufheben, würde hier weitgehend entfallen.
Gegen eine potenzielle Schließung des Flughafens Essen/Mülheim spricht zusätzlich, dass nicht nur durch die Kategorie der Very-Light-Jets in den nächsten Jahren große Veränderungen in der Business-Aviation zu erwarten sind, sondern dass in einigen Jahren als Ergebnis der weltweit stattfindenden Forschung elektrische bzw. hybrid-elektrische Antriebskonzepte für Flugzeuge einsetzbar sein werden, die auch in Essen/Mülheim „Grünes Fliegen“ ermöglichen. Auf diese Marktveränderung, die zunächst kleine Flugzeuge betrifft, sollte sich der Flughafen Essen/Mülheim mit Unterstützung seiner Gesellschafter intensiv vorbereiten.
Gelände des Flughafens auch für alternative Nutzungen attraktiv
Wird von den Flughafengesellschaftern die Neuausrichtung des Flughafens auf den gehobenen Geschäftsreiseverkehr abgelehnt, sollte über eine Folgenutzung nachgedacht werden. Hierbei sollten auch die klimatischen Aspekte berücksichtigt werden. Die Innenstädte von Mülheim an der Ruhr und Essen sind gut zu erreichen, die benachbarte A52 und der nahe Düsseldorfer Flughafen gewährleisten eine sehr gute Verkehrsanbindung des Areals. Die Umwandlung von Teilen des 140 ha großen Flughafengeländes in Flächen für nicht störendes Gewerbe und in ein allgemeines Wohngebiet könnte zusätzlichen Wohnraum in guter Lage und neue Gewerbeansiedlungsmöglichkeiten mit Autobahnanschluss schaffen. Zu einer erfolgreichen und zukunftsfähigen Umwandlung gehört dann auch eine Anbindung an den ÖPNV.