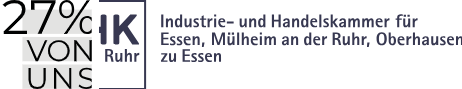Einleitung
Der demografische Wandel wird auch die MEO-Region mit den Städten Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen in den nächsten Jahren erheblich prägen. Nach einer Befragung der Industrie- und Handelskammer zu Essen (IHK) im August 2011 bei Unternehmen aller Branchen zu der Bedeutung kommender sog. Megatrends bewerteten diese den demografischen Wandel als den wichtigsten. Gleichzeitig waren sie der Ansicht, dass die MEO-Region von allen Herausforderungen hier am schlechtesten aufgestellt ist.
Aus diesem Anlass hat die IHK ein Strategiepapier erarbeitet, das sich in erster Linie an Politik, Verwaltung und Wirtschaft der MEO-Region richtet. Es basiert auf dem bereits 2009 von der Vollversammlung beschlossenen Handlungsprogramm. Wir möchten motivieren, sich intensiv mit den aktuellen Herausforderungen des demografischen Wandels zu befassen und übergreifende, abgestimmte Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
2030 leben in der MEO-Region rd. 57.000 Menschen weniger
Insgesamt wird die Bevölkerungszahl in den drei Städten nach Zahlen der Bertelsmann Stiftung von rd. 957.000 Einwohnern im Jahr 2009 um 5,9 Prozent auf etwa 900.000 Einwohner im Jahr 2030 zurückgehen. Mit anderen Worten: In 20 Jahren werden rd. 57.000 Menschen weniger in den drei MEO-Städten leben. Gleichzeitig steigt der Anteil der älteren Mitbürger. Das Durchschnittsalter wird bis 2030 um etwa zwei Jahre ansteigen.
In den einzelnen Städten gibt es zwar Unterschiede in der Entwicklung, die Tendenz bleibt aber stets die gleiche: Essen wird demnach bis 2030 etwa 33.000 Einwohner verlieren, Mülheim an der Ruhr 11.500 und Oberhausen 12.500. In allen drei Städten wird der sog. Altenquotient, also der Anteil der über 65-Jährigen bezogen auf die Gruppe der Erwerbsfähigen, signifikant ansteigen: Er wird im Jahr 2030 bei etwa 50 Prozent liegen. Das bedeutet, dass auf eine Person im Alter über 65 nur noch zwei im erwerbsfähigen Alter kommen. Dies wird in den Betrieben deutlich zu spüren sein und die Fachkräfteproblematik weiter verschärfen.
MEO-Region braucht steigende Einwohnerzahlen
Das Ziel in der MEO-Region sollte lauten, dass die Einwohnerzahlen wieder ansteigen oder zumindest der Schrumpfungsprozess gestoppt wird. Auch wenn die
aktuellen Prognosen in eine andere Richtung deuten: Sie basieren auf ganz bestimmten Szenarien. Daher gilt es, diese Basis zu verändern und ein Szenario zu entwickeln,
in dem die Region mittelfristig möglichst große Wanderungsgewinne macht. Dazu muss in erster Linie ihre Attraktivität gesteigert werden. Ganz wesentlich ist dabei eine dynamische Wirtschaft, die Arbeitsplätze bietet. Aber auch das Wohnumfeld, die Lebensqualität und eine Verbesserung der Familienfreundlichkeit zählen dazu. Denn langfristig sollte es darum gehen, als familienfreundliche Region viele Menschen zu binden und so wieder aus sich selbst heraus zu wachsen.
aktuellen Prognosen in eine andere Richtung deuten: Sie basieren auf ganz bestimmten Szenarien. Daher gilt es, diese Basis zu verändern und ein Szenario zu entwickeln,
in dem die Region mittelfristig möglichst große Wanderungsgewinne macht. Dazu muss in erster Linie ihre Attraktivität gesteigert werden. Ganz wesentlich ist dabei eine dynamische Wirtschaft, die Arbeitsplätze bietet. Aber auch das Wohnumfeld, die Lebensqualität und eine Verbesserung der Familienfreundlichkeit zählen dazu. Denn langfristig sollte es darum gehen, als familienfreundliche Region viele Menschen zu binden und so wieder aus sich selbst heraus zu wachsen.
Aufgrund von Befragungen, Medienberichten und Diskussionen ist schon länger bekannt, dass die MEO-Region in besonderer Weise von der demografischen Entwicklung betroffen sein wird. Im IHK-Bezirk existieren bereits zahlreiche Einzelmaßnahmen und Projekte zu bestimmten Themen. Abgestimmte Konzepte, Handlungsansätze oder Strategien, wie beispielsweise die Kommunen sich diesem Trend insgesamt gegenüber aufstellen, fehlen jedoch bislang: Es gibt keine abgestimmte und gezielte Demografiepolitik für die MEO-Region.
Deshalb ist eine Koordinierung der Vielzahl der Projekte sinnvoll, um Doppelungen zu vermeiden und effizienter sein zu können. Denn eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben wird lauten: die Wege zu einer demografiefesten Region nicht nur aufzuzeigen, sondern diese auch zu gehen.
Interkommunale Zusammenarbeit bleibt sinnvolle Strategie
Die drei Städte in der MEO-Region haben bereits in einigen Bereichen Kooperationen umgesetzt. Es ist nach wie vor eine sinnvolle Strategie, zukünftig noch stärker interkommunal zusammenzuarbeiten - nicht nur aufgrund der finanziellen Lage der Städte, sondern vor allem auch mit Blick auf die demografischen Herausforderungen. Der im Jahr 2011 erschienene Projektbericht „Den Wandel gestalten – Anreize für mehr Kooperationen im Ruhrgebiet“ des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) enthält einige wertvolle Handlungsempfehlungen. So spricht sich das RWI u. a. für funktionale Einzelkooperationen mit klaren Regeln aus. Es gilt, die damit verbundenen Entwicklungschancen zu nutzen. Die IHK wird einen Arbeitskreis MEO initiieren, um sich über wichtige Vorhaben der regionalen Entwicklung auszutauschen und deren Umsetzung anzustoßen.
Einige Kommunen haben bereits sog. Demografie-Beauftragte installiert. Auch in der MEO-Region wäre dies ein möglicher Schritt, an verantwortlicher Stelle koordinierend zu wirken. Denn die regionale Bevölkerungsentwicklung ist letztlich ein Querschnittsthema, das nahezu alle Bereiche der Kommunen betrifft. Darüber hinaus spricht vieles für einen sog. Demografie-Check, mit dem anhand von klar definierten Kriterien kommunale Maßnahmen vor ihrer Umsetzung überprüft werden sollten. Die IHK bietet sich an, sowohl bei der Erarbeitung von Kriterien als auch zur Einschätzung ökonomischer Auswirkungen unterstützend und beratend zu wirken.
Wirtschaftlicher Wohlstand und positives Image ziehen Menschen an
Wirtschaftlicher Wohlstand und zukunftsfähige Arbeitsplätze werden weiterhin das stärkste Argument für den Zuzug in die MEO-Region sein. Daher muss das vordringlichste Ziel der Politik lauten, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Unternehmen sich ansiedeln, bleiben und expandieren können. Selbstverständlich gehören dazu u. a. ein niedriger Gewerbesteuerhebesatz und eine kommunale Finanzpolitik mit Augenmaß. Schließlich sind gerade in der MEO-Region die finanziellen Spielräume der Kommunen arg eingeschränkt. Wichtig ist es daher, dass die Politik Prioritäten setzt und Gestaltungswillen zeigt, um weiterhin handlungsfähig zu sein.
Neben den Rahmenbedingungen muss auch das Image der Region verbessert werden. Denn noch immer haben die MEO-Städte sowie das Ruhrgebiet insgesamt mit dem Bild der Vergangenheit zu kämpfen. In einigen Lexika wie auch in Schulbüchern wird beispielsweise Essen immer noch als Stadt der Kohle- und Stahlwirtschaft dargestellt. Der schweizer Schriftsteller Adolf Muschg hatte dagegen im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Europas treffend formuliert: „Das Ruhrgebiet atmet nicht mehr Staub, sondern Zukunft.“ Gemeinsam muss es gelingen, diese Botschaft selbstbewusst zu leben und auch weiter zu transportieren.
Nur ein von der Mehrheit gestütztes Konzept wird erfolgreich sein
Das vorliegende Strategiepapier beschreibt zu elf Themen, was aus Sicht der regionalen Wirtschaft getan werden sollte, um die Region attraktiver zu gestalten und damit vor allem neue Fachkräfte zu gewinnen. Wir zeigen einzelne Vorschläge auf, die umgesetzt werden sollten, um diese Ziele zu erreichen. Diese erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen Impulse für die weitere Diskussion geben.
Die IHK möchte mit diesem Strategiepapier einen Prozess in Gang setzen, an dem sich möglichst viele relevante Akteure beteiligen. Denn nur ein von der Mehrheit gestütztes Konzept wird erfolgreich sein. Daher müssen in diesen Prozess auch weitere Partner – wie Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Verbände, Gewerkschaften, Kirchen etc. – einbezogen werden. Am Ende sollte eine von der Region getragene Gesamtstrategie stehen, an der sich die Entscheidungen der Kommunen als eine Art Leitplanke orientieren können.
Als IHK werden wir selbst unseren Beitrag als Impulsgeber und Moderator leisten. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Dafür sollten wir die Zukunft neu denken.
Auswirkungen des demografischen Wandels
- Die Infrastruktur muss durch weniger Personen finanziert werden.
- Das Steueraufkommen sinkt.
- Unternehmen – insbesondere den kleinen und mittelständischen (KMUs) – fehlt das Potenzial an gut qualifizierten Fach- und Nachwuchskräften.
- Die Nachfrage wird tendenziell sinken, sofern nicht Kunden außerhalb der Region mobilisiert werden können.
- Mittelzuweisungen vom Land NRW werden geringer ausfallen und die ohnehin angespannte finanzielle Situation der Kommunen verschärfen.
- Die bestehende Infrastruktur muss den veränderten Bedürfnissen einer älteren Bevölkerung angepasst werden.
- „Alte“ Städte versprühen meist eine weniger hohe Dynamik und Impulsivität und daher auch Kreativität als „junge“ Städte.