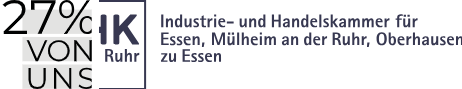Produkthaftungsrecht
Produkthaftung
Unter Produkthaftung versteht man die herstellerseitige Haftung für Personen- und Sachschäden, die aus der Benutzung eines fehlerhaften Produkts resultieren. Die Ansprüche entstehen unabhängig davon, ob zwischen Hersteller und Endkunde ein Vertrag geschlossen wurde. Geregelt ist die Produkthaftung im Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG). Dessen Regeln treten neben die Haftung aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).
I. Abgrenzung zur Mängelhaftung
Produkthaftungsansprüche sind zu unterscheiden von Mängelansprüchen, die sich entweder aus dem Kaufvertrag oder einer zusätzlich vereinbarten Garantie ergeben können.
Ziel der Mängelhaftung ist, dass Kunden von ihren Vertragspartnern ein mangelfreies Produkt erhalten. Ist die Sache nicht mangelfrei, kann unter anderem Nacherfüllung und gegebenenfalls Ersatz für Schäden verlangt werden, die durch diese Mangelhaftigkeit entstanden sind. Bei der Mängelhaftung geht es um das gestörte Vertragsverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer.
Der Produkthaftung liegt demgegenüber der Gedanke zugrunde, dass diejenige Person, die Produkte herstellt oder in den Verkehr bringt, die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass von diesen Produkten keine Gefahr ausgeht. Vor diesem Hintergrund schützt das ProdHaftG Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und an anderen Sachen als der schadhaften Sache selbst. Die Produkthaftung ist hingegen nicht darauf gerichtet, Erwerbern/Benutzern eine mangelfreie Sache zur Verfügung zu stellen.
II. Anspruchsvoraussetzungen
§ 1 Abs. 1 ProdHaftG begründet eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung. Das bedeutet, dass Hersteller fehlerhafter Produkte auch dann haften, wenn ihnen weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Sogar bei nicht vermeidbaren Fehlern an Einzelstücken (sogenannte „Ausreißer“) kommt es zur Haftung. Gerade bei industrieller Fertigung, in der Endprodukte oftmals aus vielen einzelnen Teilprodukten von unterschiedlichen Herstellern zusammengesetzt werden, wird bei der Geltendmachung von Haftungsansprüchen nicht selten die Frage nach der verantwortlichen Person aufgeworfen. Häufig können mehrere Hersteller nebeneinander haftbar gemacht werden und eventuell auch noch Importeure und Händler die Haftungskette erweitern.
Für einen Schadensersatzanspruch nach dem Produkthaftungsgesetz müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
1. Es muss ein fehlerhaftes Produkt vorliegen. Produkt im Sinne des § 2 ProdHaftG ist jede bewegliche Sache, auch wenn sie Teil einer anderen Sache ist, sowie Elektrizität. Unter den Produktbegriff fallen zudem landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Jagderzeugnisse. Nach § 3 ProdHaftG liegt ein Fehler vor, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigten Sicherheitserwartungen nicht erfüllt werden. Sicherheitserwartungen können sich aus der Darbietung, dem billigerweise zu erwartenden Gebrauch und/oder dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens ergeben.
2. Die Verletzungshandlung muss in Form einer Tötung, einer Körper- oder Gesundheitsverletzung oder einer Sachbeschädigung an einer anderen Sache als dem fehlerhaften Produkt erfolgt sein. Im Falle einer Sachbeschädigung muss die Sache ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Gebrauch bestimmt und hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet worden sein. Das Vermögen als solches ist nicht geschützt.
3. Darüber hinaus ist erforderlich, dass der Schaden auf den Produktfehler zurückzuführen ist.
4. Anspruchsberechtigt ist sowohl der unmittelbar als auch dermittelbar Geschädigte.
5. Nach § 1 ProdHaftG haftet der Hersteller. Der Herstellerbegriff wird in § 4 ProdHaftG konkretisiert. Als Hersteller gelten damit
• der tatsächliche Hersteller des Endprodukts,
• der Zulieferer eines Teilprodukts, sofern dieses tatsächlich fehlerhaft war,
• der Importeur eines Produkts von außerhalb der EU,
• der Händler, soweit er auf dem Produkt seinen Namen, sein Warenzeichen oder ein anderes unterscheidungskräftiges Kennzeichen anbringt sowie
• der Lieferant, wenn der Hersteller des Produkts nicht festgestellt werden kann. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Lieferant innerhalb eines Monats, nachdem er durch den Geschädigten aufgefordert worden ist, den Namen seines Vorlieferanten oder Herstellers mitteilt.
Alle aufgeführten Personen haften nach § 5 ProdHaftG als Gesamtschuldner, so dass sich der Geschädigte den Finanzkräftigsten zur Befriedigung seines Schadensersatzanspruchs herausgreifen kann. Zwischen den Gesamtschuldnern findet gegebenenfalls ein Ausgleich im Innenverhältnis statt. Wer den Schaden am Ende zu tragen hat, hängt insbesondere davon ab, von wem der Schaden vorwiegend verursacht worden ist.
6. Nach § 1 Abs. 2 und 3 ProdHaftG ist die Haftung ausgeschlossen, wenn:
• der Hersteller das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat (Beispiel: das Produkt wurde ihm gestohlen),
• der Fehler nach dem Inverkehrbringen des Produkts entstanden ist (Beispiel.: es wurde eine unsachgemäße Reparatur durchgeführt),
• der Hersteller das Produkt nicht für den Verkauf oder sonstigen Vertrieb (Beispiel: der Hersteller verwendet das Produkt selbst privat oder für wohltätige Zwecke) und zusätzlich nicht im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hergestellt oder vertrieben hat,
• der Fehler auf der Berücksichtigung von zwingendem Recht beruht,
• der Fehler nach dem Stand von Wissenschaft und Technik zur Zeit des Inverkehrbringens nicht erkannt werden konnte oder
• das Teilprodukt eines Zulieferers für sich fehlerfrei war und der Fehler erst durch die Herstellung des Endprodukts entstand; in diesem Fall haftet nur, wer das Endprodukt hergestellt hat.
Für den Fehler, den Schaden und den ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden ist der Geschädigte beweispflichtig (§ 1 Abs. 4 ProdHaftG). Der Hersteller muss entlastende Umstände beweisen.
Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre (§ 12 ProdHaftG). Sie beginnt, wenn der Geschädigte von dem Schaden, dem Fehler und dem Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt oder hätte erlangen müssen. Sind seit dem Inverkehrbringen des Produkts mehr als zehn Jahre vergangen, können keine Ansprüche aus Produkthaftung mehr geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn über den Anspruch ein Rechtsstreit oder ein Mahnverfahren anhängig ist (§ 13 ProdHaftG).
III. Umfang der Ansprüche aus Produkthaftung
Personenschäden sind nach § 10 ProdHaftG bis zu einer Höhe von 85 Mio. € zu ersetzen. § 8 ProdHaftG billigt dem Geschädigten zudem einen Schmerzensgeldanspruch zu. § 7 Abs. 3 ProdHaftG ergänzt den Umfang außerdem im Falle der Tötung um eine angemessene Entschädigung in Geld für Hinterbliebene, die zur Zeit der Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis standen.
Sachschäden müssen nur ersetzt werden, soweit andere Sachen als das Produkt selbst beschädigt wurden. Dabei gilt nach § 11 ProdHaftG eine Selbstbeteiligung von 500,- €. Bei der Haftung für Sachschäden gibt es keine Obergrenze.
Das ProdHaftG ist zwingendes Recht und kann gemäß § 14 ProdHaftG vertraglich nicht abgeändert oder ausgeschlossen werden.
Hinweis
Bis spätestens 09. Dezember 2026 muss die europäische Produkthaftungsrichtlinie (RL (EU) 2024/2853 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024) in nationales Recht umgesetzt werden und wird zahlreiche Änderungen des Produkthaftungsrechts mit sich bringen. Betroffen ist davon insbesondere der Kreis der Haftenden, die umfassten Produktgruppen und die prozessualen Anforderungen.
Stand: Juni 2025