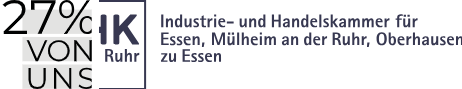Welche Rechtsform ist die richtige?
Bereits in der frühen Phase der Unternehmensgründung stellt sich die Frage, wie das Unternehmen rechtlich geführt werden soll. Die Wahl der Rechtsform des Unternehmens hat dabei meist persönliche, finanzielle, steuerliche und rechtliche Folgen.
Die optimale Rechtsform für ein Unternehmen gibt es aber nicht. Jede Rechtsform birgt Vor- und Nachteile. Bevor die Rechtsform festgelegt wird, sollten folgende Fragen geklärt werden:
- Von wie vielen Personen soll das Unternehmen gegründet werden?
- Wer soll das Unternehmen leiten?
- Wie viel Eigenkapital kann aufgebracht werden?
- Ist das Vorhaben risikoreich?
- Soll die persönliche Haftung beschränkt werden?
- Sollen möglichst wenig Formalitäten bei der Gründung entstehen?
- Soll das Unternehmen eine hohe Kreditwürdigkeit haben?
- Muss eine Eintragung in das Handelsregister erfolgen?
- Soll vom Eintragungsrecht in das Handelsregister Gebrauch gemacht werden?
Die optimale Rechtsform für ein Unternehmen gibt es aber nicht. Jede Rechtsform birgt Vor- und Nachteile. Bevor die Rechtsform festgelegt wird, sollten folgende Fragen geklärt werden:
- Von wie vielen Personen soll das Unternehmen gegründet werden?
- Wer soll das Unternehmen leiten?
- Wie viel Eigenkapital kann aufgebracht werden?
- Ist das Vorhaben risikoreich?
- Soll die persönliche Haftung beschränkt werden?
- Sollen möglichst wenig Formalitäten bei der Gründung entstehen?
- Soll das Unternehmen eine hohe Kreditwürdigkeit haben?
- Muss eine Eintragung in das Handelsregister erfolgen?
- Soll vom Eintragungsrecht in das Handelsregister Gebrauch gemacht werden?
Welche Rechtsformen gibt es?
- Einzelunternehmen
Ein Einzelunternehmen kann bereits durch lediglich eine Person gegründet werden; die Beteiligung anderer Personen (als Gesellschafter) ist für die Gründung nicht erforderlich. Dabei ist es obsolet, ob der Unternehmer als Kaufmann im Sinne des § 1 Abs. 1 oder § 2 HGB oder Kleingewerbetreibender tätig wird. Die Tätigkeit als Einzelunternehmer kann nach erfolgter Gewerbeanzeige bei der zuständigen Gewerbemeldestelle aufgenommen werden, sofern die Tätigkeit nicht ausnahmsweise erlaubnispflichtig ist. Für die Gründung eines Einzelunternehmens ist kein festes Kapital und auch keine Mindesteinlage vorgeschrieben. Jedoch ist die Haftung des Unternehmens unbeschränkt, das bedeutet, dass die Haftung das Geschäfts- als auch das Privatvermögen des Unternehmers umfasst.
- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Die GbR ist eine rechtsfähige Personengesellschaft. Deren gesetzlichen Rechte und Pflichten ergeben sich aus §§ 705 ff. BGB. Mit der GbR verpflichtet sich mindestens zwei Gesellschafter die Erreichung eines gemeinsamen, nicht notwendig wirtschaftlichen Zwecks zu fördern. Bei den Gesellschaftern kann es sich sowohl um natürliche als auch juristische Personen (z.B. GmbH, AG) sowie andere rechtsfähige Gesellschaften (z.B. OHG, KG) handeln. Für die Gründung der GbR muss ein Gesellschaftsvertrag zwischen den beiden Gesellschaftern abgeschlossen werden. Der Vertrag bedarf keiner Schriftform und kann daher auch mündlich geschlossen werden. Aus Beweisgründen und für die Rechtssicherheit ist es aber ratsam, den Gesellschaftsvertrag in schriftlicher Form abzuschließen.
Die Gesellschafter einer GbR haften grundsätzlich persönlich und gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Für die Gründung ist kein festgeschriebenes Kapital oder eine Mindesteinlage vorgeschrieben. Bei der GbR – anders als beim Einzelkaufmann – wird die Entscheidungsbefugnis durch die gemeinsame Geschäftsführung getragen.
Die Rechtsform der GbR steht und fällt mit ihren Gesellschaftern; scheidet ein Gesellschafter aus einer 2-Personen-GbR aus, so führt dies zur Auflösung der GbR. Es ist daher zu empfehlen eine Fortsetzungsklausel in den Gesellschaftsvertrag mit aufzunehmen.
- Eingetragener Kaufmann (e.K.)
Bei einem Unternehmen, welches eine kaufmännische Betriebsgröße erreicht hat, muss neben einer Gewerbeanmeldung eine Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister erfolgen. Wann ein Unternehmen die kaufmännische Betriebsgröße erreicht hat, bemisst sich nach dem Umfang des Geschäfts (etwa ab 250.000 Euro Jahresumsatz). Die Firma kann sich aber dennoch in das Handelsregister eintragen lassen, auch wenn die kaufmännische Betriebsgröße nicht erreicht ist. Durch die Eintragung gilt das Unternehmen dann als Kaufmann/Kauffrau im Sinne des Handelsgesetzbuchs (HGB). Dadurch gehen auch Vorteile, wie die „Sonderrechte der Kaufleute“, mit einher.
Sollte die Betriebsform des e.K. angestrebt werden, so sind die steuerrechtlichen als auch handelsrechtlichen Buchführungsvorschriften zu beachten. Eine Bilanz muss immer dann erstellt werden, wenn der e.K. am Ende von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren die Umsätze von mehr als 600.000 Euro und der Jahresüberschuss mehr als 60.000 Euro betragen.
Für die Gründung eines e.K. wird kein festes Kapital und auch keine gesetzliche Mindesteinlage vorgeschrieben. Jedoch haftet der Inhaber unbeschränkt mit seinem Geschäfts- als auch Privatvermögen für betriebliche Verbindlichkeiten.
Ein Unternehmen, welches als e.K. im Handelsregister eingetragen ist, wird von einer einzelnen Person – dem Inhaber – geleitet.. Die Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis des Unternehmens obliegt ihm allein.
Sollte die Betriebsform des e.K. angestrebt werden, so sind die steuerrechtlichen als auch handelsrechtlichen Buchführungsvorschriften zu beachten. Eine Bilanz muss immer dann erstellt werden, wenn der e.K. am Ende von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren die Umsätze von mehr als 600.000 Euro und der Jahresüberschuss mehr als 60.000 Euro betragen.
Für die Gründung eines e.K. wird kein festes Kapital und auch keine gesetzliche Mindesteinlage vorgeschrieben. Jedoch haftet der Inhaber unbeschränkt mit seinem Geschäfts- als auch Privatvermögen für betriebliche Verbindlichkeiten.
Ein Unternehmen, welches als e.K. im Handelsregister eingetragen ist, wird von einer einzelnen Person – dem Inhaber – geleitet.. Die Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis des Unternehmens obliegt ihm allein.
- Offene Handelsgesellschaft (OHG)
Die rechtliche Grundlage für die OHG bildet die Regelung des § 105 HGB. Sie ist eine Personenhandelsgesellschaft, für dessen Gründung mindestens zwei Gesellschafter notwendig sind. Grundsätzlich bestehend bei der OHG dieselben Voraussetzungen wie bei der GbR. So ist auch hier kein Mindestkapital für die Gründung einer OHG vorgeschrieben. Ebenso ist die Eintragung in das Handelsregister erforderlich. Die OHG wird sodann durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zwischen den beteiligten Gesellschaftern gegründet, welcher keiner bestimmten Form bedarf.
Der Unterschied zwischen der GbR und der OHG besteht aber insbesondere darin, dass der bestellte Geschäftsführer grundsätzlich einzelgeschäftsführungsbefugt und einzelvertretungsermächtigt ist.
Der Unterschied zwischen der GbR und der OHG besteht aber insbesondere darin, dass der bestellte Geschäftsführer grundsätzlich einzelgeschäftsführungsbefugt und einzelvertretungsermächtigt ist.
Die Rechtsform der OHG kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Zweck verfolgt wird, das Handelsgewerbe unter einer gemeinschaftlichen Firma zu betreiben. Für sehr risikobehaftete Handelsgewerbe scheidet die Rechtsform der OHG aber in der Regel aus, denn für diese besteht keine Haftungsbeschränkung der Gesellschafter gegenüber ihren Gläubigern.
- Kommanditgesellschaft (KG)
Die KG baut auf die Rechtsform der OHG auf. Die §§ 161 ff. HGB bilden die gesetzliche Grundlage der KG.
Um eine KG gründen zu können, ist kein Mindestkapital vorgeschrieben. Die KG zeichnet zudem aus, dass diese auf zwei Gesellschaftergruppen aufgeteilt ist: den Kommanditisten und den Komplementären. Kommanditisten fungieren vor allem als Kapitalgeber für die KG. Durch ihre Vermögenseinlage erhöht sich das Eigenkapital der KG, welches im Handelsregister eingetragen ist. Der Unterschied zwischen den beiden Gesellschaftern liegt aber in der Haftung. So haftet der Komplementär unbeschränkt – auch mit seinem Privatvermögen – für Gesellschaftsverbindlichkeiten gegenüber Gläubigern, wohingegen die Haftung des Kommanditisten auf die von ihm geleistete Einlage beschränkt ist. Diese Haftungsunterscheidung stellt auch die Abgrenzung zur OHG dar.
Die Höhe der geleisteten Einlage des Kommanditisten wird im Gesellschaftsvertrag festgehalten; die schriftliche Form des Vertrages ist nicht zwingend, wird aber empfohlen. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Vertretung obliegen alleinig dem Komplementär.
Die Höhe der geleisteten Einlage des Kommanditisten wird im Gesellschaftsvertrag festgehalten; die schriftliche Form des Vertrages ist nicht zwingend, wird aber empfohlen. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Vertretung obliegen alleinig dem Komplementär.
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt)
Bei der GmbH und der UG (haftungsbeschränkt) handelt es sich um juristische Personen, bei welchen die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist. Durch die Reform des GmbH-Rechts im Jahr 2008 wurde die Rechtsform UG (haftungsbeschränkt) eingeführt. Diese ist eine Variante der GmbH, aber keine eigene Rechtsform. Das bedeutet, dass das Recht der GmbH auf die UG (haftungsbeschränkt) angewendet wird.
Für die Gründung einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) ist u.a. der Abschluss eines notariellen Gesellschaftsvertrages erforderlich. Dieser muss den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen. Beide Rechtsformen müssen ein Stammkapital vorweisen, welches bei der GmbH 25.000 Euro und bei der UG (haftungsbeschränkt) mindestens 1 Euro beträgt.
Die GmbH und UG (haftungsbeschränkt) werden durch die Geschäftsführung vertreten und sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die Haftungsbeschränkung tritt erst mit der erforderlichen Eintragung in das Handelsregister ein.
Mit der Einführung des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie kann die Gründung einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) als auch die Beglaubigung von bestimmen Handelsregisteranmeldungen in einem Online-Verfahren mit einem Notar durchgeführt werden.
Für die Gründung einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) ist u.a. der Abschluss eines notariellen Gesellschaftsvertrages erforderlich. Dieser muss den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen. Beide Rechtsformen müssen ein Stammkapital vorweisen, welches bei der GmbH 25.000 Euro und bei der UG (haftungsbeschränkt) mindestens 1 Euro beträgt.
Die GmbH und UG (haftungsbeschränkt) werden durch die Geschäftsführung vertreten und sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die Haftungsbeschränkung tritt erst mit der erforderlichen Eintragung in das Handelsregister ein.
Mit der Einführung des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie kann die Gründung einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) als auch die Beglaubigung von bestimmen Handelsregisteranmeldungen in einem Online-Verfahren mit einem Notar durchgeführt werden.
- Aktiengesellschaft (AG)
Für Großunternehmen, die ihren Kapitalbedarf über den Kapitalmarkt decken wollen, ist die AG die typische Rechtsform.
- GmbH & Co. KG
Die GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft) ist eine Unterform der KG. Hierbei nimmt die GmbH die Stellung des Komplementärs ein. Durch diese Konstellation entsteht eine vollständige Haftungsbeschränkung, da die GmbH bereits haftungsbeschränkt ist und somit trotz der Stellung des persönlich haftenden Komplementärs die Gesellschafter der GmbH eben nicht persönlich haften.
Die Gründung der GmbH & Co. KG erfolgt, wie auch bei der KG, durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zwischen einer bereits bestehenden oder zu diesem Zweck gegründeten GmbH (Komplementär) und mindestens einen Kommanditisten.
Wie auch bei der KG fällt die Geschäftsführung sowie die Vertretung der GmbH & Co. KG in den Aufgabenbereich des Komplementärs.
Die Gründung der GmbH & Co. KG erfolgt, wie auch bei der KG, durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zwischen einer bereits bestehenden oder zu diesem Zweck gegründeten GmbH (Komplementär) und mindestens einen Kommanditisten.
Wie auch bei der KG fällt die Geschäftsführung sowie die Vertretung der GmbH & Co. KG in den Aufgabenbereich des Komplementärs.
Fazit
Die Wahl der geeigneten Rechtsform ist eine entscheidende Grundlage für die Gründung und den Bestand eines Unternehmens. Es ist daher wichtig, sich vor der Gründung umfassend mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Dennoch können sich die Verhältnisse des Unternehmens im Laufe der Zeit – bspw. durch Expansion, höherem Haftungsrisiko – verändern. Es ist daher ratsam in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob die gewählte Rechtsform des Unternehmens noch passt oder ob diese nicht gewechselt werden sollte.
Stand: Mai 2025
Stand: Mai 2025