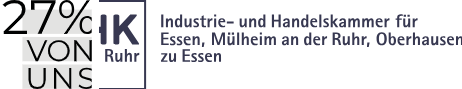BGH: Online-Fortbildungen bedürfen behördlicher Zustimmung
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 12.6.2025 (Az. III ZR 109/24) klargestellt: Ohne eine behördliche Zulassung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) sind Verträge über bestimmte Online-Fortbildungsangebote nichtig – unabhängig davon, ob der Teilnehmer Unternehmer oder Verbraucher ist. Der Anbieter muss bereits geleistete Zahlungen erstatten.
Sachverhalt:
Der Kläger hatte bei der Beklagten ein „9-Monats-Business-Mentoring-Programm Finanzielle Fitness“ für 47.600 € gebucht. Enthalten waren Online-Meetings, Lehrvideos, Einzelcoachings und Workshops. Der Anbieter verfügte nicht über die nach § 12 Abs. 1 FernUSG erforderliche Zulassung. Der Teilnehmer kündigte den Vertrag nach sieben Wochen und verlangte Rückzahlung der bereits geleisteten Zahlungen in Höhe von 23.800€.
Der Kläger hatte bei der Beklagten ein „9-Monats-Business-Mentoring-Programm Finanzielle Fitness“ für 47.600 € gebucht. Enthalten waren Online-Meetings, Lehrvideos, Einzelcoachings und Workshops. Der Anbieter verfügte nicht über die nach § 12 Abs. 1 FernUSG erforderliche Zulassung. Der Teilnehmer kündigte den Vertrag nach sieben Wochen und verlangte Rückzahlung der bereits geleisteten Zahlungen in Höhe von 23.800€.
Vorinstanzen:
Das Landgericht Heilbronn wies die Klage ab. Das OLG Stuttgart gab dem Kläger recht und stellte fest, dass der Vertrag mangels Zulassung nichtig sei. Der Anbieter legte Revision ein.
Das Landgericht Heilbronn wies die Klage ab. Das OLG Stuttgart gab dem Kläger recht und stellte fest, dass der Vertrag mangels Zulassung nichtig sei. Der Anbieter legte Revision ein.
Entscheidung des BGH:
Der BGH bestätigte die Entscheidung des OLG und wies die Revision zurück. Das Programm erfülle die Voraussetzungen von „Fernunterricht“ im Sinne des § 1 FernUSG. Fernunterricht wird dort definiert als die auf vertraglicher Grundlage erfolgende, entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind und der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen.
Der BGH bestätigte die Entscheidung des OLG und wies die Revision zurück. Das Programm erfülle die Voraussetzungen von „Fernunterricht“ im Sinne des § 1 FernUSG. Fernunterricht wird dort definiert als die auf vertraglicher Grundlage erfolgende, entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind und der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen.
- Räumliche Trennung: Online-Videolektionen und abrufbare Live-Calls gelten als Fernunterricht, selbst wenn punktuell synchrone Formate angeboten werden.
- Lernerfolgskontrolle: Fragen in Online-Meetings und die Pflicht zur Hausaufgabenerledigung erfüllen das Kriterium der Lernkontrolle.
- Zulassungspflicht: Da keine Ausnahme nach § 12 Abs. 1 S. 3 FernUSG greift, hätte eine behördliche Zulassung vorliegen müssen.
Zudem stellt der BGH klar: Das FernUSG gilt auch für Verträge mit Unternehmern, nicht nur mit Verbrauchern. Der Gesetzeszweck – der Schutz vor ungeeigneten Fernlehrangeboten – sei unabhängig vom Status der Teilnehmer. Auch Coaching- oder Mentoringprogramme fielen darunter. Der geschlossene Fortbildungsvertrag sei daher wegen der fehlenden Zulassung insgesamt nichtig.
Bedeutung für die Praxis:
- Vertragsgestaltung: Anbieter sollten genau prüfen, ob ihre Onlineprogramme unter das FernUSG fallen. Dabei ist insbesondere auf vertragliche Formulierungen (z. B. zur Wissensvermittlung und Lernerfolgskontrolle) zu achten – dies war im Urteil maßgeblich für die rechtliche Einschätzung.
- Risikominimierung: Wer seine Schulungskonzepte nur als Live-Webinare ohne Aufzeichnungen plant, sollte dies vertraglich klarstellen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, unter die Zulassungspflicht des FernUSG zu fallen. Der BGH hat die Frage, ob das ausschließliche Anbieten von synchronen Inhalten das Merkmal der räumlichen Trennung entfallen lässt, ausdrücklich offengelassen.
- Zulassungspflicht ernst nehmen: Falls Online-Fortbildungsprogramme unter die Zulassungspflicht des FernUSG fallen, sollte unbedingt die notwendige behördliche Zulassung eingeholt werden, da sonst keine Zahlungsansprüche des Anbieters gegenüber den Teilnehmern bestehen.
Fazit:
Es besteht – auch im Hinblick auf den zugesagten Bürokratieabbau - dringender Handlungsbedarf seitens der Bundesregierung, die bestehende Gesetzgebung anzupassen. Das Urteil führt dazu, dass bei Anbietern von Online-Fortbildungen, Online-Coachings und ähnlichen Formaten eine erhebliche Rechtsunsicherheit besteht, ob abgeschlossene Verträge zu entsprechenden Angeboten rechtswirksam sind.
Es besteht – auch im Hinblick auf den zugesagten Bürokratieabbau - dringender Handlungsbedarf seitens der Bundesregierung, die bestehende Gesetzgebung anzupassen. Das Urteil führt dazu, dass bei Anbietern von Online-Fortbildungen, Online-Coachings und ähnlichen Formaten eine erhebliche Rechtsunsicherheit besteht, ob abgeschlossene Verträge zu entsprechenden Angeboten rechtswirksam sind.
Da sich die amtierende Bundesregierung zum Ziel gesetzt hat, Bürokratie abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken, sollte hier der politische Wille vorhanden sein, Rechtssicherheit zu schaffen und die betreffenden Anbieter zu entlasten.