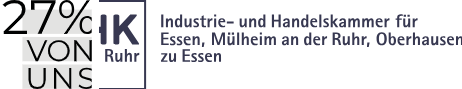Insolvenzanfechtung, eine latente Gefahr für Gläubiger
Vor einer Insolvenz versuchen Betroffene, zu retten, was zu retten ist. Dies geschieht durch den Schuldner, ihm nahestehende Personen, häufig aber auch durch Gläubiger. Werden die übrigen Gläubiger dadurch benachteiligt, dass vor der Insolvenz noch Geld abfließt zum Vorteil Einzelner, können diese Vermögensteile ggf. aber vom Insolvenzverwalter im Wege der Anfechtung zurückgeholt werden.
Ziel der Insolvenz ist es, das restliche Vermögen gerecht, d. h. nach dem Verhältnis der Beträge der Forderungen der Gläubiger zu verteilen. Die Verluste sollen – zumindest unter den Gläubigern ohne Sicherungsrechte – gemeinschaftlich getragen werden. Jeder (mit Ausnahme von Gläubigern, die über Sicherungsrechte verfügen) soll den gleichen prozentualen Anteil am Restvermögen erhalten.
Dies wird aber gestört, wenn einzelne Gläubiger kurz vor der Insolvenz noch eine Tilgung für ihre Forderung erhalten, obwohl sie bereits wussten oder ahnten, dass der Schuldner insolvent ist. Deshalb hat der Insolvenzverwalter im Rahmen der Insolvenzanfechtung und unter den in den §§ 129-147 InsO genannten Voraussetzungen die Möglichkeit, Rechtsgeschäfte anzufechten, die zu einer Benachteiligung der übrigen Gläubiger geführt haben. Vor Prüfung eines Anfechtungsgrunds muss nach § 129 Abs. 1 InsO die Grundvoraussetzung jeder Insolvenzanfechtung vorliegen:
Eine Benachteiligung der Gläubiger liegt vor, wenn die Rechtshandlung die Befriedigungsmöglichkeiten der Gläubiger verkürzt, vereitelt, erschwert, gefährdet oder verzögert.
Zu ermitteln ist dabei, ob die Befriedigungschancen der Insolvenzgläubiger ohne die angefochtene Rechtshandlung besser gewesen wären. Auch Dienst- oder Werkleistungen können eine Benachteiligung begründen, wenn durch sie ein Gläubiger bevorzugt wird. Die übrigen Gläubiger können aber auch durch die Übernahme fremder Verbindlichkeiten oder durch den Abschluss eines sehr ungünstigen Vertrags benachteiligt werden. Dagegen fehlt es an einer Benachteiligung, wenn wertloses oder wertübersteigend belastetes Vermögen vom Schuldner übertragen wird. Neben diesen allgemeinen Anfechtungsvoraussetzungen, müssen die besonderen Voraussetzungen der einzelnen Anfechtungstatbestände der §§ 130 bis 137 InsO erfüllt sein.
Im Einzelnen:
§ 130 InsO
Erhält ein Gläubiger in den letzten drei Monaten vor der Insolvenz eine Leistung vom Schuldner, die er in der Art und Weise und zu dieser Zeit tatsächlich beanspruchen konnte (eine solche Leistung wird auch als kongruent, weil vertragsgemäß, bezeichnet), kommt eine Anfechtung nach § 130 Abs. 1 Satz 1 InsO in Betracht. Voraussetzung für eine Anfechtung nach § 130 Abs. 1 InsO ist, dass der Schuldner bereits zahlungsunfähig war und der Gläubiger dies wusste.
§ 131 InsO
Anfechtungsrechtlich verdächtig sind Leistungen, die ein Gläubiger nicht, nicht zu der Zeit oder nicht in der geschuldeten Art und Weise beanspruchen durfte., die zueinander also nicht kongruent sind. Erhält ein Gläubiger nicht genau das, was er zu beanspruchen hatte, müsste er bereits aufgrund dieser Inkongruenz zwischen Forderung und Leistung des Schuldners Verdacht schöpfen. Nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO sind inkongruente Leistungen ohne Weiteres anfechtbar, wenn der Gläubiger sie im letzten Monat vor dem Insolvenzantrag erhalten hat. Nach § 131 Abs. 1 Nr. 2, 3 InsO sind inkongruente Leistungen, die der Gläubiger im zweiten oder dritten Monat vor dem Insolvenzantrag erhalten hat, anfechtbar, wenn der Schuldner in diesem Zeitraum bereits objektiv zahlungsunfähig war oder wenn dem Gläubiger der Eintritt einer Benachteiligung der übrigen Gläubiger bekannt war.
§ 132 InsO regelt einen Auffangtatbestand.
Er ermöglicht die Anfechtung aller in der Krise des Schuldners vorgenommenen Handlungen, für welche kein ausreichender Gegenwert fließt, sog. Verschleuderungsgeschäfte.
§ 133 InsO
Der vermutlich häufigste Anfechtungsgrund ist in § 133 Abs. 1 InsO geregelt. Danach können Rechtshandlungen bis zu vier, in Ausnahmefällen sogar bis zu zehn Jahre rückwirkend angefochten werden. Dies führt z. B. bei laufenden Geschäftsbeziehungen teilweise zu einem erheblichen Anfechtungsumfang und – manchmal erst Jahre später – zu einem erheblichen Ausfall auf Seiten des betroffenen Gläubigers.
Voraussetzung für eine Anfechtung nach § 133 Abs. 1 Satz 1 InsO, die sog. „Vorsatzanfechtung″, ist eine Rechtshandlung des Schuldners, die dieser mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat.
§ 134 InsO
Ein weiterer Tatbestand ist die Schenkungsanfechtung gemäß § 134 InsO. Davon erfasst sind alle unentgeltlichen Leistungen des Schuldners, die dieser innerhalb der letzten vier Jahre vor dem Insolvenzeröffnungsantrag vorgenommen hat.
Bargeschäft, Anfechtungsausschluss nach § 142 InsO
Von der Anfechtung ausgenommen sind nach § 142 Abs. 1 InsO sog. „Bargeschäfte″. Ein Bargeschäft liegt vor, wenn der Schuldner und der Gläubiger die vertraglich geschuldeten Leistungen, die gleichwertig sein müssen, in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang (einfache Faustregel: binnen 30 Tagen) austauschen. Wirtschaftlich betrachtet wird hier das Vermögen nicht gemindert, sondern gegen einen gleichwertigen Wert getauscht.
§§ 143 bis 146 InsO
Ficht der Insolvenzverwalter eine Leistung erfolgreich an, muss der Gläubiger dasjenige, was er durch die angefochtene Rechtshandlung erlangt hat, zurückgewähren (§ 143 Abs. 1 InsO). Ist die Rückgewähr des konkreten Gegenstandes nicht (mehr) möglich, ist Geldersatz zu leisten.
Stand: März 2025