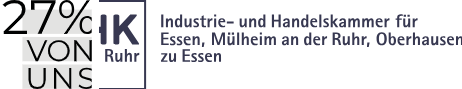Änderung im Produkthaftungsrecht
Die Richtlinie (EU) 2024/2853 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23.10.2024 für die Haftung für fehlerhafte Produkte und zur Aufhebung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates [nachfolgend Produkthaftungsrichtlinie] wurde am 18.11.2024 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die Richtlinie ist am 08.12.2024 in Kraft getreten und muss von den EU-Mitgliedstaaten bis zum 09.12.2026 in nationales Recht umgesetzt werden, Artikel 22, 23, 24 Produkthaftungsrichtlinie.
Sie ersetzt die Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG, die aus dem Jahr 1985 stammt. Hintergrund ist, dass sich die Herstellung und der Vertrieb von Produkten seither erheblich verändert haben. Zudem soll die Richtlinie die zunehmend wichtigen neuen digitalen Technologien wie Software und Systeme künstlicher Intelligenz (KI-Systeme) erfassen.
Sie ersetzt die Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG, die aus dem Jahr 1985 stammt. Hintergrund ist, dass sich die Herstellung und der Vertrieb von Produkten seither erheblich verändert haben. Zudem soll die Richtlinie die zunehmend wichtigen neuen digitalen Technologien wie Software und Systeme künstlicher Intelligenz (KI-Systeme) erfassen.
Im Folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen der neuen Richtlinie. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch nicht klar, wie und wann die Richtlinie in nationales Rechts umgesetzt wird.
Die neue Produkthaftungsrichtlinie gilt für Produkte, die nach dem 09.12.2026 in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, Artikel 2 Absatz 1. Wichtig ist, dass nun auch Software als Produkt im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie angesehen wird, Artikel 4
Der Anwendungsbereich der Richtlinie wurde erweitert und erfasst nun ausdrücklich Software und digitale Produktionsdateien (z.B. für 3D-Drucker) als „Produkte“. Dies gilt sowohl für Software, die in einem anderen Produkt integriert ist (z.B. Navi in Fahrzeug) als auch für eigenständige Software (z.B. Smartphone-App). Neu ist die Klarstellung, dass die Richtlinie nicht für kostenfreie Software (sog. open-source Software) gilt, die nicht geschäftlich zur Verfügung gestellt wird, Artikel 4 Absatz 1.
U.a. enthält die Produkthaftungsrichtlinie neue Regelungen bezüglich der für fehlerhafte Produkte verschuldensunabhängig haftenden Wirtschaftsakteure, Artikel 8, zur Offenlegung von Beweismitteln, Artikel 9 und zur Beweislast, Artikel 10.:
Nach der neuen Produkthaftungsrichtlinie werden auch Bevollmächtigte des Herstellers, Fulfillment-Dienstleister (d.h. Lager-, Verpackungs- und Versanddienstleister) und – unter Voraussetzungen – auch Einzelhändler und Betreiber von Online-Marktplätzen verschuldensunabhängig haften können. Damit erweitert die Richtlinie den Kreis der potenziellen Beklagten deutlich über die bisher in Betracht kommenden Hersteller, sogenannten Quasi-Hersteller und EWR-Importeure hinaus. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der geschädigten Person auch dann ein Beklagter zur Verfügung steht, wenn das fehlerhafte Produkt direkt aus einem Nicht-EU-Land gekauft wurde, und es keinen (Quasi-)Hersteller oder Importeur mit Sitz in der EU gibt. Außerdem sollen zukünftig auch Unternehmen, die ein Produkt eigenständig „wesentlich verändern“, verschuldensunabhängig als Hersteller haften können.
Ein Produkt soll fehlerhaft sein, wenn es nicht den berechtigten Sicherheitserwartungen „einer Person“ entspricht. Nach dem ProdhaftG sind die Sicherheitserwartungen der Allgemeinheit maßgeblich. Die Erwägungsgründe der Richtlinie stellen klar, dass es auf eine objektive Analyse der Sicherheit ankommt, die die Allgemeinheit berechtigterweise erwarten kann, und nicht auf die subjektive Sicht einer Person.
Bislang muss der Kläger den Produktfehler, den Schaden und den Kausalzusammenhang zwischen beiden beweisen. Die Richtlinie hält hieran fest, sieht zugunsten des Anspruchstellers dabei Beweiserleichterungen vor.
Zukünftig soll unter anderem sowohl die Fehlerhaftigkeit des Produkts als auch der Kausalzusammenhang zwischen dem Produktfehler und dem Schaden (widerlegbar) vermutet werden können, wenn trotz der Offenlegung von Informationen durch das Unternehmen und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zwei Voraussetzungen vorliegen:
- die Beweisführung muss für den Kläger „aufgrund der technischen oder wissenschaftlichen Komplexität übermäßig schwierig“ sein, zum Beispiel wegen der Komplexität des Produkts, der Technologie (z.B. KI-System oder maschinelles Lernen) oder der Komplexität des Kausalzusammenhangs (z.B. zwischen Anwendung eines Arzneimittels und Gesundheitsschaden), und
- der Kläger muss nachgewiesen haben, dass es wahrscheinlich sei, dass das Produkt fehlerhaft war bzw. der Fehler den Schaden verursacht hat.
Stand: Februar 2025