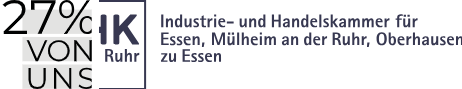Digitale Steuerprüfung
Mit dem BMF-Schreiben vom 28.11.2019 wurden die GoBD neu gefasst und treten an an die Stelle des BMF-Schreibens vom 14.11.2014. Gleichzeitig hat das BMF am gleichen Tag die ergänzenden Informationen zur Datenträgerüberlassung bekanntgegeben.
Gesetzliche Grundlagen
Zum 01.01.2002 hat der Gesetzgeber u.a. die §§ 146, 147 Abgabenordnung (AO) geändert. § 147 AO lautet auszugsweise wie folgt:
Zum 01.01.2002 hat der Gesetzgeber u.a. die §§ 146, 147 Abgabenordnung (AO) geändert. § 147 AO lautet auszugsweise wie folgt:
„(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren:
1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,
2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe,
3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe,
4. Buchungsbelege, –
5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind (...)
1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,
2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe,
3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe,
4. Buchungsbelege, –
5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind (...)
(6) Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. Sie kann im Rahmen einer Außenprüfung auch verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben maschinell ausgewertet oder ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.”
2. Verfahren und Voraussetzungen
Das Recht auf den digitalen Datenzugriff steht der Finanzbehörde ausschließlich im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung (allgemeine Außenprüfung, Lohnsteuer-Außenprüfung und Umsatzsteuer-Sonderprüfung) zu. Das neue Prüfungsrecht tritt neben die Möglichkeit der bisherigen Prüfung. Die Außenprüfung (§§ 193 ff AO) dient der Ermittlung der steuerlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen und wird in der Regel vor Ort, also an dessen Betriebsstätte, durchgeführt.
Das Recht auf den digitalen Datenzugriff steht der Finanzbehörde ausschließlich im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung (allgemeine Außenprüfung, Lohnsteuer-Außenprüfung und Umsatzsteuer-Sonderprüfung) zu. Das neue Prüfungsrecht tritt neben die Möglichkeit der bisherigen Prüfung. Die Außenprüfung (§§ 193 ff AO) dient der Ermittlung der steuerlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen und wird in der Regel vor Ort, also an dessen Betriebsstätte, durchgeführt.
Da es bei einer Außenprüfung um die Ermittlung steuerrechtlicher Sachverhalte geht, darf der Prüfer grundsätzlich auch nur solche Daten einsehen, die steuerlich relevante Informationen enthalten. Schon im Dokumentenmanagementsystem und bei der Archivierung empfiehlt sich daher, zwischen steuerlich relevanten und nicht relevanten Informationen zu trennen. Allerdings ist die Abgrenzung und Einteilung, welche Daten letztlich steuerlich relevant sind, zum Teil schwierig und heftig umstritten sowie einzelfallabhängig.
3. Die drei Zugriffsmöglichkeiten
Kernpunkt der Neuregelungen sind die drei Wahlmöglichkeiten des Zugriffs auf Daten des Steuerpflichtigen:
Kernpunkt der Neuregelungen sind die drei Wahlmöglichkeiten des Zugriffs auf Daten des Steuerpflichtigen:
- unmittelbarer Datenzugriff (sog. Nur-Lese-Zugriff)
- mittelbarer Datenzugriff
- Datenträgerüberlassung
Die Entscheidung, ob überhaupt (der Gesetzeswortlaut des § 147 Abs. 6 AO spricht von „Recht”, nicht von „Pflicht”) und von welcher Möglichkeit des Datenzugriffs der Außenprüfer Gebrauch macht, steht in seinem pflichtgemäßen Ermessen; dabei muss jedoch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Der Außenprüfer darf auch von mehreren Datenzugriffsmöglichkeiten Gebrauch machen und jederzeit im Laufe der Prüfung zu einer anderen Form des Datenzugriffs wechseln, wenn z.B. die bisherige Methode nicht die von ihm gewünschten Ergebnisse erzielt. Im Dialog mit dem Finanzamt sollte versucht werden, einen Konsens zu erzielen, welche Art des Datenzugriffs für den Steuerpflichtigen am geringsten belastend ist.
4. Mitwirkungspflichten
Die Grundsätze der Mitwirkungspflichten im Rahmen einer Außenprüfung sind insbesondere in
§ 200 AO geregelt. Diese umfassen insbesondere die Erteilung von Auskünften, die Vorlage von Aufzeichnungen und Büchern sowie die Auskünfte zum Verständnis der Unterlagen erforderlichen Erläuterungen. Im Rahmen des Datenzugriffs der Finanzverwaltung gelten neben diesen allgemeinen Mitwirkungspflichten noch einige besondere:
Die Grundsätze der Mitwirkungspflichten im Rahmen einer Außenprüfung sind insbesondere in
§ 200 AO geregelt. Diese umfassen insbesondere die Erteilung von Auskünften, die Vorlage von Aufzeichnungen und Büchern sowie die Auskünfte zum Verständnis der Unterlagen erforderlichen Erläuterungen. Im Rahmen des Datenzugriffs der Finanzverwaltung gelten neben diesen allgemeinen Mitwirkungspflichten noch einige besondere:
So ist der Steuerpflichtige beim unmittelbaren Datenzugriff verpflichtet, dem Außenprüfer im Betrieb einen PC samt betrieblich genutzter Software mit den notwendigen Lesezugriffsrechten für die Prüfung zur Verfügung zu stellen und ihn in die betrieblichen Besonderheiten des EDV-Systems einzuweisen.
Bei dem mittelbaren Datenzugriff kommt der Steuerpflichtige seiner Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er für die Auswertung der Daten nach den Kriterien der Finanzbehörde geeignetes Personal zur Verfügung stellt.
Bei der Datenträgerüberlassung sind der Finanzbehörde mit den gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen alle zur Auswertung der Daten notwendigen Informationen (Dateistruktur, Datenfelder, interne und externe Verknüpfungen etc.) in maschinell auswertbarer Form zur Verfügung zu stellen.
Werden die Mitwirkungspflichten verletzt, kann die Finanzbehörde ein Zwangsgeld (§§ 328, 329 AO) festsetzen oder die Besteuerungsgrundlagen schätzen (§ 162 AO).
Mit dem Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) ist ein weiteres Instrument zur Durchsetzbarkeit des Rechts auf Datenzugriff geschaffen worden, namentlich das Verzögerungsgeld nach §§ 146 Abs. 2b, 147 Abs. 6 AO. Hintergrund dieser Neuregelung war ursprünglich die Verlagerung der Buchführung und der entsprechenden Unterlagen ins Ausland. So begründet der gleichsam durch das JStG 2009 hinzugefügte § 146 Abs. 2a AO dem Steuerpflichtigen unter bestimmten Voraussetzungen zwar das Recht, elektronische Bücher in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu führen und aufzubewahren: Gleichzeitig erhält die Finanzbehörde die gesetzliche Ermächtigung für die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes bis zu 250.000 € für die Fälle, in denen der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverlagerung seiner elektronischen Buchführung oder seinen Pflichten zur Einräumung des Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6 AO (siehe oben), zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage angeforderter Unterlagen im Rahmen einer Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen Frist nach Bekanntgabe durch die zuständige Finanzbehörde nicht nachkommt oder er seine elektronische Buchführung ohne Bewilligung der zuständigen Finanzbehörde ins Ausland verlagert hat. Nach der Gesetzesbegründung ist die Sanktion zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sowohl auf Inlands- als auch auf Auslandssachverhalte bezogen.
Auch die Archivierung und Aufbewahrung von maschinell erstellten Daten zählt zu den Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen im weitesten Sinne. Die originär digitalen Unterlagen dürfen nicht ausschließlich in ausgedruckter Form oder auf Mikrofilm aufbewahrt werden. Je nach Art der Unterlagen beträgt die Aufbewahrungsfrist sechs oder zehn Jahre.
Werden die Mitwirkungspflichten verletzt, kann die Finanzbehörde ein Zwangsgeld (§§ 328, 329 AO) festsetzen oder die Besteuerungsgrundlagen schätzen (§ 162 AO).
Mit dem Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) ist ein weiteres Instrument zur Durchsetzbarkeit des Rechts auf Datenzugriff geschaffen worden, namentlich das Verzögerungsgeld nach §§ 146 Abs. 2b, 147 Abs. 6 AO. Hintergrund dieser Neuregelung war ursprünglich die Verlagerung der Buchführung und der entsprechenden Unterlagen ins Ausland. So begründet der gleichsam durch das JStG 2009 hinzugefügte § 146 Abs. 2a AO dem Steuerpflichtigen unter bestimmten Voraussetzungen zwar das Recht, elektronische Bücher in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu führen und aufzubewahren: Gleichzeitig erhält die Finanzbehörde die gesetzliche Ermächtigung für die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes bis zu 250.000 € für die Fälle, in denen der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverlagerung seiner elektronischen Buchführung oder seinen Pflichten zur Einräumung des Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6 AO (siehe oben), zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage angeforderter Unterlagen im Rahmen einer Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen Frist nach Bekanntgabe durch die zuständige Finanzbehörde nicht nachkommt oder er seine elektronische Buchführung ohne Bewilligung der zuständigen Finanzbehörde ins Ausland verlagert hat. Nach der Gesetzesbegründung ist die Sanktion zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sowohl auf Inlands- als auch auf Auslandssachverhalte bezogen.
Auch die Archivierung und Aufbewahrung von maschinell erstellten Daten zählt zu den Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen im weitesten Sinne. Die originär digitalen Unterlagen dürfen nicht ausschließlich in ausgedruckter Form oder auf Mikrofilm aufbewahrt werden. Je nach Art der Unterlagen beträgt die Aufbewahrungsfrist sechs oder zehn Jahre.
Weitere Informationen zum Thema "Aufbewahrungsfristen" erhalten Sie hier .
Stand: Januar 2021