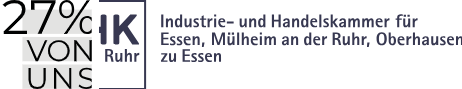Handel und (Innen-)Stadtentwicklung
Innenstädte und urbane Zentren sind seit jeher Orte des urbanen Lebens, die vor allem geprägt sind durch Handel, Wohnen, Arbeit, Kultur, Tourismus und das Aufeinandertreffen und Zusammenkommen von verschiedenen Menschen.
Orte des urbanen Lebens
Insbesondere diese Art der Lebendigkeit und der breiten Nutzungsmischung bringt es mit sich, dass sich innerstädtische Zentren in einem stetigen Prozess des Wandels befinden. Im Laufe der Zeit manifestierte sich dieser Wandel: Während der Industrialisierung in den vergangenen Jahrhunderten waren Produktion und Wohnen die vorherrschenden Faktoren in städtischen Gebieten. Ab den 1920er Jahren begannen Kaufhäuser das Stadtbild mitzuprägen. In der Nachkriegszeit wurden sie nicht nur städtebaulich und architektonisch bedeutsam, sondern auch funktional, und gehörten fortan zu den grundlegenden und konstituierenden Elementen der Innenstadtentwicklung. Sie beeinflussten und dominierten in Teilen den eingesessenen eigentümergeführten Einzelhandel. Mit den 1980er Jahren erlangte die zunehmende Filialisierung im Einzelhandel und die Errichtung von Einkaufszentren verstärkten Einzug in die Innenstädte und städtischen Zentren.
Die rasant voranschreitende Digitalisierung, die durch die Corona-Pandemie noch weiter verstärkt wurde, markiert einen zusätzlichen Meilenstein in der Entwicklung von Innenstädten.
Nicht nur das physische Erscheinungsbild der Innenstadt selbst verändert sich, sondern auch die Gesellschaft als Nutzer der Innenstadt erlebt einen Wandel. Dies zeigt sich beispielsweise anhand des Konsumverhaltens, bei dem Nachhaltigkeit bei Kaufentscheidungen zunehmend eine bedeutende Rolle spielt. Dieser Trend spiegelt sich ebenfalls in einem wachsenden Angebot an regionalen und umweltfreundlich produzierten Waren wider. Die COVID-19-Pandemie beschleunigt außerdem die Veränderungen in der Arbeitswelt. Homeoffice und Co-Working werden auch in Zukunft vermehrt gefragt und genutzt werden.
Innenstädte und (Stadtteil-)Zentren erfüllen nicht nur einer Versorgungs- sondern auch eine vielfältige Vernetzungsfunktion. Hier kommen Menschen und Unternehmen zusammen, um sich auszutauschen und miteinander zu vernetzen. Interessenten, Kunden und Käufer finden eine breite Palette an Waren und Dienstleistungen vor. Unternehmen haben die Möglichkeit, Arbeitskräfte und talentierte Köpfe zu rekrutieren. Touristen sind auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten, Gastronomieangeboten und öffentlichen Plätzen. Urbane Gebiete sind wesentliche Schauplätze für politische Meinungsäußerungen, Kundgebungen und Protestaktionen. Die Vernetzungsfunktion geht weit über den bloßen Warenaustausch hinaus. Neuartige Innenstadtentwicklungskonzepte sollten daher verstärkt auf die unterschiedlichen Funktionen der Innenstädte und Zentren eingehen. Nutzungen wie Produktion, Logistik, Wohnen, Dienstleistungen, Kultur, Bildung und Tourismus müssen bei der Erarbeitung von Zielbildern genauso berücksichtigt werden, wie die Themen Gesundheit, Aufenthaltsqualität, Digitalisierung, Sauberkeit und Sicherheit.
Die Innenstädte unterliegen seit jeher einem stetigen Wandel und stehen weiterhin unter Druck. Der Trend zum Onlinehandel, die Pandemie, die Energiekrise und die Inflation münden im Zusammenspiel in eine beispiellose Krisenschleife. Die Auswirkungen des Klimawandels stellt die Einkaufsquartiere vor neue und weitere Herausforderungen: ein verstärkter Fokus auf „nachhaltige (Innen-) Stadtentwicklung“ ist notwendig und es herrscht Einigkeit darüber, dass Handel allein die Innenstadt nicht retten kann. Nichtsdestotrotz sind der Handel und die Gastronomie immer noch die Hauptgründe, die Besucher in eine Innenstadt ziehen.
Die Städte streben danach, ihre Innenstädte lebendig, attraktiv und funktional zu gestalten. Dies kann durch die Schaffung von gemischten Nutzungen, wie Wohnen, Büros, Einzelhandel und kulturellen Einrichtungen erreicht werden.
Lebhafte Innenstädte, belebte Fußgängerzonen, Grünflächen und attraktiv gestaltete öffentliche Plätze sind Anziehungspunkte einer lebenswerten und zukunftsfähigen Innenstadt.
Die Transformation und Weiterentwicklung der urbanen Zentren hin zu multifunktionalen und gleichsam resilienten Innenstädten kann aber nur als Gemeinschaftsaufgabe der Kommunen, der Wirtschaft und der Stadtgesellschaft (im Sinne der Zivilgesellschaft) mit Unterstützung des Bundes und der Länder bewältigt werden.
Braucht man noch den Handel in den Innenstädten?
Die Antwort auf die Frage ist eindeutig: Ja! Die Zukunft des Einzelhandels ist eng mit der Zukunft der Städte verknüpft. Stadt und Handel unterhalten eine wechselseitige und nahezu symbiotische Beziehung zueinander und ihre Herausforderungen und Aussichten sind – zumindest abseits der grünen Wiese – untrennbar miteinander verbunden.
Der Handel gehört zu den fundamentalen Gründungselementen vieler Städte, weshalb zu Recht, immer wieder auf die gegenseitige Bedingtheit (Stadt braucht Handel und Handel braucht Stadt) hingewiesen wird. Seit jeher ist die europäische Stadt nicht nur ein Wohnort für Bürger, sondern auch ein Handelszentrum, in dem Stadt und Handel eng miteinander verwoben sind.
Neben seiner originären Versorgungsfunktion erfüllt der Handel in den Innenstädten auch gestalterische und soziale Aufgaben: Er fungiert als verbindendes Element für Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Bildung sowie öffentliche und private Dienstleistungen. Durch seine belebende Wirkung trug und trägt der Handel erheblich zur Anziehungskraft öffentlicher innerstädtischer Plätze und zum urbanen Leben bei.
Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Entwicklung des Einzelhandels auch maßgeblich das Antlitz unserer Städte mitgeprägt hat. Diese Art der Nutzungsmischung und sozialen Vielfalt im Sinne des Leitbilds der Europäischen Stadt wird für die zukünftige Entwicklung unserer Städte wieder eine größere Bedeutung zuteilwerden.
Im Einzelhandelssektor sind allerdings langfristige Einbußen zu erwarten. Strategien zur Innenstadtentwicklung, die nur auf die Handelsentwicklung abzielen, verlieren ihre Wirksamkeit.
Dieser Verlust wird spürbar und offensichtlich sein. Diese Entwicklung allein verdeutlicht, dass Strategien zur Innenstadtentwicklung, die hauptsächlich und in erster Linie auf die Handelsentwicklung abzielen, an Bedeutung verlieren werden, da der Handel seine bisherige dominante Rolle sukzessive einbüßen wird. Der langjährige Trend „weg von der nahezu ausschließlichen Einkaufsinnenstadt“ wird sich höchstwahrscheinlich weiter verstärken.
Vor diesem Hintergrund wird es künftig umso wichtiger sein, die vorhandenen Potenziale des Handels und der Handelsstandorte vollumfänglich abzurufen. Einerseits vom Handel selbst, andererseits auch durch die gezielte strategische Weiterentwicklung der Handelsstandorte zu multifunktionalen Zentren. Denn der Handel selbst wird die von ihm benötigten Besucherfrequenzen in seiner derzeitigen Form außerhalb der Nahversorgung nur noch vereinzelt herbeiführen können. Um Konsumentinnen und Konsumenten altersgruppenübergreifend wieder zurück in die urbanen Zentren zu holen und zum Verweilen und Konsumieren anzuregen, sind dort neben „Einkaufen/Shopping“ künftig verstärkt auch andere potenzielle Besuchsmotive zu bedienen. Und so wird der Handel in Innenstädten künftig vermehrt mit gastronomischen Einrichtungen und Kultur- und Freizeiteinrichtungen verknüpft werden, indem beispielsweise Cafés in Buchhandlungen und Bekleidungsgeschäften öffnen oder abendliche Menüs mit Kulturveranstaltungen (Lesungen, Theater…) verbunden werden.
Die veränderten Einkaufs- und Konsumgewohnheiten, die vermehrt auf den Online-Bereich ausgerichtet sind, haben sich verfestigt. Das Onlineshopping verzeichnet Zuwächse in allen Altersgruppen und ersetzt zunehmend den physischen Besuch der Innenstadt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt und den Druck auf Städte und den stationären Handel verstärkt. Der Handel und die Innenstädte stehen somit vor bedeutenden Herausforderungen. Diese müssen nun mit Entschlossenheit und einem optimistischen Gestaltungswillen angegangen werden.
Grundsätzlich bleibt der Handel in den Innenstädten aber weiterhin wichtig, wobei sich seine Form durchaus verändern wird. Der stationäre Einzelhandel spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle, da er ein Einkaufserlebnis bieten kann. Dieses Erlebnis und die individuelle Beratung müssen wieder in den Vordergrund gelenkt werden. Click and Collect wird ein zunehmend wichtiger Bestandteil sein.
Was macht die IHK?
- Zukunftsthema Nachhaltigkeit
- Interessenvertretung
- Workshops in der Essener Innenstadt (Wirtschaftsinteressen in diesen Konzepten platzieren)
- Handelstag NRW: 1x jährlich
- Informationsveranstaltungen (digitaler Donnerstag)
- Arbeitskreise Sichere Innenstadt
- Arbeitskreise Einzelhandel
- Austausch und enger Kontakt zu Wirtschaftsförderungen
- Handelsausschuss
- Nachfolge