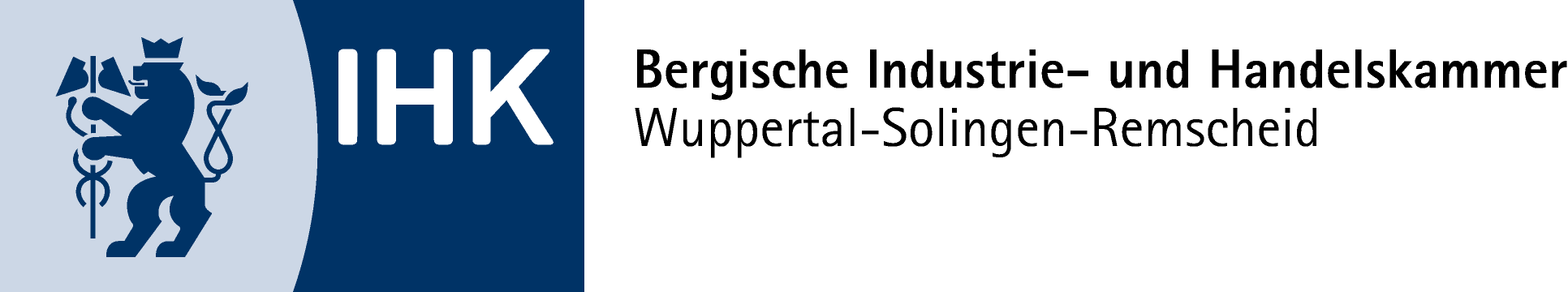Welche Formalitäten sind bei der Unternehmensgründung zu beachten?
Welche Formalitäten sind zu beachten?
Die Frage nach den Formalitäten bei der Unternehmensgründung hängt zunächst von der Art des geplanten Unternehmens ab. Die selbständigen Unternehmer werden in Urproduzenten, Freiberufler und Gewerbetreibende eingeteilt.
Unter Urproduktion versteht man insbesondere die Land- und Forstwirtschaft, Gärtnerei, Fischerei- und Tierzucht.
Freie Berufe sind wissenschaftliche, künstlerische, erzieherische, schriftstellerische Tätigkeiten oder qualitativ höherwertige persönliche Dienstleistungen, für die regelmäßig eine höhere Bildung erforderlich ist. Ärzte, Rechtsanwälte, Journalisten, Künstler, Dolmetscher, Architekten und Ingenieure üben beispielsweise einen freien Beruf aus.
Freiberufler und Urproduzenten müssen kein Gewerbe anmelden, sich aber beim zuständigen Finanzamt anmelden. Auch steuerlich werden sie anders behandelt als Gewerbetreibende. In Zweifelsfällen sollten Sie sich direkt mit Ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen.
Zweifelsohne sind die Gewerbetreibenden die größte Gruppe der Selbständigen. Darunter fallen alle Tätigkeiten in den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk sowie nicht freiberufliche Dienstleistungen.
Die Gewerbeordnung kennt drei verschiedene Möglichkeiten, ein Gewerbe auszuüben. An die einzelnen Formen werden verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Man unterscheidet:
Stehendes Gewerbe
Das stehende Gewerbe ist der häufigste Fall. Es ist dann gegeben, wenn das Gewerbe von einer dauernden Niederlassung – zum Beispiel einem Geschäftslokal, einem Büro oder einer Werkstatt – aus betrieben wird. Bei Beginn des Gewerbes sind Sie verpflichtet, den Betrieb bei der Gewerbemeldestelle Ihrer Gemeinde anzuzeigen. Das gilt unabhängig von der Rechtsform und der Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.
Die Anzeige soll der zuständigen Behörde die Überwachung der Gewerbeausübung ermöglichen. Verlegen Sie Ihren Betrieb, eröffnen Sie eine Zweigstelle oder wechseln Sie den Gegenstand Ihres Gewerbes, gilt ebenfalls die Anzeigepflicht. Auch die Aufgabe eines Gewerbes ist anzeigepflichtig.
Die Gewerbemeldestelle benachrichtigt weitere Stellen, denen sie eine Durchschrift Ihrer Anzeige übermittelt, insbesondere das Finanzamt, die Berufsgenossenschaft, die Industrie- und Handelskammer (IHK) oder die Handwerkskammer, das Staatliche Amt für Arbeitsschutz, das statistische Landesamt.
Das Grundgesetz garantiert allen Deutschen grundsätzlich das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsplatz frei zu wählen. Eine behördliche Erlaubnis für die Ausübung eines Gewerbes ist deshalb meist nicht erforderlich. Dies gilt für weite Bereiche des Einzel- und Großhandels, die meisten Dienstleistungen und industrielle Arbeiten.
In bestimmten Fällen verlangt das Gesetz aber für den Betrieb des Gewerbes eine behördliche Zulassung. Für die Erteilung der erforderlichen Erlaubnis kommt es regelmäßig auf die Zuverlässigkeit des Inhabers an, nur in einigen Fällen wird ein Sachkundenachweis verlangt.
Erkundigen Sie sich frühzeitig nach den Voraussetzungen und Anforderungen an die Erteilung der jeweiligen Erlaubnis, da sich das Verfahren oft einige Zeit hinzieht.
Persönliche und wirtschaftliche Zuverlässigkeit
Bei einer Reihe von Gewerben ist die Erteilung der Erlaubnis von der Zuverlässigkeit des Bewerbers abhängig. Zu diesem Zweck muss der Bewerber ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sowie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts beibringen. Zusätzlich werden die Insolvenzabteilung des Amtsgerichts und das Schuldnerverzeichnis sowie das Ordnungsamt und die Industrie- und Handelskammer um Stellungnahme gebeten. Betroffen sind davon beispielsweise:
Gastwirte, Betreiber von Privatkrankenanstalten, Aufsteller von Spielgeräten, Spielhallenbetreiber, Pfandleiher, Bewachungsunternehmer, Versteigerer, Makler (Darlehensvermittler, Wohnungsmakler) Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter) und Versicherungsberater, Bauträger und Baubetreuer, Transportunternehmer sowie diejenigen, die eine Arbeitnehmerüberlassung eröffnen möchten.
Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass der Antragsteller unzuverlässig ist, wird die Erlaubnis nicht erteilt. Als unzuverlässig gilt, wer nicht unerhebliche Steuerrückstände hat, gewerbebezogene Vorstrafen aufweist oder gravierende Ordnungswidrigkeiten begangen hat oder wirtschaftlich leistungsunfähig ist.
Für bestimmte Tätigkeiten – dazu zählen: Pfandleihe, Bewachungs- und Transportgewerbe – muss man sogar nachweisen, dass beim Unternehmensstart ausreichende finanzielle Mittel oder Sicherheiten zur Verfügung stehen.
Sachkundenachweis
In einigen Fällen soll der Inhaber ein gewisses Maß an Sachkunde besitzen, so zum Beispiel bei Gaststätten, bei Bewachungsunternehmen, beim Handel mit frei verkäuflichen Arzneimitteln, beim Handel mit und bei der Herstellung von Waffen sowie im Bewachungs- und Verkehrsgewerbe (Güterverkehr, Personenbeförderung) sowie bei der Versicherungsvermittlung und -beratung.
Wie der Nachweis der Sachkunde erbracht werden muss, ist völlig unterschiedlich. Zum Beispiel reicht es für die Eröffnung einer Gaststätte, bei der Industrie- und Handelskammer an einer Unterrichtung teilgenommen zu haben.
Für das Verkehrsgewerbe müssen je nach angestrebter Tätigkeit unterschiedliche Prüfungen abgelegt werden.
Bedürfnisprüfung
Eine Begrenzung der Anbieter einer bestimmten Branche gibt es nur sehr selten. So wird zum Beispiel in den meisten Bundesländern die zulässige Zahl der Taxis behördlich begrenzt.
Handwerk
Besonderheiten gelten für die Ausübung eines Handwerks. Der selbständige Betrieb eines Handwerks als stehendes Gewerbe ist nur natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften (Personenhandelsgesellschaften – OHG und KG – und Gesellschaften bürgerlichen Rechts) gestattet, die in der Handwerksrolle – mit dem zu betreibenden Handwerk oder einem mit diesem verwandten Handwerk – eingetragen sind.
Grundsätzlich wird in die Handwerksrolle eingetragen, wer Handwerksmeister, Ingenieur oder im Besitz einer Ausnahmebewilligung der Handwerkskammer ist, außerdem, wer nach der ab dem 1. April 2004 geltenden Rechtslage als Handwerksgeselle nach einer Berufstätigkeit von insgesamt mindestens sechs Jahren, davon insgesamt vier Jahre in leitender Stellung, eine Ausübungsberechtigung erhält. Eine Ausübungsberechtigung ist allerdings in folgenden Gewerben nicht möglich: Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechniker, Schornsteinfeger und Zahntechniker.
Nach der Novelle der Handwerksordnung zum 01.01.2004 sind in der Anlage A zur Handwerksordnung (HwO) nur noch 41 (statt vorher 94) Gewerbe aufgeführt, die als zulassungspflichtige Handwerke betrieben werden können.
Ein Gewerbebetrieb ist ein Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks, wenn er handwerksmäßig (nicht industriell) betrieben wird und ein Gewerbe vollständig umfasst, das in der Anlage A aufgeführt ist, oder wenn Tätigkeiten ausgeübt werden, die für dieses Gewerbe wesentlich sind (wesentliche Tätigkeiten).
Keine wesentlichen Tätigkeiten sind insbesondere solche, die
1. in einem Zeitraum von bis zu drei Monaten erlernt werden können,
2. zwar eine längere Anlernzeit verlangen, aber für das Gesamtbild des betreffenden zulassungspflichtigen Handwerks nebensächlich sind und deswegen nicht die Fertigkeiten erfordern, auf die die Ausbildung in diesem Handwerk hauptsächlich ausgerichtet ist,
oder
3. nicht aus einem zulassungspflichtigen Handwerk entstanden sind.
Anders als bisher ist es nun Unternehmen aller Rechtsformen (und nicht mehr nur juristischen Personen) möglich, einen Betriebsleiter zu beschäftigen, der die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt.
Dagegen enthält die Anlage B zur Handwerksordnung ein Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie oder handwerksähnliche Gewerbe betrieben werden können und keiner Eintragung in die Handwerksrolle (mehr) bedürfen. Unter "Weitere Informationen" finden Sie die Listen der zulassungspflichtigen, zulassungsfreien Handwerke und der handwerksähnlichen Gewerbe.
Die Vorschriften der Handwerksordnung gelten auch für handwerkliche Nebenbetriebe, die mit einem Unternehmen des Handwerks, der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft oder sonstiger Wirtschafts- und Berufszweige verbunden sind, es sei denn, dass eine solche Tätigkeit nur in unerheblichem Umfang ausgeübt wird oder dass es sich um einen Hilfsbetrieb handelt, in dem insbesondere Garantie- und Gewährleistungsarbeiten oder Tätigkeiten für den Hauptbetrieb ausgeübt werden.
Unerheblich ist eine Tätigkeit, wenn sie während eines Jahres die durchschnittliche Arbeitszeit eines ohne Hilfskräfte Vollzeit arbeitenden Betriebs des betreffenden Handwerkszweigs nicht übersteigt.
Weitere Informationen zur Handwerksausübung erhalten Sie bei der
Handwerkskammer Düsseldorf (Telefax 02 11 / 87 95 - 5 15) von
Manfred Steinritz, Telefon 02 11 / 87 95 - 5 20, E-Mail: steinritz@hwk-duesseldorf.de
oder
Bernd Rosemann, Telefon 02 11 / 87 95 - 5 30, E-Mail: rosemann@hwk-duesseldorf.de
Baurecht
Neben den gewerberechtlichen Fragen sollten Existenzgründer auch die baurechtlichen Bedingungen rechtzeitig in ihre Planung einbeziehen. So sind schon durch den örtlichen Bebauungsplan oft Einschränkungen hinsichtlich der gewerblichen Nutzung in bestimmten Gebieten vorgesehen. Für einige Gewerbearten kommen baurechtliche Vorgaben hinzu; beispielsweise müssen Gaststätten über Toilettenräume verfügen, es sei denn, dass Gaststätten mit einer Aufenthaltsfläche für Gäste von maximal 50 Quadratmetern nur alkoholfreie Getränke und zubereitete Speisen verabreichen und im Eingangsbereich deutlich darauf hinweisen, dass keine Gästetoiletten vorhanden sind.
Nach den örtlichen Stellplatzverordnungen muss zudem eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung stehen. Klären Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob an dem gewählten Standort der Betrieb Ihres Gewerbes erlaubt ist und welche baulichen Auflagen erfüllt werden müssen. Nähere Auskünfte hierzu erteilt das örtlich zuständige Bauordnungsamt.
Reisegewerbe
Ein Reisegewerbe betreibt, wer – ohne vorherige Bestellung – außerhalb einer gewerblichen Niederlassung Waren oder Leistungen anbietet oder Bestellungen aufnimmt. Dazu zählen beispielsweise der Straßenverkauf aus einem Wagen oder Stand und die Tätigkeit von Schaustellern. Als Reisegewerbetreibender benötigen Sie eine Erlaubnis, die sogenannte Reisegewerbekarte, die beim Ordnungsamt an Ihrem Wohnsitz zu beantragen ist. Eine solche Karte wird erteilt, wenn keine Tatsachen bekannt sind, wonach der Antragsteller für die Tätigkeit als unzuverlässig gelten muss. Sie kann auch eingeschränkt, befristet oder mit Auflagen verbunden sein.
Reisegewerbetreibende sind verpflichtet, ihre Reisegewerbekarte während der Ausübung des Gewerbes mitzuführen und auf Verlangen eines Mitarbeiter des zuständigen Ordnungsamts vorzuzeigen.
Beachten Sie, dass Sie für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes – zum Beispiel beim Aufstellen eines Verkaufsstands in der Fußgängerzone – zusätzlich eine Sondernutzungserlaubnis der zuständigen Gemeinde benötigen. Die Veranstaltung eines sogenannten Wanderlagers, das heißt der Vertrieb von Waren aus einer nur vorübergehenden Verkaufsstelle, fällt ebenfalls unter den Begriff des Reisegewerbes und muss zwei Wochen vor Beginn der örtlichen Gemeindeverwaltung angezeigt werden.
Marktgewerbe
Zum Marktverkehr zählen nach der Gewerbeordnung Messen, Ausstellungen und Märkte. Bei den Märkten unterscheidet das Gesetz nach Großmärkten, auf denen bestimmte Waren an gewerbliche Wiederverkäufer oder Großabnehmer vertreiben werden, Wochenmärkten, die hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse anbieten, sowie Spezial- und Jahrmärkten.
Für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen benötigen Sie weder eine Gewerbeanmeldung noch eine Reisegewerbekarte, die Veranstaltung muss aber vom zuständigen Ordnungsamt auf Antrag des Veranstalters festgesetzt werden. Die Behörde kann einem Aussteller oder Anbieter die Teilnahme untersagen, wenn die Annahme besteht, dass er hierfür die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.
Besondere Regelungen
Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union dürfen sich nur selbständig machen, wenn keine ausländerrechtlichen Beschränkungen bestehen. Eine derartige Beschränkung liegt vor, wenn der Aufenthaltstitel mit dem Vermerk "Selbständige oder vergleichbare unselbständige Erwerbstätigkeit nicht gestattet." versehen ist. In diesen Fällen können die Inhaber aber eine Änderung beantragen, der aber nur dann stattgegeben wird, wenn der Antragsteller ausreichende Vorkenntnisse für das beabsichtigte Gewerbe besitzt und an der Tätigkeit ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales Bedürfnis besteht.
Unter Urproduktion versteht man insbesondere die Land- und Forstwirtschaft, Gärtnerei, Fischerei- und Tierzucht.
Freie Berufe sind wissenschaftliche, künstlerische, erzieherische, schriftstellerische Tätigkeiten oder qualitativ höherwertige persönliche Dienstleistungen, für die regelmäßig eine höhere Bildung erforderlich ist. Ärzte, Rechtsanwälte, Journalisten, Künstler, Dolmetscher, Architekten und Ingenieure üben beispielsweise einen freien Beruf aus.
Freiberufler und Urproduzenten müssen kein Gewerbe anmelden, sich aber beim zuständigen Finanzamt anmelden. Auch steuerlich werden sie anders behandelt als Gewerbetreibende. In Zweifelsfällen sollten Sie sich direkt mit Ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen.
Zweifelsohne sind die Gewerbetreibenden die größte Gruppe der Selbständigen. Darunter fallen alle Tätigkeiten in den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk sowie nicht freiberufliche Dienstleistungen.
Die Gewerbeordnung kennt drei verschiedene Möglichkeiten, ein Gewerbe auszuüben. An die einzelnen Formen werden verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Man unterscheidet:
Stehendes Gewerbe
Das stehende Gewerbe ist der häufigste Fall. Es ist dann gegeben, wenn das Gewerbe von einer dauernden Niederlassung – zum Beispiel einem Geschäftslokal, einem Büro oder einer Werkstatt – aus betrieben wird. Bei Beginn des Gewerbes sind Sie verpflichtet, den Betrieb bei der Gewerbemeldestelle Ihrer Gemeinde anzuzeigen. Das gilt unabhängig von der Rechtsform und der Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.
Die Anzeige soll der zuständigen Behörde die Überwachung der Gewerbeausübung ermöglichen. Verlegen Sie Ihren Betrieb, eröffnen Sie eine Zweigstelle oder wechseln Sie den Gegenstand Ihres Gewerbes, gilt ebenfalls die Anzeigepflicht. Auch die Aufgabe eines Gewerbes ist anzeigepflichtig.
Die Gewerbemeldestelle benachrichtigt weitere Stellen, denen sie eine Durchschrift Ihrer Anzeige übermittelt, insbesondere das Finanzamt, die Berufsgenossenschaft, die Industrie- und Handelskammer (IHK) oder die Handwerkskammer, das Staatliche Amt für Arbeitsschutz, das statistische Landesamt.
Das Grundgesetz garantiert allen Deutschen grundsätzlich das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsplatz frei zu wählen. Eine behördliche Erlaubnis für die Ausübung eines Gewerbes ist deshalb meist nicht erforderlich. Dies gilt für weite Bereiche des Einzel- und Großhandels, die meisten Dienstleistungen und industrielle Arbeiten.
In bestimmten Fällen verlangt das Gesetz aber für den Betrieb des Gewerbes eine behördliche Zulassung. Für die Erteilung der erforderlichen Erlaubnis kommt es regelmäßig auf die Zuverlässigkeit des Inhabers an, nur in einigen Fällen wird ein Sachkundenachweis verlangt.
Erkundigen Sie sich frühzeitig nach den Voraussetzungen und Anforderungen an die Erteilung der jeweiligen Erlaubnis, da sich das Verfahren oft einige Zeit hinzieht.
Persönliche und wirtschaftliche Zuverlässigkeit
Bei einer Reihe von Gewerben ist die Erteilung der Erlaubnis von der Zuverlässigkeit des Bewerbers abhängig. Zu diesem Zweck muss der Bewerber ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sowie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts beibringen. Zusätzlich werden die Insolvenzabteilung des Amtsgerichts und das Schuldnerverzeichnis sowie das Ordnungsamt und die Industrie- und Handelskammer um Stellungnahme gebeten. Betroffen sind davon beispielsweise:
Gastwirte, Betreiber von Privatkrankenanstalten, Aufsteller von Spielgeräten, Spielhallenbetreiber, Pfandleiher, Bewachungsunternehmer, Versteigerer, Makler (Darlehensvermittler, Wohnungsmakler) Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter) und Versicherungsberater, Bauträger und Baubetreuer, Transportunternehmer sowie diejenigen, die eine Arbeitnehmerüberlassung eröffnen möchten.
Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass der Antragsteller unzuverlässig ist, wird die Erlaubnis nicht erteilt. Als unzuverlässig gilt, wer nicht unerhebliche Steuerrückstände hat, gewerbebezogene Vorstrafen aufweist oder gravierende Ordnungswidrigkeiten begangen hat oder wirtschaftlich leistungsunfähig ist.
Für bestimmte Tätigkeiten – dazu zählen: Pfandleihe, Bewachungs- und Transportgewerbe – muss man sogar nachweisen, dass beim Unternehmensstart ausreichende finanzielle Mittel oder Sicherheiten zur Verfügung stehen.
Sachkundenachweis
In einigen Fällen soll der Inhaber ein gewisses Maß an Sachkunde besitzen, so zum Beispiel bei Gaststätten, bei Bewachungsunternehmen, beim Handel mit frei verkäuflichen Arzneimitteln, beim Handel mit und bei der Herstellung von Waffen sowie im Bewachungs- und Verkehrsgewerbe (Güterverkehr, Personenbeförderung) sowie bei der Versicherungsvermittlung und -beratung.
Wie der Nachweis der Sachkunde erbracht werden muss, ist völlig unterschiedlich. Zum Beispiel reicht es für die Eröffnung einer Gaststätte, bei der Industrie- und Handelskammer an einer Unterrichtung teilgenommen zu haben.
Für das Verkehrsgewerbe müssen je nach angestrebter Tätigkeit unterschiedliche Prüfungen abgelegt werden.
Bedürfnisprüfung
Eine Begrenzung der Anbieter einer bestimmten Branche gibt es nur sehr selten. So wird zum Beispiel in den meisten Bundesländern die zulässige Zahl der Taxis behördlich begrenzt.
Handwerk
Besonderheiten gelten für die Ausübung eines Handwerks. Der selbständige Betrieb eines Handwerks als stehendes Gewerbe ist nur natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften (Personenhandelsgesellschaften – OHG und KG – und Gesellschaften bürgerlichen Rechts) gestattet, die in der Handwerksrolle – mit dem zu betreibenden Handwerk oder einem mit diesem verwandten Handwerk – eingetragen sind.
Grundsätzlich wird in die Handwerksrolle eingetragen, wer Handwerksmeister, Ingenieur oder im Besitz einer Ausnahmebewilligung der Handwerkskammer ist, außerdem, wer nach der ab dem 1. April 2004 geltenden Rechtslage als Handwerksgeselle nach einer Berufstätigkeit von insgesamt mindestens sechs Jahren, davon insgesamt vier Jahre in leitender Stellung, eine Ausübungsberechtigung erhält. Eine Ausübungsberechtigung ist allerdings in folgenden Gewerben nicht möglich: Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechniker, Schornsteinfeger und Zahntechniker.
Nach der Novelle der Handwerksordnung zum 01.01.2004 sind in der Anlage A zur Handwerksordnung (HwO) nur noch 41 (statt vorher 94) Gewerbe aufgeführt, die als zulassungspflichtige Handwerke betrieben werden können.
Ein Gewerbebetrieb ist ein Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks, wenn er handwerksmäßig (nicht industriell) betrieben wird und ein Gewerbe vollständig umfasst, das in der Anlage A aufgeführt ist, oder wenn Tätigkeiten ausgeübt werden, die für dieses Gewerbe wesentlich sind (wesentliche Tätigkeiten).
Keine wesentlichen Tätigkeiten sind insbesondere solche, die
1. in einem Zeitraum von bis zu drei Monaten erlernt werden können,
2. zwar eine längere Anlernzeit verlangen, aber für das Gesamtbild des betreffenden zulassungspflichtigen Handwerks nebensächlich sind und deswegen nicht die Fertigkeiten erfordern, auf die die Ausbildung in diesem Handwerk hauptsächlich ausgerichtet ist,
oder
3. nicht aus einem zulassungspflichtigen Handwerk entstanden sind.
Anders als bisher ist es nun Unternehmen aller Rechtsformen (und nicht mehr nur juristischen Personen) möglich, einen Betriebsleiter zu beschäftigen, der die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt.
Dagegen enthält die Anlage B zur Handwerksordnung ein Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie oder handwerksähnliche Gewerbe betrieben werden können und keiner Eintragung in die Handwerksrolle (mehr) bedürfen. Unter "Weitere Informationen" finden Sie die Listen der zulassungspflichtigen, zulassungsfreien Handwerke und der handwerksähnlichen Gewerbe.
Die Vorschriften der Handwerksordnung gelten auch für handwerkliche Nebenbetriebe, die mit einem Unternehmen des Handwerks, der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft oder sonstiger Wirtschafts- und Berufszweige verbunden sind, es sei denn, dass eine solche Tätigkeit nur in unerheblichem Umfang ausgeübt wird oder dass es sich um einen Hilfsbetrieb handelt, in dem insbesondere Garantie- und Gewährleistungsarbeiten oder Tätigkeiten für den Hauptbetrieb ausgeübt werden.
Unerheblich ist eine Tätigkeit, wenn sie während eines Jahres die durchschnittliche Arbeitszeit eines ohne Hilfskräfte Vollzeit arbeitenden Betriebs des betreffenden Handwerkszweigs nicht übersteigt.
Weitere Informationen zur Handwerksausübung erhalten Sie bei der
Handwerkskammer Düsseldorf (Telefax 02 11 / 87 95 - 5 15) von
Manfred Steinritz, Telefon 02 11 / 87 95 - 5 20, E-Mail: steinritz@hwk-duesseldorf.de
oder
Bernd Rosemann, Telefon 02 11 / 87 95 - 5 30, E-Mail: rosemann@hwk-duesseldorf.de
Baurecht
Neben den gewerberechtlichen Fragen sollten Existenzgründer auch die baurechtlichen Bedingungen rechtzeitig in ihre Planung einbeziehen. So sind schon durch den örtlichen Bebauungsplan oft Einschränkungen hinsichtlich der gewerblichen Nutzung in bestimmten Gebieten vorgesehen. Für einige Gewerbearten kommen baurechtliche Vorgaben hinzu; beispielsweise müssen Gaststätten über Toilettenräume verfügen, es sei denn, dass Gaststätten mit einer Aufenthaltsfläche für Gäste von maximal 50 Quadratmetern nur alkoholfreie Getränke und zubereitete Speisen verabreichen und im Eingangsbereich deutlich darauf hinweisen, dass keine Gästetoiletten vorhanden sind.
Nach den örtlichen Stellplatzverordnungen muss zudem eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung stehen. Klären Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob an dem gewählten Standort der Betrieb Ihres Gewerbes erlaubt ist und welche baulichen Auflagen erfüllt werden müssen. Nähere Auskünfte hierzu erteilt das örtlich zuständige Bauordnungsamt.
Reisegewerbe
Ein Reisegewerbe betreibt, wer – ohne vorherige Bestellung – außerhalb einer gewerblichen Niederlassung Waren oder Leistungen anbietet oder Bestellungen aufnimmt. Dazu zählen beispielsweise der Straßenverkauf aus einem Wagen oder Stand und die Tätigkeit von Schaustellern. Als Reisegewerbetreibender benötigen Sie eine Erlaubnis, die sogenannte Reisegewerbekarte, die beim Ordnungsamt an Ihrem Wohnsitz zu beantragen ist. Eine solche Karte wird erteilt, wenn keine Tatsachen bekannt sind, wonach der Antragsteller für die Tätigkeit als unzuverlässig gelten muss. Sie kann auch eingeschränkt, befristet oder mit Auflagen verbunden sein.
Reisegewerbetreibende sind verpflichtet, ihre Reisegewerbekarte während der Ausübung des Gewerbes mitzuführen und auf Verlangen eines Mitarbeiter des zuständigen Ordnungsamts vorzuzeigen.
Beachten Sie, dass Sie für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes – zum Beispiel beim Aufstellen eines Verkaufsstands in der Fußgängerzone – zusätzlich eine Sondernutzungserlaubnis der zuständigen Gemeinde benötigen. Die Veranstaltung eines sogenannten Wanderlagers, das heißt der Vertrieb von Waren aus einer nur vorübergehenden Verkaufsstelle, fällt ebenfalls unter den Begriff des Reisegewerbes und muss zwei Wochen vor Beginn der örtlichen Gemeindeverwaltung angezeigt werden.
Marktgewerbe
Zum Marktverkehr zählen nach der Gewerbeordnung Messen, Ausstellungen und Märkte. Bei den Märkten unterscheidet das Gesetz nach Großmärkten, auf denen bestimmte Waren an gewerbliche Wiederverkäufer oder Großabnehmer vertreiben werden, Wochenmärkten, die hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse anbieten, sowie Spezial- und Jahrmärkten.
Für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen benötigen Sie weder eine Gewerbeanmeldung noch eine Reisegewerbekarte, die Veranstaltung muss aber vom zuständigen Ordnungsamt auf Antrag des Veranstalters festgesetzt werden. Die Behörde kann einem Aussteller oder Anbieter die Teilnahme untersagen, wenn die Annahme besteht, dass er hierfür die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.
Besondere Regelungen
Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union dürfen sich nur selbständig machen, wenn keine ausländerrechtlichen Beschränkungen bestehen. Eine derartige Beschränkung liegt vor, wenn der Aufenthaltstitel mit dem Vermerk "Selbständige oder vergleichbare unselbständige Erwerbstätigkeit nicht gestattet." versehen ist. In diesen Fällen können die Inhaber aber eine Änderung beantragen, der aber nur dann stattgegeben wird, wenn der Antragsteller ausreichende Vorkenntnisse für das beabsichtigte Gewerbe besitzt und an der Tätigkeit ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales Bedürfnis besteht.