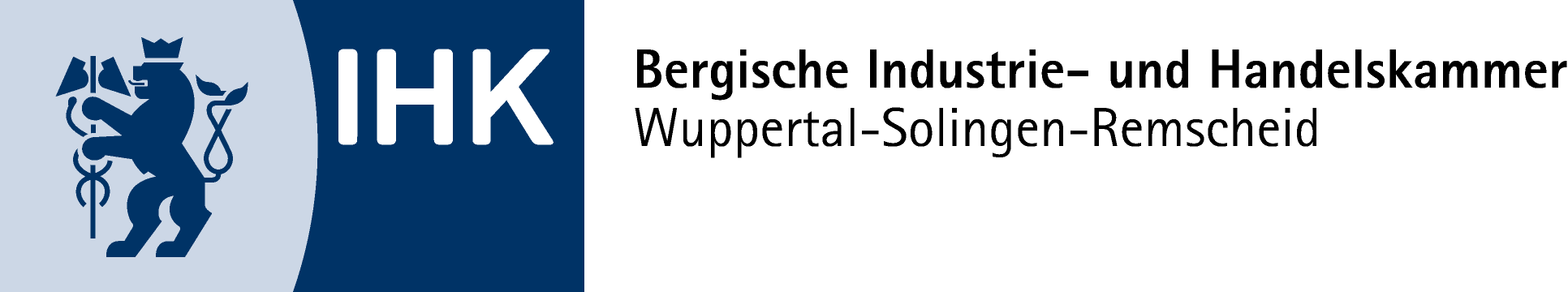Das Finanzkonzept
Das Finanzkonzept
Die Struktur und Qualität der Finanzierung einer Existenzgründung ist ein wesentlicher Faktor für den späteren Unternehmenserfolg. Leider mangelt es jungen Existenzgründern häufig an Eigenkapital, an Sicherheiten und an einem ausgereiften Unternehmenskonzept. Dies erschwert den Zugang zu Fremdkapital und kann auch im Falle einer Kreditgewährung im späteren Verlauf der Unternehmensentwicklung zu Liquiditätsengpässen und sogar zu einer Insolvenz führen.
Ein fundiertes Finanzkonzept muss deshalb Bestandteil jedes ausgegorenen Businessplans sein.
I. Kapitalbedarfsplan
Die Finanzwirtschaft ist das Herzstück des Unternehmens. Sie muss gut funktionieren, um Liquiditätsprobleme zu vermeiden. Aus diesem Grund ist es bei der Existenzgründung unerlässlich, eine systematische und weitsichtige Finanzplanung vorzunehmen. Der erste Schritt hierfür ist die Ermittlung des voraussichtlichen Kapitalbedarfs für Ihr Vorhaben. Dabei ist zu unterscheiden, ob Sie das Kapital langfristig oder/und kurzfristig benötigen.
Langfristiger Kapitalbedarf: Hierbei handelt es sich in der Regel um Aufwendungen für das betriebliche Anlagevermögen, wie Grundstücke oder Gebäude einschließlich Erwerbsnebenkosten, Umbauten, Produktionsanlagen, Maschinen und Geräte, Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie den Fuhrpark.
Langfristiger Kapitalbedarf: Hierbei handelt es sich in der Regel um Aufwendungen für das betriebliche Anlagevermögen, wie Grundstücke oder Gebäude einschließlich Erwerbsnebenkosten, Umbauten, Produktionsanlagen, Maschinen und Geräte, Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie den Fuhrpark.
Kurzfristiger Kapitalbedarf: Hierunter fallen die betrieblichen Anlaufkosten, wie der erste Warenbestand und die allgemeinen Gründungskosten, wie z.B. Beratungen, Anmeldungen, Notar, Werbekosten. Nicht zu vergessen sind die laufenden Kosten, zu denen auch Ihre privaten Lebenshaltungskosten zählen.
II. Rentabilitätsvorschau
Bevor Sie sich nun Gedanken über die Art der Finanzierung machen, sollten Sie vorher prüfen, ob für Sie langfristig ausreichende Gewinnchancen bestehen, um Ihre Kosten zu decken und Ihr Unternehmen rentabel zu machen.
1. Gewinnermittlung
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte der Gewinn eines Einzelunternehmers mindestens so hoch sein, dass in ihm ein angemessener kalkulatorischer Unternehmerlohn enthalten ist (davon bestreiten Sie die private Haushalts- und Lebensführung). Des weiteren müssen die erhöhten sozialen Aufwendungen (Krankheit, Altersversorgung, etc.) und die aufzubringende Einkommenssteuer abgedeckt werden. Zuletzt dürfen natürlich die Tilgungsraten für aufgenommene Kredite nicht vergessen werden.
2. Ermittlung der gewerblichen Kosten
Bei der Rentabilitätsvorschau werden die Kosten in drei Bereiche aufgeteilt: Den größten Teil nehmen dabei die Hauptkosten ein, zu denen z.B. die Miete, die Personalkosten, die sozialen Abgaben, Fremdkapitalzinsen und besonders am Anfang Kosten der Unternehmensführung sowie Werbungskosten zählen. Von kleinerem Umfang sind die "weiteren Kostenarten". Zu ihnen gehören überwiegend die Ausgaben für Versicherungen, Gebühren, Kfz, etc.. Im dritten Bereich werden die kalkulatorischen Kosten (Kosten, die sich nicht aus Zahlungsvorgängen ergeben, sondern veranschlagt werden) aufgeführt, wie ggf. Ihr Unternehmerlohn, kalkulatorische Miete für eigengenutzte Räume, Abschreibungen.
Auf der Grundlage dieser Daten können Sie nun einen Plan über die voraussichtliche Rentabilität bzw. Ihren voraussichtlichen Gewinn erstellen. Diesen Plan sollten Sie für die ersten drei bis fünf Jahre Ihrer unternehmerischen Tätigkeit anlegen. In dieser Zeit entscheidet sich in der Regel, ob sich ein neues Unternehmen etablieren kann oder nicht.
III. Liquiditätsplanung
Um zu erkennen, ob Sie in der Anlaufphase Ihrer Existenzgründung über genügend liquide ("flüssige") Mittel verfügen, die Ihre anfallenden Verbindlichkeiten decken, ist es sinnvoll, einen Liquiditätsplan zu erstellen. In diesem Plan stellen Sie Ihre Ausgaben den Einnahmen gegenüber. Dabei ist zu beachten, in welchem Monat Ihre geplanten Einnahmen zu Einzahlungen werden, also tatsächlich auf Ihrem Konto eingehen.
Dieselbe Überlegung gilt für die Auszahlungen. Da Ein- und Auszahlungen in der Regel nicht gleichzeitig erfolgen (saisonale Schwankungen, Einräumung von Zahlungszielen) kommt es entweder zu einem monatlichen Überschuss (Überdeckung) oder zu einem monatlichen Fehlbetrag (Unterdeckung). Eine zu lange Unterdeckung führt zur Illiquidität eines Unternehmens, in anderen Worten: Es wird zahlungsunfähig. Diesem Fall ist unbedingt vorzubeugen! Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:
- Kunden ein kürzeres Zahlungsziel einräumen
- Skonto bei schneller Bezahlung
- An- oder Teilzahlung vereinbaren
- Ausgaben/Zahlungen verschieben
- Professionelles Mahnungswesen einführen, ggf. Inkassobüro beauftragen
- Abtretung von Forderungen an Ihr Kredit- bzw. Finanzierungsinstitut (Factoring)
- Kurzfristigen Kredit bei Ihrer Bank aufnehmen (evtl. Rückgriff auf öffentliche Finanzierungshilfen)
- Skonto bei schneller Bezahlung
- An- oder Teilzahlung vereinbaren
- Ausgaben/Zahlungen verschieben
- Professionelles Mahnungswesen einführen, ggf. Inkassobüro beauftragen
- Abtretung von Forderungen an Ihr Kredit- bzw. Finanzierungsinstitut (Factoring)
- Kurzfristigen Kredit bei Ihrer Bank aufnehmen (evtl. Rückgriff auf öffentliche Finanzierungshilfen)
Ein Muster für die Aufstellung eines Liquiditätsplanes und viele weitere Infos finden Sie auf der Webseite für Existenzgründer des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
IV. Finanzierung
Nachdem Sie nun den Kapitalbedarf für Ihr Gründungsvorhaben kennen, müssen Sie prüfen, mit welchen Finanzierungsalternativen Sie diesen Bedarf decken können. Zur Finanzierung Ihres Kapitalbedarfs können Sie zum einen eigene Mittel einsetzen (Eigenkapital), zum anderen können Sie auch Fremdkapital aufnehmen. Dabei sollte bedacht werden: Je höher der Fremdkapitalanteil an Ihrer Gesamtfinanzierung ist, um so stärker ist Ihr Unternehmen konjunktur- und krisenanfällig.
1. Eigenfinanzierung
Die Eigenmittel, die Sie für Ihr Vorhaben einsetzen möchten, können in verschiedener Form vorhanden sein: z.B. als Geldvermögen (Bargeld, Bankguthaben) oder als Sachanlagen (bereits vorhandene Einrichtungen, Maschinen, Fuhrpark). Immaterielle Güter, wie Patente oder andere Rechte, können auch als Eigenkapital gewertet werden.
Ein möglichst hoher Eigenkapitalanteil ist aus verschiedenen Gründen wichtig: Für Ihre Bank ist die Eigenkapitalquote ein relevanter Indikator für Ihre Bonität, also die Kreditwürdigkeit Ihres Unternehmens. Für Sie selbst manifestiert sich in Eigenkapital die Fähigkeit, unvorhergesehene Ausgaben bestreiten zu können. Eventuelle Forderungsausfälle, schleppende Zahlungseingänge, überraschend erforderliche Ersatzinvestitionen und kürzere Umsatzeinbrüche können überwunden werden, sofern genügend Eigenkapital für Betriebsmittel vorhanden ist. Die sog. "goldene Bilanzregel" besagt, dass das im Betrieb vorhandene Eigenkapital das Anlagevermögen und das dauerhaft gebundene Umlagevermögen decken sollte. Dies gelingt in der Praxis nicht immer. Je nach Art der unternehmerischen Tätigkeit sollte ein Existenzgründer einen Eigenkapitalanteil von 15 bis 25 Prozent am Finanzierungsvolumen aufbringen.
Wenn Sie nur begrenzt über Eigenmittel verfügen, können Sie überlegen, ob Ihre Eigenkapitalbasis durch die Aufnahme von Gesellschaftern, die haftendes Kapital zur Verfügung stellen, vergrößert werden kann. Ggf. bietet sich die Gründung einer Personen- oder Kapitalgesellschaft an. Auch eine stille Teilhaberschaft von Verwandten oder sog. Business Angels kommt in Betracht. Im Ausnahmefall kann es auch möglich sein auf eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft zurückzugreifen.
2. Fremdfinanzierung
Nur wenige Existenzgründungen werden ganz aus eigenen Mitteln finanziert. Fremdkapital muss in der Regel mit herangezogen werden. Es kann aus verschiedenen Quellen kommen:
- von Freunden und Verwandten,
- von Kunden in Form von Anzahlungen (Diese werden in der Regel allerdings nur dort getätigt, wo individuelle Leistungen mit erheblichem Kapitalbedarf erbracht werden.),
- von Lieferanten in Form eines kurzfristigen Kredites (i.d.R. 30 Tage),
- kurz-, mittel- und langfristige Kredite der Banken (Zu den gebräuchlichsten kurzfristigen Krediten gehört der verhältnismäßig teure Kontokorrentkredit. Prüfen Sie die unterschiedlichen Konditionen der Banken für Kredite sorgfältig, bevor Sie sich entscheiden!),
- Öffentliche Finanzierungshilfen
3. Besondere Hinweise zur Finanzierung:
Beachten Sie bei der Finanzierung durch Fremdkapital die "goldene Finanzierungsregel": Die Tilgungsdauer (Fristigkeit) des von einem Unternehmen aufgenommenen Kapitals sollte sich mit der Lebensdauer der Kapitalanlage decken. D.h., dass Sie für langfristige Kapitalbindung langfristiges Geld, für kurzfristige Kapitalbindung kurzfristiges Geld benötigen! Bei Nichtbeachtung dieser Regel können Sie schnell in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, die sich existenzbedrohend auf Ihr Unternehmen auswirken.
Wenn Sie sich für eine Fremdfinanzierung entschieden haben, bereiten Sie sich gut auf Ihren Besuch bei dem gewünschten Geldinstitut vor, um Ihre Kreditwürdigkeit hinreichend zu untermauern. Ein möglichst ausgefeilter Business-Plan (inklusive Rentabilitätsvorschau und Finanzierungsplan) sollte vorliegen. Ein vorhergehendes Beratungsgespräch bei Ihrer Industrie- und Handelskammer ist sinnvoll. Bedenken Sie, dass das Kreditinstitut für die Vergabe von Krediten Sicherheiten braucht. Deshalb sollten Sie zu Ihrem Gespräch ggf. eine präzise Aufstellung über Ihr privates und betriebliches Vermögen mitbringen. Dazu können Sie Grundbuchauszüge, Lagepläne, Einheitswertbescheinigungen, Feuerversicherungen und Wertschätzungsunterlagen einreichen. Geben Sie Ihrem/Ihrer Gesprächspartner/in das sichere Gefühl, ein durchdachtes und aussichtsreiches Vorhaben mitzutragen.
Sollten Ihre vorgelegten Vermögensnachweise den Kreditinstituten als Sicherheiten nicht ausreichen, können evtl. öffentliche Bürgschaften weiterhelfen, die von Bund und Ländern mitgetragen werden. In Nordrhein-Westfalen nimmt sich die Bürgschaftsbank NRW der Besicherung von Krediten an. Bei einigen öffentlichen Finanzierungshilfen sind begrenzte Haftungsfreistellungen für die durchleitende Bank vorgesehen.