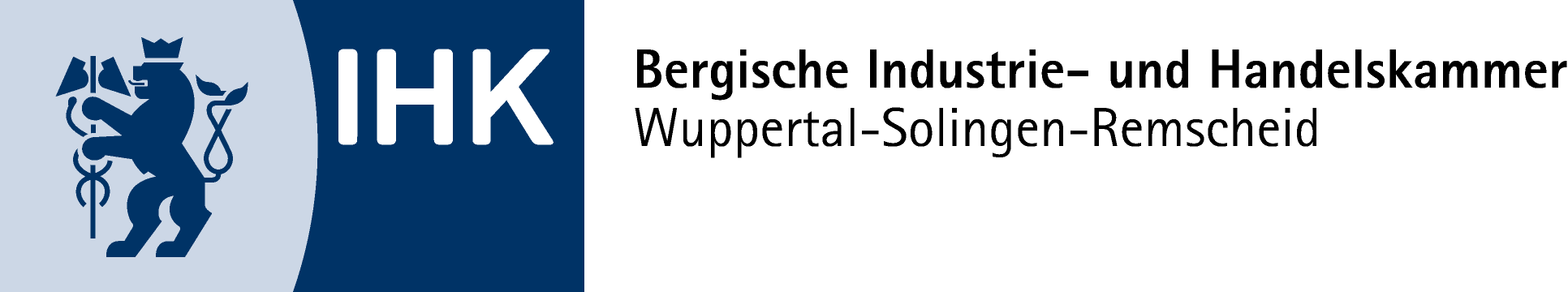Werbung und das Auftreten im Geschäftsleben
Werbung und das Auftreten im Geschäftsleben
Die Frage, unter welcher Bezeichnung der Unternehmer im geschäftlichen Verkehr auftreten darf, hängt zunächst von seiner Rechtsform ab. Außerdem ist zwischen dem formellen Auftreten in Form von Briefbögen, Rechnungen und Vertragsabschlüssen einerseits und Werbemaßnahmen andererseits zu differenzieren.
Die Frage, unter welcher Bezeichnung der Unternehmer im geschäftlichen Verkehr auftreten darf, hängt zunächst von seiner Rechtsform ab. Außerdem ist zwischen dem formellen Auftreten in Form von Briefbögen, Rechnungen und Vertragsabschlüssen einerseits und Werbemaßnahmen andererseits zu differenzieren.
a. Kleingewerbe
Der Kleingewerbetreibende, also der Unternehmer, der nur in geringem Umfang oder in einfacher Art am geschäftlichen Verkehr teilnimmt, muss sich nicht in das Handelsregister eintragen lassen. Handelsrechtlich wird er nicht als Kaufmann betrachtet und darf deshalb auch keine Firma führen. Obwohl es gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben ist, sollte der Gewerbetreibende im formellen geschäftlichen Verkehr, insbesondere auf seinen Geschäftspapieren, stets seinen vollen Vor- und Zunamen angeben, weil nur so das Unternehmen identifizierbar ist. Daneben kann der Gewerbetreibende einen Branchen- oder Tätigkeitshinweis und/oder eine sogenannte „Geschäftsbezeichnung” (s. unten) verwenden. Damit nicht der falsche Eindruck entsteht, das Unternehmen sei mit einem kompletten Begriff im Handelsregister eingetragen, sollten der Name und sonstige Hinweise deutlich voneinander getrennt werden, zum Beispiel durch unterschiedliche Schriftarten oder -größen. Zu den Kleingewerbetreibenden zählen kleinere Betriebe, die mit wenig Aufwand und Kapital geführt werden, beispielsweise Kioske, kleine Gaststätten und Handwerks-Unternehmen sowie Handels- und Versicherungsvertreter. In der Regel fallen auch Existenzgründer, die ohne großen Aufwand ihr neues Unternehmen starten, zunächst in die Gruppe der Kleingewerbetreibenden.
Geschäftsbezeichnung und Logo
Unabhängig davon hat der nicht im Handelsregister eingetragene Unternehmer aber die Möglichkeit, eine sogenannte Geschäftsbezeichnung zu verwenden. Sie unterscheidet sich von einer Firma dadurch, dass sie nicht den Inhaber, sondern das Geschäft bezeichnet ("Zum goldenen Hahn", "Rathaus-Apotheke", "Tonis Polsterei", "Kapitol-Theater"). Auch auf Briefbögen können die geschäftlichen Bezeichnungen, aber auch Logos oder sonstige Zeichen, durchaus angegeben werden, wenn sie keinen firmenähnlichen Charakter besitzen und vom Namen des Inhabers deutlich abgesetzt werden.
b. Gesellschaften bürgerlichen Rechts
Für Gesellschaften bürgerlichen Rechts gelten dieselben Grundsätze. Auch sie sind nicht im Handelsregister eingetragen und führen daher keine Firma. Auf den Geschäftspapieren sind die Namen aller Gesellschafter mit jeweils einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Insbesondere wäre etwa die Bezeichnung „Meier & Müller GbR” unzulässig, da sie den Eindruck einer Firma hervorruft.
Ein kleingewerbliches Unternehmen, sei es als Einzelunternehmer oder als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, hat aber die Möglichkeit, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen. Macht es von diesem Recht Gebrauch, dann wird es dadurch zum Kaufmann mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen (s. nachstehend). Über die mit der Eintragung in das Handelsregister verbundenen Konsequenzen sollten Sie sich als Kleingewerbetreibender bewusst sein, ehe Sie die Anmeldung zum Handelsregister veranlassen.
c. Freiberufler
Freiberufler üben kein Gewerbe aus und können deshalb nicht mit einer Firma in das Handelsregister eingetragen werden. Im geschäftlichen Verkehr verwenden sie ihren Namen, dem häufig die Berufsbezeichnung beigefügt wird. Auch Freiberufler können in der Werbung Geschäftsbezeichnungen gebrauchen, sofern nicht standesrechtliche Einschränkungen bestehen.
d. Eingetragene Firmen
Gewerbetreibende, die in erheblichem Umfang am geschäftlichen Verkehr teilnehmen, werden - unabhängig von ihrer Branche - vom Handelsgesetzbuch (HGB) als Kaufmann bezeichnet. Wann die Grenze zwischen einem kleingewerblichen und einem kaufmännischen Unternehmen erreicht ist, ist nicht eindeutig definiert. Nach dem HGB ist Kaufmann, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, der nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Dieser Geschäftsbetrieb bedarf bestimmter Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, um jederzeit den Überblick über das Unternehmen zu behalten, und zwar zum eigenen Nutzen, aber auch zum Schutz der Geschäftspartner.
Kaufleute sind nicht nur berechtigt, eine Firma zu führen, sondern sogar verpflichtet, diese zum Handelsregister anzumelden. Unter einer Firma wird der Name des Kaufmanns verstanden, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Er kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden; außerdem kann die Firma zusammen mit dem Handelsgeschäft veräußert und vom Nachfolger fortgeführt werden.
Weitere Folgen der Kaufmannseigenschaft sind die Verpflichtung zur doppelten Buchführung, jährlichen Inventur und Aufbewahrung von Handelsbriefen und Handelsbüchern. In Bezug auf die Pflicht zur doppelten Buchführung, zur Führung von Handelsbüchern und zur Aufstellung des Inventars gibt es jedoch eine Ausnahme: Diese Pflichten gelten nicht für Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als 600.000 Euro Umsatzerlöse und 60.000 Euro Jahresüberschuss aufweisen (Werte ab 01.01.2016, davor 500.000 Umsatzerlöse und 50.000 Euro Jahresüberschuss). Im Fall der Neugründung gilt dies, wenn diese Werte am ersten Abschlussstichtag nach der Neugründung nicht überschritten werden.
Da an Kaufleute höhere Ansprüche an die Abwicklung des Geschäftsverkehrs gestellt werden, entfallen für sie bestimmte Schutzbestimmungen; sie können beispielsweise Schuldanerkenntnisse und Bürgschaften formlos abschließen, die andernfalls nur schriftlich wirksam werden. Andererseits stehen diesen "Nachteilen" auch positive Rechte gegenüber. So können nur Kaufleute Prokura erteilen, Zweigniederlassungen gründen sowie mit anderen zusammen eine offene Handels- oder Kommanditgesellschaft bilden. Außerdem sind eingetragene Firmen wegen der Öffentlichkeit des Handelsregisters im geschäftlichen Verkehr regelmäßig gut angesehen. Im Einzelfall wird das Eingehen von Geschäftsbeziehungen sogar davon abhängig gemacht.
Neben dem Einzelkaufmann sind auch die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung - auch als "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" - Rechtsformen, auf die die Vorschriften des HGB über Kaufleute Anwendung finden. Wenn sich mehrere Unternehmer zusammenschließen möchten, können sie eine offene Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft gründen; diese Formen sind - sozusagen - die "großen" Geschwister der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Während bei der OHG alle Gesellschafter persönlich haften, differenziert die KG zwischen persönlich haftenden Gesellschaftern und Kommanditisten, die sich nur mit einer bestimmten Einlage - die Höhe ist frei vereinbar - an dem Unternehmen beteiligen. Die GmbH schließlich hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie kann von mehreren Personen, aber ebenso gut nur von einem Gesellschafter gegründet werden und ist mit einem Stammkapital von mindestens 25.000 Euro oder von mindestens einem Euro pro Gesellschafter bei der "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)"/"UG (haftungsbeschränkt)" auszustatten. Gesellschafter haften nicht, Geschäftsführer nur bei gravierenden persönlichen Pflichtverletzungen.
Die Möglichkeiten der Firmenbildung sind äußerst vielfältig und für alle kaufmännischen Rechtsformen im Prinzip gleich. Die Firma muss zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen. Darüber hinaus muss die Firma einen Rechtsformzusatz enthalten. Bei Einzelfirmen lautet dieser Hinweis "eingetragener Kaufmann", "eingetragene Kauffrau" oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, zum Beispiel "e. K.", "e. Kfm." oder "e. Kfr.". Offene Handelsgesellschaften können - wie bisher - die Abkürzung "OHG", Kommanditgesellschaften "KG", Gesellschaften mit beschränkter Haftung "GmbH", Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt) "UG (haftungsbeschränkt)" und Aktiengesellschaften "AG" verwenden.
Der Firmenkern kann aus Namens- und Sachbegriffen, aber auch aus reinen Phantasiebezeichnungen bestehen. Die Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft verlangt aber eine gewisse Individualität, so dass beispielsweise eine reine Branchenbezeichnung ("Maschinenfabrik e. K.") nicht ausreicht. Möglich sind aber z. B. "Pelikan Maschinenfabrik KG" oder "Schröder Pelikanwerk OHG", aber auch lediglich "Pelikan-Werk GmbH". Reine Geschäftsbezeichnungen ("Zum goldenen Hahn e. K.") sind ebenso erlaubt wie bloße Buchstabenkombinationen ("ABC GmbH" oder "XY GmbH". Ein Buchstabe wird nicht als ausreichend angesehen). Die Firma darf allerdings keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen. Dabei wird im Verfahren vor dem Registergericht die Eignung zur Irreführung aber nur berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist.
Ein kleiner Herstellungsbetrieb darf sich beispielsweise nicht Fabrik oder Werk nennen oder sich mit einem anspruchsvollen geographischen Zusatz wie "Deutsche...." schmücken. Auch dürfen zur Firmenbildung nicht Namen anderer Personen als des Inhabers oder des/der Gesellschafter verwendet werden, soweit die Täuschungsgefahr nicht durch den Zusammenhang ausgeschlossen ist. Die Bezeichnung "Café Mozart e. K." ist demnach erlaubt.
Neben dem Einzelkaufmann sind auch die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung - auch als "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" - Rechtsformen, auf die die Vorschriften des HGB über Kaufleute Anwendung finden. Wenn sich mehrere Unternehmer zusammenschließen möchten, können sie eine offene Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft gründen; diese Formen sind - sozusagen - die "großen" Geschwister der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Während bei der OHG alle Gesellschafter persönlich haften, differenziert die KG zwischen persönlich haftenden Gesellschaftern und Kommanditisten, die sich nur mit einer bestimmten Einlage - die Höhe ist frei vereinbar - an dem Unternehmen beteiligen. Die GmbH schließlich hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie kann von mehreren Personen, aber ebenso gut nur von einem Gesellschafter gegründet werden und ist mit einem Stammkapital von mindestens 25.000 Euro oder von mindestens einem Euro pro Gesellschafter bei der "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)"/"UG (haftungsbeschränkt)" auszustatten. Gesellschafter haften nicht, Geschäftsführer nur bei gravierenden persönlichen Pflichtverletzungen.
Die Möglichkeiten der Firmenbildung sind äußerst vielfältig und für alle kaufmännischen Rechtsformen im Prinzip gleich. Die Firma muss zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen. Darüber hinaus muss die Firma einen Rechtsformzusatz enthalten. Bei Einzelfirmen lautet dieser Hinweis "eingetragener Kaufmann", "eingetragene Kauffrau" oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, zum Beispiel "e. K.", "e. Kfm." oder "e. Kfr.". Offene Handelsgesellschaften können - wie bisher - die Abkürzung "OHG", Kommanditgesellschaften "KG", Gesellschaften mit beschränkter Haftung "GmbH", Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt) "UG (haftungsbeschränkt)" und Aktiengesellschaften "AG" verwenden.
Der Firmenkern kann aus Namens- und Sachbegriffen, aber auch aus reinen Phantasiebezeichnungen bestehen. Die Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft verlangt aber eine gewisse Individualität, so dass beispielsweise eine reine Branchenbezeichnung ("Maschinenfabrik e. K.") nicht ausreicht. Möglich sind aber z. B. "Pelikan Maschinenfabrik KG" oder "Schröder Pelikanwerk OHG", aber auch lediglich "Pelikan-Werk GmbH". Reine Geschäftsbezeichnungen ("Zum goldenen Hahn e. K.") sind ebenso erlaubt wie bloße Buchstabenkombinationen ("ABC GmbH" oder "XY GmbH". Ein Buchstabe wird nicht als ausreichend angesehen). Die Firma darf allerdings keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen. Dabei wird im Verfahren vor dem Registergericht die Eignung zur Irreführung aber nur berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist.
Ein kleiner Herstellungsbetrieb darf sich beispielsweise nicht Fabrik oder Werk nennen oder sich mit einem anspruchsvollen geographischen Zusatz wie "Deutsche...." schmücken. Auch dürfen zur Firmenbildung nicht Namen anderer Personen als des Inhabers oder des/der Gesellschafter verwendet werden, soweit die Täuschungsgefahr nicht durch den Zusammenhang ausgeschlossen ist. Die Bezeichnung "Café Mozart e. K." ist demnach erlaubt.