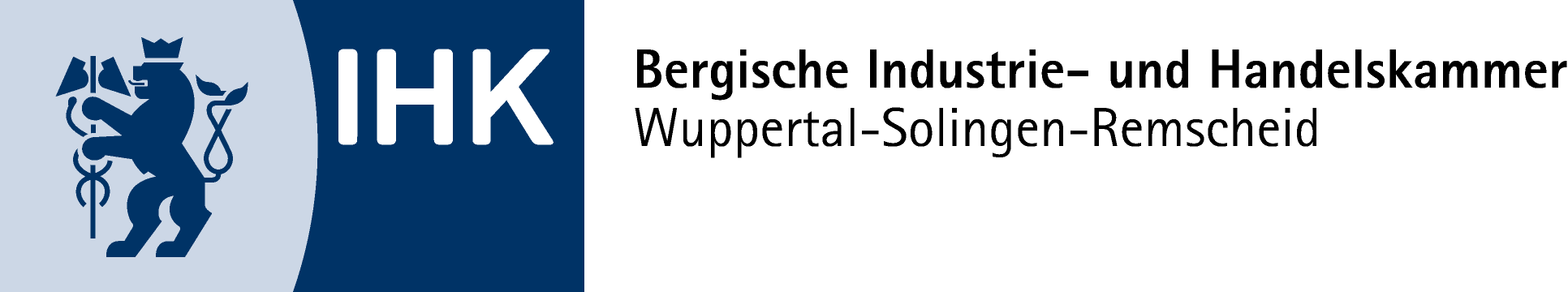Zwischen KI und Kommunalwahl
Mehr als 800 Gäste konnte die Bergische IHK bei ihrem Sommerempfang in der Historischen Stadthalle begrüßen. Henner Pasch stellte Forderungen an die künftigen Oberbürgermeister und Stadträte. Prof. Tobias Meisen und Simon Pierro zeigten Nutzen von Künstlicher Intelligenz – und den Spaß daran.
Wenn im Herbst die Oberbürgermeister neu gewählt werden, ist das „eine große Chance für einen echten Neustart in der Region“. Das sagte IHK-Präsident Henner Pasch beim Sommerempfang der Bergischen IHK in der Historischen Stadthalle Wuppertal. Mehr als 800 Gäste aus Wirtschaft und Politik haben den Empfang besucht. Sie folgten einem spannenden Programm, das von Zukunftsthemen geprägt war – von der Kommunalwahl bis zu Künstlicher Intelligenz (KI).
Gleich zu Beginn macht IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge deutlich, welche einschneidende Neuwahl im Herbst dieses Jahres bevorsteht. Nach der Begrüßung der Gäste verabschiedete er vorab alle drei aktuellen Oberbürgermeister: Uwe Schneidewind, Tim Kurzbach und Burkhardt Mast-Weisz. Alle drei treten nicht wieder an und geben ihre Ämter ab.
Präsident Henner Pasch nutzte die Gelegenheit zu persönlichen Worten und unterstrich, wie wichtig und wertvoll die Zusammenarbeit gewesen sei – die teils in freundschaftlichen Verhältnissen mündete, auch trotz teils starker Kritik.
Mit Kritik und Appellen ging es dann auch weiter in seiner Rede. Mehr als 30 Minuten Redezeit widmete Pasch der anstehenden Wahl und den daraus folgenden Chancen und Aufgaben. Dass alle drei Oberbürgermeister gleichzeitig wechselten, sei - bei allem Respekt für die bisherige Arbeit – „ein Moment der Richtungsbestimmung.“ Es gehe darum, dass die Region als „Wirtschaftsstandort stark, attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt – oder „wieder wird“, je nach Sichtweise.“
Pasch diagnostizierte der Region starke Defizite – eine zu hohe Arbeitslosenquote, eine zu geringe Wirtschaftskraft je Einwohner, zu wenige Gäste-Übernachtung, zu wenige Kita-Plätze, zu wenige Glasfaseranschlüsse, zu viele neue Stellen in den Verwaltungen, zu viel Arbeitsplatzverluste in der Wirtschaft. Die Zahlen dazu seien „kein Schicksal. Sie sind ein Weckruf.“ Es fehle den Verwaltungen an Selbstkritik und neuen Ideen, so Pasch. Er forderte von den Verwaltungen vor allem Effizienz, klare Strukturen, Digitalisierung und Benchmarks. „Verwaltungen stehen nicht im Wettbewerb? Mag sein. Aber sie stehen unter Beobachtung. Bürger und Unternehmen haben berechtigterweise hohe Erwartungen.“
Pasch kritisierte etwa lange Wartezeiten bei Aufenthaltserlaubnissen von ausländischen Fachkräften oder bei Baugenehmigungen. Er bemängelte die fehlende Verfolgung von Schwarzarbeit.
Was Politik und Verwaltung dem entgegensetzen sollten: „Transparenz, Tempo, Zusammenarbeit und Mut.“ Die kommenden Oberbürgermeisten sollten die Key Performance Indicators (KPIs) der Städte ermitteln und transparent und vergleichbar machen. Digitalisierung solle helfen, Prozesse transparent und schneller zu gestalten. Die bergische Zusammenarbeit müsse gestärkt werden. „Dreimal Wirtschaftsförderung, dreimal Gewerbeflächenentwicklung, dreimal Digitalisierungsstrategie, – und leider auch dreimal zu wenig Abstimmung. Die Folge? Reibungsverluste. Ineffizienz. Verpasste Chancen.“ Dazu brauche es mutige Standentwicklung.
Pasch benannte positive Beispiele der kommunalen Arbeit: der Plan für eine Halle für den Bergischen Handball Club in der Varresbeck, die Bundesgartenschau 2031 und das Outlet Center in Remscheid. Alle drei Projekte erforderten aber bergische Zusammenarbeit, damit alle Städte profitierten. Bei den Städten „sollte die Frage lauten, wie können wir das gemeinsam besser, effizienter und schneller machen, als wir es alleine könnten.“
Henner Pasch leitete dann über zu einem Herzensthema, im wahrsten Sinne des Wortes: Laien-Reanimation. Pasch war nach dem Verlust eines Freundes auf das Thema Reanimation gestoßen und in Kontakt mit Prof. Susanne Schwalen, Leiterin der Ärztekammer Nordrhein, gekommen. Beim Neujahrsempfang zeigte er einen Film, um das Thema in die Firmen zu tragen. Schwalen sagte, es gebe 120.000 plötzlicher Herzstillstände pro Jahr, 70.000 würden reanimiert, zehn Prozent überlebten. Man müsse die Reanimationszahlen erhöhen, um die Sterblichkeit zu senken, appellierte Schwalen. Dafür müsse Bewusstsein in den Firmen geschaffen werden.
Dann ging es um die Zukunft. Die Chancen der KI für die industrielle Nutzung machte Tobias Meisen, Professor für Technologien und Management der Digitalen Transformation an der Bergischen Universität, deutlich in seinem Vortrag „Industrielle KI: Chancen erkennen. Wandel gestalten. Wert schöpfen." Meisen wollte bewusst positiv und praxisnah von KI sprechen: „KI ist ein Werkzeug, es kommt drauf an, wie wir sie nutzen“, sagte er. Er zeigte Beispiele aus der Praxis, die Unternehmen die Arbeit erleichtern können – beim Nachhaltigkeitsberichtswesen, bei visueller Qualitätskontrolle oder Produktionsplanung. „Wir sind weit weg davon, sagen zu können ‚KI betrifft uns nicht‘“, sagte Meisen. Sie sei schon allgegenwärtig. Wir stünden am Beginn einer neuen Ära von Bildung, Arbeit und dem Leben an sich.
KI-Magier Simon Pierro zeigte dann, wie faszinierend und, ja, magisch KI sein kann. Er ließ einen Tennisball im IPad verschwinden, zapfte Bier aus dem Gerät oder stach sich selbst über ein Handy das IHK-Logo als Tattoo. Am Beispiel eines Gastes auf der Bühne zeigte er, dass es reicht, ein Foto zu berühren, damit dieser Gast die Berührungen am eigenen Körper spürt. „Macht keinen Sinn, macht aber Spaß“, sagte er. Das kam auch beim Publikum an.
Für die Musik an dem Abend war das Blasorchester der Bundeswehr aus Hilden verantwortlich. Die Studierenden in Uniform unter der Leitung von Professor Christoph Willer spielten zum Schluss die deutsche Nationalhymne.
Nach zweieinhalb Stunden Programm konnten die Gäste den Abend im Garten der Stadthalle ausklingen lassen.
Text: Eike Rüdebusch
Fotos: Malte Reiter
Fotos: Malte Reiter