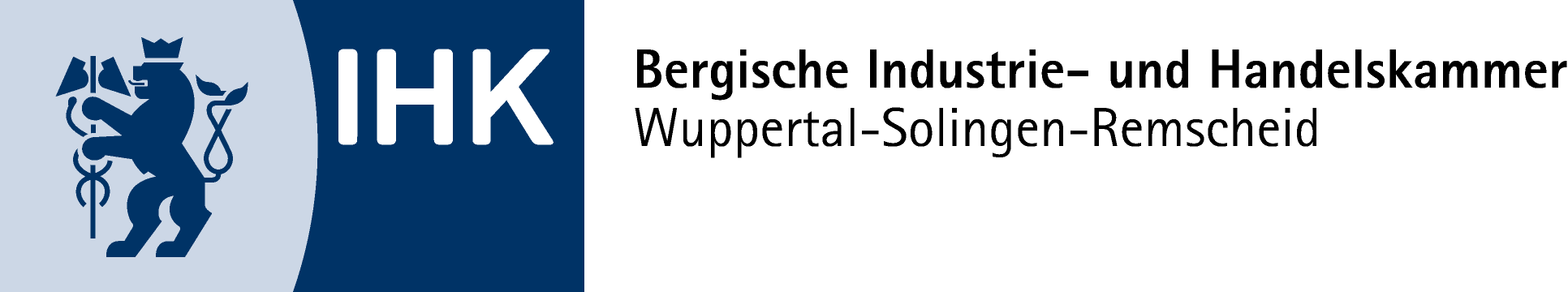Arbeitsstättenverordnung: Welchen Anforderungen müssen Arbeitsstätten gerecht werden?
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) trat bereits im Jahr 2004 in Kraft und wurde seitdem mehrfach überarbeitet und aktualisiert, das letzte Mal im Oktober 2017. Ziel der Verordnung ist es, die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmern beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten sowie Baustellen zu gewährleisten. Sie richtet sich dementsprechend an Arbeitgeber. Doch welche Vorschriften sieht die ArbStättV im Detail vor und wie können diese umgesetzt werden?
Was gilt gemäß ArbStättV als Arbeitsstätte?
Nicht nur der eigentliche Arbeitsplatz eines Beschäftigten gilt der Verordnung zufolge als Arbeitsstätte. Vielmehr umfasst dieser Begriff das gesamte Gelände einer Baustelle beziehungsweise alle Räume eines Betriebes, zu denen Arbeitnehmer Zutritt haben, während sie ihrer Beschäftigung nachgehen. Dies schließt mitunter folgende Räumlichkeiten ein:
- Arbeitsräume
- Bereitschafts-, Kantinen- und Pausenräume
- Unterkunftsräume
- Lager- und Maschinenräume
- Erste-Hilfe-Räume
- Notausgänge
- Flucht- und Verkehrswege
Doch damit noch nicht genug: Die Arbeitsstättenverordnung bezieht sich ebenfalls auf Einrichtungen, die vonnöten sind, um einen Betrieb am Laufen zu halten. Daher zählen auch Feuerlöscheinrichtungen, Tore, Türen, Sicherheitsbeleuchtungen sowie Energieverteilungsanlagen und mögliche Verkaufsstände im Freien zur Arbeitsstätte.
Von Ausstattung über Temperatur bis hin zum Nichtraucherschutz
Um Arbeitgebern ein gewisses Maß an Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung der Vorschriften aus der Arbeitsstättenverordnung zu lassen, definiert diese keine expliziten Anforderungen, sondern vielmehr allgemeine Schutzziele. In § 3a Absatz 1 ArbStättV heißt es beispielsweise:
„Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten werden. […]“
Arbeitgeber profitieren demzufolge von einem gewissen Spielraum. In insgesamt zehn Paragraphen und einem Anhang mit sechs Abschnitten finden sich unter anderem Regelungen zum Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten, zum Nichtraucherschutz sowie zur Beschaffenheit von Pausenräumen, sanitären Anlagen, Rettungs- und Fluchtwegen.
Der dritte Abschnitt des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung befasst sich mit den grundlegenden Arbeitsbedingungen, die in einer Arbeitsstätte vorherrschen müssen. Dazu gehören unter anderem
- die Ausstattung der Arbeitsplätze,
- die Beleuchtung,
- die Bewegungsfläche sowie
- die Raumtemperatur.
Übrigens: Bis zum Dezember 2016 wurde die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen noch in einem eigenen Regelwerk definiert. Mittlerweile wurde die Bildschirmarbeitsverordnung jedoch in die ArbStättV integriert.
Welche Rolle spielen die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)?
Wie bereits erwähnt, sind die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung sehr allgemein formuliert. Die sogenannten Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die Anforderungen der ArbStättV und sollen dabei helfen, diese ordnungsgemäß umzusetzen. Sie enthalten praktische Maßnahmen, die ergriffen werden können, um den Gesundheitsschutz sowie die Sicherheit von Arbeitnehmern beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten zu gewährleisten.
Da die ASR stets dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, erleichtern sie dem Arbeitgeber unter anderem die Durchführung der obligatorischen Gefährdungsbeurteilung (§ 3 ArbStättV). Die Arbeitsstättenverordnung schreibt die Anwendung der Technischen Regeln allerdings nicht vor: Arbeitgeber können selbst entscheiden, welche Vorgaben sie daraus umsetzen und von welchen sie abweichen. Natürlich müssen die Vorgaben der ArbStättV in letzterem Fall durch andere Maßnahmen eingehalten werden.