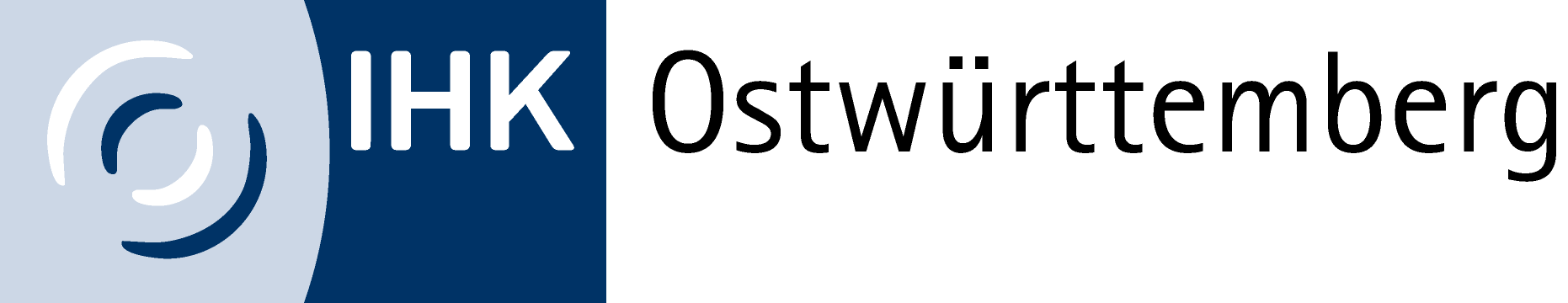Dokumentationspflichten
Vorbemerkungen
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) betont die Verantwortlichkeit, die Unternehmen (auch „verantwortliche Stellen“ oder „Verantwortliche“ genannt) für die Einhaltung des Datenschutzes haben. Sie müssen nachweisen können, dass ihre Datenverarbeitung datenschutzkonform ist. Umfangreiche Pflichten zur Dokumentation sollen dies sicherstellen. Die Aufzeichnungen dienen als Nachweis gegenüber der Datenschutzaufsicht, bei gerichtlichen Kontrollverfahren sowie für eine nachträgliche Information Betroffener. Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Verpflichtung setzt die Entwicklung, Implementierung und Anwendung eines Datenschutz-Managementsystems voraus. Dabei müssen Verantwortliche eruieren, welche Dokumentationspflichten sie zu beachten haben, Umfang und Grenzen dieser Pflichten kennen und Prozesse einführen, die deren Einhaltung sicherstellen.
Die DS-GVO kennt im Wesentlichen folgende Dokumentationspflichten:
Art. 5 Abs. 2, 24 Abs. 1 DS-GVO - Rechenschaftspflicht
Wer personenbezogene Daten verarbeitet, ist verantwortlich für die Einhaltung aller in der DS-GVO aufgeführten Rechtsgrundsätze. Hierbei handelt es sich um folgende: Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckmäßigkeit, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit. Ein Verantwortlicher muss deren Einhaltung nachweisen können (sog. „Rechenschaftspflicht“). Ferner haben verantwortliche Stellen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen und den Nachweis erbringen zu können, dass sie bei ihrer Datenverarbeitung vollumfänglich die DS-GVO beachten. Zudem haben sie ergriffene Maßnahmen zu überprüfen und zu aktualisieren.
In der Praxis setzt man diese Pflicht über die Beschreibung einer Verarbeitung im sog. „Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten“ um und ergänzt diese idealerweise um die Rechtsgrundlage, auf die die jeweilige Datenverarbeitung gestützt wird.
Art. 6 - Interessensabwägung, Zweckänderung
Wer eine Datenverarbeitung auf die Rechtsgrundlage „Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritten“ stützt, muss den hiervon betroffenen Personen die Gründe mitteilen, die er oder ein Dritter in Abwägung zu den Interessen der Betroffenen als überwiegend ansieht (z. B. Werbung an Kunden per Brief, Fälle des Datenflusses im Konzern, vgl. Erwägungsgründe 47 und 48). Außerdem muss er Betroffene vorab auf ihr jederzeitiges Widerrufsrecht hinweisen.
Ferner haben verantwortliche Stellen Betroffene vorab umfassend (z. B. über die Rechtsgrundlage für die geplante weitere Datenverarbeitung) zu informieren, wenn sie Informationen über diese zu einem anderen Zweck weiterverarbeiten möchten als zu dem ursprünglichen.
Art. 7 - erteilte Einwilligungen
Wird eine Datenverarbeitung auf eine datenschutzrechtliche Einwilligung gestützt, so muss das Unternehmen nachweisen können, dass diese vorliegt, also ein Betroffener diese
- wirksam erteilt hat
- durch eine unmissverständliche Willensbekundung in Form einer Erklärung (Textform z. B. durch E-Mail, Fax, Dokumentenscan ist ausreichend; nicht mehr erforderlich ist die Schriftform, also die Unterschrift im Original. Schriftform wird jedoch durch eine Festlegung im BDSG neu, das am 25.05.2018 in Kraft treten wird, weiterhin erforderlich sein für Einwilligungen im Beschäftigungsverhältnis!)
- oder durch eine sonstige eindeutige bestätigende Handlung des Einwilligenden wie z. B. einer Einwilligung per Mausklick
- diese rechtmäßig gestaltet ist
- durch eine verständliche und leicht zugängliche Form
- in einer klaren und einfachen Sprache
- klar von anderen Sachverhalten zu unterscheiden
- und ohne Zwang und damit freiwillig abgegeben worden ist, insbesondere – soweit dies angebracht ist – zu verschiedenen Verarbeitungsvorgängen gesondert erteilt werden kann
- sowie ferner das sog. Koppelungsverbot beachtet ist, d. h. die Erfüllung eines Vertrages wurde nicht von einer Erteilung einer Einwilligung abhängig gemacht, die für deren Erfüllung nicht erforderlich wäre.
- diese für die Zukunft widerruflich gestaltet ist (Hinweis gegenüber Betroffenen!)
- und nicht (zum Teil) unverbindlich ist, weil diese (oder Teile hiervon) gegen die DS-GVO verstoßen.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland haben beschlossen, dass bisher rechtswirksame Einwilligungen weiterhin wirksam sind (Beschluss des „Düsseldorfer Kreises“ vom 13./14.09.2016).[1] Jedoch müssen Verantwortliche deren Einholung nachweisen können. Dies setzt eine entsprechende Dokumentation voraus (Einwilligungs-Management).
Art. 8 - Einwilligung bei Kindern – Pflicht zur Altersverifikation
Hat ein Kind das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so kann es in Dienste der Informationsgesellschaft (z. B. Online-Informationsangebote, Online-Handel von Waren und Dienstleistungen, Online-Werbung) datenschutzrechtlich wirksam einwilligen. Allerdings muss die Einwilligung rechtskonform (s. o.) gestaltet sein. Kinder unter sechzehn benötigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten oder deren Zustimmung, um wirksam einwilligen zu können. Insoweit ist ein Verantwortlicher verpflichtet, umfassend (auch unter Einsatz technischer Mittel) zu prüfen, ob die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten vorliegt.
Es besteht nach der DS-GVO die Möglichkeit, dass andere EU-Mitgliedstaaten das Alter auf 13 Jahren festsetzen.
Es besteht nach der DS-GVO die Möglichkeit, dass andere EU-Mitgliedstaaten das Alter auf 13 Jahren festsetzen.
Art. 12 ff. – Betroffenenrechte
Verantwortliche Stellen müssen die Rechte Betroffener kennen und Prozesse implementieren, um hierauf entsprechend reagieren zu können. So müssen z. B. Geschäftsprozesse geprüft und die Sachverhalte erfasst werden, an die Informationspflichten (z. B. bei einer Einwilligung oder bei einer Datenerhebung über Dritte) geknüpft sind. Ferner sollten Umfang und Grenzen von Betroffenenrechten und die Fristen bekannt sein, in denen verantwortliche Stellen Betroffenenrechte erfüllen müssen und deren Einhaltung sichergestellt sein.
Art. 13, 14 - Erfüllung der Informationspflichten
Verantwortliche Stellen haben nachzuweisen, dass sie die erweiterten Informationspflichten nach der DS-GVO erfüllen. Es empfiehlt sich insoweit, diese Informationen zum Datenschutz (auch Vorversionen mit dem Hinweis „verwendet von… bis…“) aufzubewahren sowie den Zeitpunkt der Übermittlung zu dokumentieren. Ein Verstoß gegen Informationspflichten führt in der Regel nicht dazu, dass die Datenverarbeitung unzulässig wird. Allerdings sind die Verstöße bußgeldbewährt.
Art. 15 - Erfüllung der Auskunftsersuchen
Jede Person, deren Daten verarbeitet werden, hat das Recht, unentgeltlich binnen eines Monats (Fristverlängerung um max. zwei Monate möglich) von der verantwortlichen Stelle Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über sie verarbeitet werden. Wichtig hierbei ist, dass ein Auskunftsanspruch nicht uneingeschränkt besteht. Würde eine Auskunft z. B. Rechte Dritter, ein Geschäftsgeheimnis oder ein Urheberrecht beeinträchtigen, so ist ein Verantwortlicher nicht verpflichtet, die Auskunft insoweit zu erteilen. Generell empfiehlt es sich, Umfang und Grenzen von Auskunftsansprüchen zu kennen und intern entsprechende Festlegungen (z. B. wer darf Auskunftsansprüche bearbeiten, Mitarbeiter schulen und festlegen, was als Geschäftsgeheimnis anzusehen ist) zu treffen. Denn jede Person kann von einer datenverarbeitenden Stelle, wenn diese die Identität eines Antragstellers geprüft hat, in den Varianten „schriftlich“, „Kopie der Daten“ bzw. „elektronisch bei elektronischer Antragstellung“ folgende Auskünfte über sich verlangen:
· ob Daten zu seiner Person verarbeitet werden
· die Verarbeitungszwecke und Datenkategorien
· Empfänger(-kategorien)
· Information über das Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde
Datenschutzaufsichtsbehörde
· Herkunft der Daten, soweit diese nicht beim Betroffenen selbst, sondern
bei Dritten erhoben worden sind
bei Dritten erhoben worden sind
· bei automatisierten Entscheidungen/Profiling: Über die implementierte
Logik und die Tragweite/Auswirkungen dieser Verarbeitung für/auf den
Betroffenen
Logik und die Tragweite/Auswirkungen dieser Verarbeitung für/auf den
Betroffenen
· Unterrichtung über geeignete Garantien bei Drittlandtransfers (z. B.
Standardvertragsklauseln, gesichertes Drittland)
Standardvertragsklauseln, gesichertes Drittland)
Art. 16 - Erfüllung des Rechts auf Berichtigung
Verantwortliche haben unrichtige Angaben über eine Person auf deren Verlangen unverzüglich zu berichtigen und unvollständige Angaben zu ergänzen.
Art. 17 - Erfüllung des Rechts auf Löschung
Sind Angaben über eine Person für eine Verarbeitung nicht mehr notwendig, so hat der Verantwortliche diese unverzüglich zu löschen. Dies gilt auch, wenn ein Betroffener aus diesem Grund die Löschung seiner Daten fordert. Betroffene können verlangen, dass Verantwortliche ihnen bestätigen, dass diese die Daten antragsgemäß gelöscht haben. Sie sind jedoch nicht verpflichtet zu dokumentieren, welche Daten wann gelöscht worden sind. Allerdings sollten sie ein Löschkonzept (Dokumentation) haben und darin festlegen, wie lange bestimmte Daten aufgrund gesetzlicher bzw. unternehmensinterner Vorgabe aufbewahrt werden müssen.
Wer Angaben über eine Person (im Internet) veröffentlicht, sollte festhalten, an wen er welche Daten zur Veröffentlichung weitergegeben hat. Denn verantwortliche Stellen müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass sie diejenigen, an die sie die Daten über eine Person weitergeben haben, darüber informieren können, dass diese Person eine Löschung aller Links, Kopien oder Replikationen verlangt. Um diesen Anspruch erfüllen zu können, haben sie unter Berücksichtigung angemessener Implementierungskosten eine entsprechende Technologie einzusetzen.
Art. 18 - Erfüllung des Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung
Betroffene haben das Recht, hinsichtlich ihrer Daten eine eingeschränkte Verarbeitung zu verlangen, falls
- Betroffene deren Richtigkeit bestreiten oder
- die Daten ohne Rechtsgrundlage verarbeitet werden und ein Verantwortlicher eine Löschung ablehnt oder
- die Daten zwar nicht mehr für den ursprünglichen Verarbeitungszweck, jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden oder
- bei einem Widerspruch des Betroffenen gegen eine Datenverarbeitung, der gestützt wird entweder auf ein überwiegendes öffentliches bzw. berechtigtes (z. B. bei Profiling) Interesse oder auf die Ausübung öffentlicher Gewalt, die einer verantwortlichen Stelle übertragen worden ist. Eine Einschränkung der Verarbeitung bleibt bestehen, bis nachgeprüft ist und feststeht, ob ein Verantwortlicher die Daten rechtmäßig verarbeitet, weil er berechtigte Gründe hierfür geltend machen kann und diese diejenigen überwiegen, die der Betroffenen vorträgt.
Eine Einschränkung der Verarbeitung hat zur Folge, dass Verantwortliche derartige Daten zwar speichern, jedoch nur noch sehr eingeschränkt weiterhin verwenden dürfen, d. h. entweder nur mit der Einwilligung der Betroffenen oder zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen oder bei Vorliegen eines wichtigen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaates.
Verlangt ein Betroffener dies, so hat ein Verantwortlicher ihn auch darüber zu informieren, dass er eine Einschränkung einer Verarbeitung aufhebt. Auch dies sollte dokumentiert werden.
Art. 19 - Mitteilungspflicht an Dritte
Betroffene können verlangen, dass Verantwortliche allen, denen gegenüber sie Daten über diese Person (z. B. im Internet) offengelegt haben, jede Berichtigung, Löschung oder Einschränkung dieser personenbezogenen Daten mitteilen. Möchte ein Betroffener dies wissen, so hat der Verantwortliche ihm zudem die Empfänger der Daten zu nennen. Eine Mitteilungspflicht entfällt, falls sich dies als unmöglich oder als mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden erweist (Rat: Gründe hierfür festhalten). Um dieses Betroffenenrecht erfüllen zu können, ist eine Dokumentation derartiger Empfänger unerlässlich.
Kontakt

Thorsten Drescher
Bereichsleiter | Stv. Hauptgeschäftsführer
Abteilung: Recht | International | Beitrag