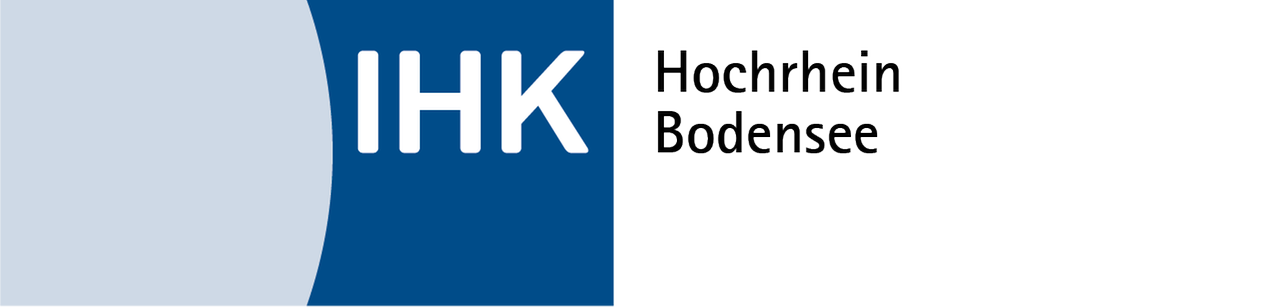Positionen zu regionalen, landes- und bundespolitischen Themen
- Vorwort
- I. Förderung
- II. Stärkung der Verkehrsinfrastruktur der Region Hochrhein-Bodensee
- III. Innovationsförderung in der Region Hochrhein-Bodensee
- IV. Umweltschutz in der Region Hochrhein-Bodensee
- V. Unternehmen entlasten und Arbeitsplätze sichern, Steuerreformen vorantreiben
- VI. International: Teilhabe am weltweiten Wachstum ermöglichen
- VII. In Aus- und Weiterbildung investieren
Vorwort
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee vertritt die Interessen der regionalen Wirtschaft in der Öffentlichkeit sowie auf allen Ebenen von Politik und Verwaltung. Diese Aufgabe schließt auch Positionen zu überregionalen, landes- und bundespolitischen Themen ein, wenn und soweit ihnen Relevanz für die regionale Wirtschaft zukommt. Für den Dialog mit Bundes- und Landtagsabgeordneten, mit Regierungsmitgliedern sowie für Stellungnahmen gegenüber Verwaltung und Öffentlichkeit beschließt die Vollversammlung einen Katalog von Themen und darauf bezogenen Einzelzielen, mit deren Konkretisierung und Verfolgung in der täglichen Arbeit der IHK sowie dem kontinuierlichen Bericht darüber an die Vollversammlung die Präsident, Präsidium und das Hauptamt beauftragt. Die folgenden Positionen können zudem als Gesprächsgrundlage für alle Mitgliedsunternehmen und besonders für die ehrenamtlichen Unternehmensvertreter dienen. Sie sind eingeladen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und politischen Kontakte die Positionen zu fördern und für die Realisierung der Einzelziele zu werben.
I. Förderung
der Region Hochrhein-Bodensee als Teil des Europäischen Verflechtungsraums Bodensee und der Trinationalen Europäischen Metropolregion Oberrhein
- Schneller Ausbau BAB A5 / A98
- Lückenschluss A1 (CH) zu A81
- Ausbau Oberrheinbahn
- Pkw-Maut zur Finanzierung und zum Ausbau der BAB mit der Maßgabe,
- dass Einnahmen von einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft in einem separaten Haushalt verwaltet und zweckgebunden verwendet werden
- dass Bürokratieabbaupotenziale realisiert werden (Abschaffung Kfz-Steuer)
- dass Mautsysteme bürokratiearm und effizient implementiert, zugleich aber technikoffen für komplexere Lösungen (Verkehrslenkung) gehalten werden - Rhineports: Förderung und Entwicklung von konkreten Modellen einer effizienteren Zusammenarbeit zur Nutzung von Synergieeffekten
- Abbau der Hemmnisse für D- und CH-Unternehmen bei der grenzüberschreitenden Auftragserfüllung im jeweiligen Nachbarland (Einwirken auf EU-Ebene)
- Schaffung von ausreichenden Lkw-Stellplätzen an Autobahnen in Baden-Württemberg
- Sicherung und Stärkung des Energiestandortes durch verlässliche Rahmenbedingungen und Unterstützung notwendiger Investitionen unter der Ziel – Trias „Versorgungssicherheit / Kostendämpfung / Nachhaltigkeit“
- Erhaltung und Neuansiedlung von Bundeseinrichtungen, z. B. neue wirtschaftsnahe
Institute, Aufsichtsbehörden oder Agenturen - Herstellung flächendeckender leistungsfähiger Breitbandversorgung, z. B. durch finanzielle Förderung von Netzausbau und -betrieb im ländlichen Raum
- Unterstützung bei der Umsetzung der Visionen für den Europäischen Verflechtungsraum Bodensee und der Trinationalen Europäischen Metropolregion Oberrhein
- Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtern
- Staatliche Konkurrenz zur Privatwirtschaft vermeiden; Umsetzung der Vorgaben der GemO BW und Weiterentwicklung der gesetzlichen Vorgaben im Sinne eines Vorranges privatwirtschaftlicher Tätigkeit; wider einen weiteren Ausbau der Möglichkeiten (insbesondere interkommunaler oder Gemeindegebiet überschreitender) wirtschaftlicher Betätigung der Kommunen
- Zügige Umsetzung von Infrastrukturprojekten, Baumaßnahmen und raumbedeutsamen Planungen nach Abschluss der dafür gesetzliche vorgegebenen Genehmigungsverfahren und allfälligen Rechtsschutzmaßnahmen hiergegen (Beispiel Stuttgart 21):
- Stärkung einer politischen Kultur des Unternehmens gegen eine Kultur des Zögerns, Verhinderns und Blockierens zur Durchsetzung von Partikularinteressen;
- Stärkung des (imperativen) politischen Mandats gegen ein medial getriebenes „Quasi“- Plebiszit
- für einen wissenschaftlich gestützten, bewussten Umgang mit Risiken als Preis wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fortschritts
II. Stärkung der Verkehrsinfrastruktur der Region Hochrhein-Bodensee
- Weiterführung der A 98 nach Osten sowie Sicherstellung der Finanzierung
- Zügiger vierspuriger Ausbau der B 33 zwischen Allensbach und Konstanz
- Erweiterung der B 34 durch eine zusätzliche, dritte Fahrspur zwischen dem Gewerbepark Hochrhein und der Kreuzung am Grenzübergang Waldshut/Koblenz
- Elektrifizierung und Ausbau der Hochrheinstrecke
- Rascher Ausbau der Gäubahn
- Zügiger Ausbau der Rheintalschiene (Anschluss an die NEAT)
- Sicherstellung ausreichender Mittel für den ÖPNV
- Ausbau der Regio-S-Bahn, insbesondere Schaffung eines Schienenanschlusses zwischen dem EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg und dem Landkreis Lörrach
- Entwicklung des Flughafens Zürich-Kloten entsprechend seiner Bedeutung als Standortfaktor für den süddeutschen Raum unter Berücksichtigung der Interessen der Anwohner, Mitgliedsunternehmen und Einrichtungen, insbesondere
- Lösung des sog. Flughafenstreits um das Anflugregime auf den Flughafen Zürich-Kloten auf der Basis einvernehmlich gemessenen Lärms;
- Abkehr von der Verhandlungsbasis „Zahl der Anflüge“ zugunsten von flexiblen Lärmkontingenten, die intelligenten Lösungen insbesondere der Lärmvermeidung (Flottenmanagement, Continuous Descent Approach u.a.) Raum lassen;
- Klärung der Entscheidungsstrukturen auf lokaler, Landes- bzw. Bundesebene zugunsten eines klaren Entscheidungsmandats auf der adäquaten Ebene
- Berücksichtigung der Interessen der Wirtschaft und der in ihr Beschäftigten beidseits des Rheines als gleichberechtigte Anliegen neben dem Lärmschutzinteresse der sog. Wohnbevölkerung
- gezielte Suche nach Win-Win-Lösungen unter Einbeziehung aller wechselseitigen Verkehrsinteressen in der Luft und am Boden - Lösung der Taxiproblematik am Flughafen Zürich-Kloten im Sinne eines ungehinderten Marktzuganges für deutsche Unternehmen bei vorbestellter Personenbeförderung
- Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine beschleunigte Verzollung im Güterkraftverkehr an den deutsch-schweizerischen Grenzübergängen
- Schneller Ausbau der Vorstauräume für Lkw an den Grenzübergängen
- Verknüpfung der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße zur Entlastung der Straße
- Förderung des Logistikstandortes Weil am Rhein/Basel zur Optimierung des Güterverkehrs
III. Innovationsförderung in der Region Hochrhein-Bodensee
- Unterstützung des Ausbaus und der Weiterentwicklung der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen im Interesse wirtschaftsnaher Forschung und Lehre
- Verbesserung des Technologietransfers zwischen Hochschulen und Unternehmen; Schaffung einer Modellregion für zukunftsorientierte Pilotversuche unter Einschluss und Nutzung von Förderprogrammen
- Umfragen als Grundlage für Forderungen an die Politik zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung
- Ausbau der Förderprogramme vorrangig durch Weiterentwicklung bestehender, erfolgreicher Förderungen anstelle der Entwicklung und Implementation immer wieder neuer Programme und Maßnahmen
- Erleichterung bei der Kreditvergabe für Innovationen
- Sicherung der Ausbildung von Fachkräften und wissenschaftlichem Nachwuchs in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) z. B. durch Unterstützung des ROBO-Wettbewerbes mit der Dualen Hochschule in Lörrach
- Förderung der regionalen Netzwerke und Cluster u. a. in den Bereichen Life Science, Gesundheit, Energie, Umwelttechnik, IT, neue Werkstoffe, Verpackungen, Nanotechnologie, Automotive.
- Unterstützung der Unternehmen bei Innovations- und Umweltwettbewerben
IV. Umweltschutz in der Region Hochrhein-Bodensee
- Förderung der Energieeffizienz und des Ausbaus der Stromnetze, beispielsweise durch Befürwortung von Speicherkraftwerken im Sinne der Zieltrias „Versorgungssicherheit / Kostendämpfung / Nachhaltigkeit“
- Förderung der Entwicklung von Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Entsorgungstechnologien in Kooperation mit den Hochschulen
- Finanzierung von Hochwasserschutzmaßen sicherstellen
- Liberalisierung der Andienungs- und Überlassungspflicht für Sonderabfälle
- Aktivitäten des Landes zur Ressourceneffizienz bündeln (z.B. durch die Errichtung einer Effizienzagentur)
V. Unternehmen entlasten und Arbeitsplätze sichern, Steuerreformen vorantreiben
- Förderung einer Kultur der Selbstständigkeit
- Verbesserung der Wagniskapital- und Bürgschaftsfinanzierung
- Reform des Steuerrechts
- Steuerrecht spürbar vereinfachen: die Leitlinien heißen „klares, zielgenaues und verfassungskonformes Steuerrecht mit niedrigen Sätzen“, weniger komplizierte Einzelfallregelungen, weniger Lenkungsvorschriften, weniger Ausnahmen, dafür mehr Pauschalen, höhere Transparenz und als Zielwert eine „Flat-Tax“ von 25 Prozent.
- Es ist dringend erforderlich, die steile Progression der Einkommenssteuer im unteren und mittleren Einkommensbereich („Mittelstandsbauch“) und die daraus resultierenden negativen Leistungsanreize zu beseitigen. Dies gilt auch für die „kalte Progression“, damit dem Bürger von Lohnerhöhungen mehr übrig bleibt.
- Die Hürden für die Unternehmen aus der Unternehmensteuerreform müssen beseitigt werden. Der Wegfall der gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen, der Zinsschranke sowie der Mantelkaufregelung verbessern Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation der Unternehmen.
- Eine kommunale Gewinnsteuer kann sowohl den Gemeinden als auch den Unternehmen Finanz- und Planungssicherheit geben. Die Kommission zur Gemeindefinanzreform muss zu Ergebnissen kommen, die diese Vorgabe erfüllen.
- Die Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer müssen reduziert werden. Das ermöglicht eine Senkung des Normalsatzes und baut spürbar Bürokratie ab. Dabei ist vor allem der Katalog der ermäßigten Mehrwertsteuersätze zu überarbeiten. Eine konsequente Umsetzung des Ursprungslandprinzips würde den Export ins europäische Ausland erleichtern und befördern.
- Die Umsetzung der sog. E-Bilanz, der elektronischen Übermittlung der Bilanzen an die Finanzämter, muss sich strikt nach der gesetzlichen Regelung richten. Den Unternehmen darf keine zusätzliche steuerliche Buchführung aufgezwungen werden, die weit über die handelsrechtlichen Anforderungen hinausgeht.
VI. International: Teilhabe am weltweiten Wachstum ermöglichen
- Freien Zugang zu internationalen Absatz- und Beschaffungsmärkten gewährleisten vor allem durch
- Abbau tarifärer wie nicht tarifärer Handelshemmnisse,
- besseren Schutz geistigen Eigentums
- leichteren Zugang zu öffentlichen Aufträgen im Ausland, möglichst durch Abschlüsse multilateraler Handelsabkommen oder – als zweit beste Lösung – durch Abschlüsse WTO-konformer regionaler oder bilateraler Handelsabkommen
- Sicherung des Zugangs zu internationalen Rohstoffquellen, z. B. durch internationale Rohstoffabkommen mit fairen Regelungen für alle Ex- und Importländer von Rohstoffen
- Vollendung des EU-Binnenmarktes, z. B. durch die gegenseitige automatische Anerkennung von Zulassungszertifikaten und den einheitlichen Vollzug von EU-Bestimmungen in allen Mitgliedsstaaten. - Bürokratie abbauen durch
- Verfahrensvereinfachungen und -beschleunigungen bei Zollverfahren, der Exportkontrolle sowie bei staatlichen Exportkredit- und Investitionsgarantien
- Widerstand gegen Pläne der Politik, die die regionale Wirtschaft mit weiteren Bürokratiekosten belasten würden, wie z.B. die Einführung von Listenregelungen im handelspolitischen Ursprungsrecht, die Pflicht zahlreiche Konsumgüter mit „Made-in…“-Angaben versehen zu müssen, der Wegfall der barrierefreien Internetzollanmeldung oder die Abschaffung der mündlichen Ausfuhranmeldung für Kleinsendungen bis 1.000 Euro. - Leistungsfähige Zollinfrastruktur in der Region sichern; hierzu gehören insbesondere der Erhalt der Binnenzollämter in den Landkreisen Lörrach und Konstanz, wirtschaftsfreundliche Öffnungszeiten der Zollämter und die zeitnahe Bearbeitung von Vorgängen. Die Einführung einer Mindestumsatzgrenze bei den sog. Ausfuhrkassenzetteln ist abzulehnen.
- Auslandsgeschäft politisch effektiv flankieren; hierzu gehört z. B. das aktive „Türöffnen“ insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen bei ausländischen öffentlichen Auftraggebern, Hilfe bei wenig transparenten Genehmigungsverfahren und das Intervenieren bei nicht nachvollziehbaren Genehmigungsentscheidungen.
- Interessen der Wirtschaft in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit angemessen berücksichtigen; hierzu gehört vorrangig die Ausrichtung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf
- Felder, in denen deutsche Unternehmen über komparative Vorteile verfügen. Dies gilt z. B. in den Bereichen Gesundheit, Umweltschutz und Klimaschutz und durch klimaschonende konventionelle, erneuerbare und/oder dezentrale Energieerzeugung. Vor Beginn bilateraler Regierungsverhandlungen mit Entwicklungsländern zu den künftigen Schwerpunkten der Entwicklungszusammenarbeit sollten die Vorschläge der deutschen Wirtschaft eingeholt werden.
- Projekte, welche eine dauerhaft positive wirtschaftliche Entwicklung der Partnerländer unterstützen. Hierzu gehören insbesondere Projekte zur Schaffung von Rechtssicherheit und unternehmensfreundlichen Rahmenbedingungen, zu effektiven staatlichen Verwaltungsstrukturen, zur Förderung der Privatwirtschaft im Partnerland, zur Verbesserung der Infrastruktur und des beruflichen Bildungsniveaus. - Wirtschaftsgerechte Investitionsschutz- und Doppelbesteuerungsabkommen abschließen; Ziel muss insbesondere sein, dass die deutschen Abkommen zu keinen Wettbewerbsnachteilen für hiesige Unternehmen gegenüber ihren Wettbewerbern aus anderen Staaten führen, die ebenfalls über Abkommen mit dem entsprechenden Zielland verfügen. Sollten Investitionsschutz- und/oder Doppelbesteuerungsabkommen künftig statt durch die Bundesrepublik Deutschland durch die EU abgeschlossen werden, dürfen hierdurch für deutsche Unternehmen keine Verschlechterungen gegenüber dem aktuellen Stand eintreten.
- Wirtschaftsnahe Geschäftsvisa-Vergabepraxis sicherstellen; z. B. kann durch zügige Einführung biometrischer Daten auf das persönliche Erscheinen des Antrags stellenden ausländischen Geschäftspartners bei der ausstellenden deutschen Vertretung verzichtet werden.
- Bewährte Instrumente der Außenwirtschaftsförderung stärken; dies gilt insbesondere für
- das Auslandshandelskammer-Netzwerk
- das objektive Informationsangebot über Auslandsmärkte und
- das Auslandsmesseprogramm des Bundes.
• Ausländische Investitionen ermöglichen; Investitionen sollten
- durch entsprechende rechtliche Regelungen erleichtert, aber auch gegen volkswirtschaftlich kontraproduktive Entwicklungen abgesichert und
- durch effiziente und abgestimmte Investitionsförderung des Bundes, des Landes, der Region und der Kommunen unterstützt werden.
• Fachkräftebedarf auch durch Zuwanderung sichern; unser Zuwanderungsrecht muss
- am Fachkräftebedarf der Wirtschaft orientiert und ausgerichtet sein und
- mindestens so attraktiv wie die Zuwanderungsregelungen konkurrierender Länder gestaltet werden.
VII. In Aus- und Weiterbildung investieren
- Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen, z. B. durch gezielte Fördermaßnahmen für lern- und leistungsschwache SchülerAusbau des Angebotes an vorschulischer Kinderbetreuung
- Ausrichtung der Unterrichtsinhalte an den beruflichen Anforderungen, z. B. durch den Einsatz neuer Medien, durch berufsspezifischen Fremdsprachenunterricht und durch Einbindung von Praxisphasen außerhalb der Schulen für Schüler und Lehrer sowie den Einsatz von Praktikern als Lehrpersonal
- Einrichtung eines landesweiten Schul-TÜVs zur Qualitätssicherung
- Wirtschaft als eigenständiges Unterrichtsfach in den Schulen und Teil der Lehrerausbildung
- Orientierung der Ausbildung an internationalen Rahmenbedingungen wie dem europäischen Binnenmarkt und der Globalisierung, z. B. durch Ausbau der Förderung von Auslandsaufenthalten und Praktika
- Ausbau der Förderung von lebensbegleitendem Lernen, der Internationalisierung und von zielgerichteten Angeboten für ältere Arbeitnehmer in der Weiterbildung
- Ausrichtung der Weiterbildungsfinanzierung der Arbeitsagenturen am Vermittlungserfolg
- Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen bei der strategischen Personalplanung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels
- Werbung für den „Karriereweg berufliche Bildung“, insbesondere Angebot von Vor- und Brückenkursen zur Erleichterung des Hochschulstudiums für beruflich Qualifizierte
- Förderung der Attraktivität dualer Ausbildung durch gezielte Förderung der Leistungsstarken „am oberen Rand“
- Gewinnung und Sicherung von Fachkräften durch erleichterte Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse ohne Aufgabe qualitativer Standards
- Förderung der Errichtung eines überbetrieblichen Aus- und Weiterbildungsgebäudes durch Landes- und Bundesmittel
- VIII. Bürokratie abbauen, Verwaltungsabläufe verbessern, Wirtschaftsverkehr erleichtern
- Umsetzung von EU-Richtlinien und Verordnungen ohne verschärfende nationale Sonderregelungen – gegen das sog. Goldplating
- Bürokratieabbau und Verwaltungsvereinfachung, Ausrichtung des Einheitlichen Ansprechpartners an diesen Zielen
- Neufassung der Gewerbeordnung mit dem Ziel der Deregulierung und Effizienzsteigerung, z. B. durch Öffnung für E-Government-ProzesseBekämpfung des Abmahn-Unwesens im Online-Handel durch vereinfachte Regelungen
Konstanz/Schopfheim, 1. Dezember 2010