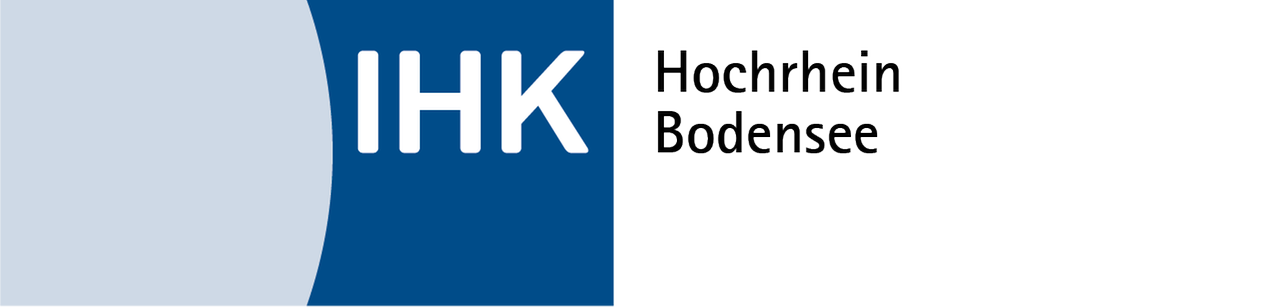Position zur Einführung einer gesetzlich festgelegten Frauenquote
1. Ausgangslage:
Im Management von Unternehmen besetzen Frauen in Deutschland inzwischen 20 Prozent der Stellen auf der ersten und zweiten Ebene, mit zunehmender Tendenz. Ebenso sind viele Frauen erfolgreich als Eigentümerunternehmerinnen tätig. Vier von zehn Unternehmen in Deutschland werden von Frauen gegründet. Das entspricht jährlich 160.000 neuen, von Frauen geführten Unternehmen. Der Anteil ist in den letzten zehn Jahren von 30 auf 40 Prozent gewachsen.
In den Spitzenpositionen großer Unternehmen ist der Frauenanteil dagegen noch gering. Zwar steigt auch hier die Quote, aber langsamer als gewünscht. Die Gründe für die noch geringe Zahl von Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft sind vielfältig: häufigere und längere Erwerbsunterbrechungen als bei Männern, mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine Berufswahl, die nur selten in technische oder naturwissenschaftliche Bereiche führt.
Nicht übersehen werden darf insbesondere, dass in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Mehrzahl der heutigen Aufsichtsräte in Großunternehmen studierte, der Frauenanteil in den entsprechenden Fakultäten noch weitaus geringer war als heute und vielfach dem aktuellen, geringen Frauenanteil in den Führungspositionen entspricht. Die mittlerweile zahlreicheren und vor allem erfolgreichen Absolventinnen an den Universitäten werden erst zeitversetzt in den Führungspositionen der Unternehmen ankommen.
Schließlich ist festzustellen, dass Frauen bevorzugt in kleineren Unternehmen arbeiten. In Betrieben bis 9 Mitarbeiter sind 50 Prozent der Beschäftigten weiblich, ab einer Größe von 500 Mitarbeitern sind es nur noch 34 Prozent.
Die skandinavischen Länder werden oft als Vorbild beim Thema Chancengleichheit genannt, ohne die unterschiedliche Ausgangslage zu berücksichtigen: Beträgt die Beschäftigungsquote von Frauen hierzulande knapp 66 Prozent, liegt diese in den skandinavischen Staaten zwischen 69 und 75 Prozent. Gravierende Unterschiede gibt es beim Anteil von Frauen in Teilzeit: In Deutschland arbeiten 39 Prozent der Frauen unter 30 Stunden pro Woche, in Finnland nur 9 Prozent, in Dänemark und Schweden 14 Prozent. In den skandinavischen Ländern sind die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber auch besser, etwa dank umfangreicher Betreuungsangebote.
2. Stellungnahme:
Gut ausgebildete Frauen – und von ihnen erreichen immer mehr die für die Besetzung von Vorstands- und Aufsichtsratspositionen typische Altersklasse (s. ob.) – sollen ihre Qualifikationen auf allen Führungsebenen einbringen können. Das liegt, nicht zuletzt in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels, im ureigenen Interesse der Wirtschaft. Dennoch müssen Unternehmen auch weiter ihre Positionen mit der jeweils am besten geeigneten Person besetzen können, unabhängig von deren Geschlecht. Angesichts der hervorragenden Abschlüsse, die Hochschulabsolventinnen aufweisen, kann eben dieses kein Hindernis für eine zunehmende Beschäftigung von Frauen sein. Wo es dagegen an geeigneten Bewerbungen (noch) fehlt, liegt in der Nichtberücksichtigung einer Bewerberin keine Diskriminierung.
3. Forderungen:
Die zahlreichen Anstrengungen, die die IHKs schon gegenwärtig unternehmen, um die Bedingungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen stetig zu verbessern, sind engagiert fortzusetzen. Die Kinderbetreuung muss mit dem Ziele flächendeckender, qualifizierter, lückenloser und verlässlicher Betreuung ausgebaut werden, damit trotz Familie der lange Weg über einen Aufstieg in der Unternehmenshierarchie, mit der Chance auf Spitzenpositionen, nicht frühzeitig gebremst wird. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann durch zahlreiche Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Arbeit oder eine stärkere Rücksichtnahme auf familiäre Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert werden.
Mädchen müssen für ein breiteres Spektrum bei der Berufswahl interessiert werden, auch für Berufe, die Chancen für Spitzenpositionen in der Wirtschaft eröffnen. Initiativen wie der „Girls’ Day“ oder der „Nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen“ sind gute Beispiele und müssen weiter verfolgt werden.Diese Maßnahmen müssen ineinandergreifen, um wirksam die Ursachen für den niedrigen Anteil von Frauen in Spitzenpositionen bekämpfen zu können.
Mit der intensiven Verzahnung von Schule und Wirtschaft und gezielten Maßnahmen und Projekten zur frühzeitigen Berufsorientierung gehen die IHKs den mühsameren, aber richtigen Weg, die Bedingungen für den Frauenanteil in der Wirtschaft zu verändern, statt ein gewünschtes Ergebnis gesetzlich zu erzwingen, ohne die Rahmenbedingungen selbst verändert zu haben. Eine gesetzliche Frauenquote für Führungspositionen in der Wirtschaft, egal ob hart oder flexibel, wird deshalb abgelehnt. Die Unternehmen sind aufgerufen, Frauen als Führungskräfte ohne staatliche Bevormundung gezielt und nachhaltig aufzubauen.
Die Vollversammlung der IHK Hochrhein-Bodensee spricht sich für die stetige Verbesserung der Bedingungen für die Berufstätigkeit von Frauen aus; Haupt- und Ehrenamt arbeiten dafür in zahlreichen Projekten und Initiativen intensiv zusammen. Nicht die gesetzliche Vorgabe eines gewünschten Ergebnisses, sondern die Schaffung der Voraussetzungen, unter denen sich dieses Ergebnis von selbst einstellt, ist der richtige Weg. Deshalb wird die Einführung einer gesetzlich festgelegten Frauenquote abgelehnt.
Konstanz/Schopfheim, 17. Mai 2011