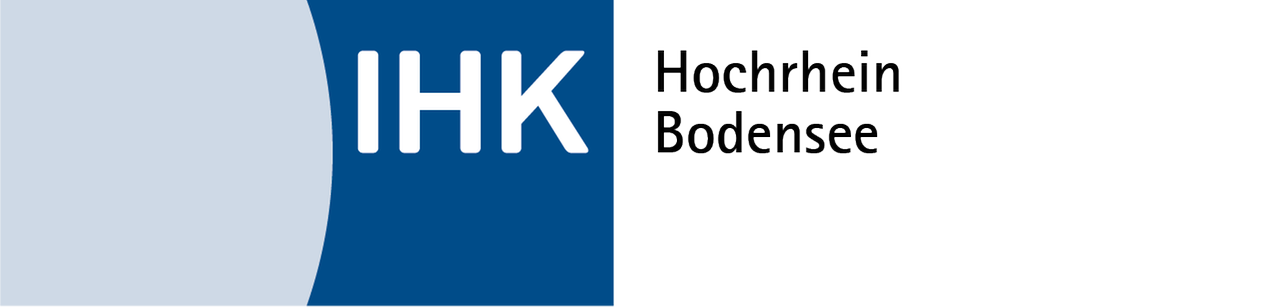Internet und E-Mails am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz stellt sich häufig die Frage, ob der Arbeitnehmer das Internet privat nutzen darf und/oder private E-Mails über den betrieblichen E-Mail Account versenden darf.
Für den Arbeitgeber bedeutet dies gleichzeitig die Frage, ob er dann noch auf das E-Mail-Postfach der Beschäftigten zugreifen darf, und/oder, ob er die Internetnutzung kontrollieren darf. Entscheidend ist, ob die private Nutzung vom Arbeitgeber verboten oder zum Beispiel im Arbeitsvertrag oder mittels Betriebsvereinbarung erlaubt worden ist.
1. Die private Nutzung ist untersagt
Wenn die private Nutzung nicht erlaubt wurde, dürfen die betrieblichen Internet- und E-Mail-Dienste nur für die betriebliche Tätigkeit genutzt werden. Eine systematische und lückenlose Vollkontrolle durch den Arbeitgeber, ob sich der Mitarbeiter daran hält, ist unzulässig. Der Arbeitgeber kann stichprobenartig und zeitlich begrenzt kontrollieren (Logfiles und Internetserver), ob das „Surfverhalten“ betrieblichen Zwecken dient. Allerdings ohne Herstellung eines Personenbezugs, d.h. insbesondere auch ohne Einbeziehung der IP-Adresse und anderer Merkmale zur Identifizierung der einzelnen Beschäftigten. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten der Beschäftigten im Einzelfall erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn tatsächlich konkrete Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat oder Pflichtverstöße im Arbeitsverhältnis begangen hat und die jeweilige Maßnahme zur Aufdeckung erforderlich ist. Ist die private Nutzung untersagt, dürfen ein- und ausgehenden dienstlichen E-Mails vom betrieblichen E-Mail-Account durch den Arbeitgeber eingesehen werden, da es sich um rein dienstliche Korrespondenz handelt, auf die er Zugriff nehmen darf. E-Mails dürfen vom Arbeitgeber nicht weiter inhaltlich zur Kenntnis genommen werden, sobald ihr privater Charakter erkannt wurde.
Achtung: Wichtig ist, dass das Verbot der Privatnutzung auch tatsächlich kontrolliert wurde und nicht geduldet oder hingenommen worden ist. Ansonsten ist es möglich, dass durch Kenntnis und Duldung eine sog. “betriebliche Übung” entsteht und die Privatnutzung konkludent genehmigt worden ist.
2. Die private Nutzung ist erlaubt
Ist die Nutzung des Internets und des betrieblichen E-Mail-Postfachs zu privaten Zwecken erlaubt, wird der Arbeitgeber hinsichtlich der privaten Nutzung nach Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden zum Diensteanbieter im Sinne des Telekommunikationsgesetzes und unterliegt den Datenschutzbestimmungen des Telemediengesetzes. Er ist daher grundsätzlich zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet (eine höchstrichterliche Klärung steht dbzgl. noch aus). Ein Zugriff auf Daten, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, ist dem Arbeitgeber grundsätzlich nur mit Einwilligung der Beschäftigten erlaubt. Dies betrifft die Daten, aus denen sich ergibt, welche Internetseiten welche Beschäftigten wann aufgerufen haben (Protokolldaten) und den privaten E-Mailverkehr auf betrieblichen Rechnern.
Der Arbeitgeber kann die Erlaubnis zur privaten Nutzung des betrieblichen E-Mail-Postfachs bzw. der privaten Internetnutzung von Bedingungen abhängig machen: In Betracht kommen Nutzungsregelungen und deren Kontrolle (insbesondere zum zeitlichen Umfang, Inhalt der Nutzung und Verhaltensregeln) und Zugriffsmöglichkeiten des Arbeitgebers. Hierfür ist allerdings eine Einwilligung der Beschäftigten einzuholen, die sich auf Art und Umfang der Kontrollen und Nutzungsregeln zu beziehen hat.
Sämtliche Fragen zur Privatnutzung – die Nutzungsregelungen (zeitlicher Umfang, Verhaltensregeln) und die Zugriffsmöglichkeiten (Informationen über geplante Kontrollen und Protokollierung von Daten) - sollten im Arbeitsvertrag oder mittels Betriebsvereinbarung geregelt werden. Die Beschäftigten müssen vor Abgabe der Einwilligung Kenntnis von den aufgestellten Regeln haben. In der jeweiligen Vereinbarung sollte daher der Gegenstand der späteren, individuellen Einwilligungen beschrieben werden. Auf dieser Grundlage sollten die individuellen Einwilligungen der einzelnen Beschäftigten eingeholt werden. Die Einwilligung sollte mit gesondertem Dokument erklärt werden. Der Mitarbeiter ist darauf hinzuweisen, dass seine Einwilligung freiwillig ist und er diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Allerdings entfällt dann auch das Recht zur privaten Nutzung.
Auf der Grundlage der Einwilligung des Beschäftigten darf eine jeweils anonyme Protokollierung der Internetnutzung und Auswertung der Protokolldaten vorgenommen werden. Eine ständig laufende und lückenlose Überwachung oder Speicherung der Daten ist nicht möglich. Daher sollte zunächst überprüft werden, ob überhaupt verbotene Internetinhalte von den Beschäftigten aufgerufen werden. Erst wenn sich sich Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung ergeben, sollte eine weitergehende Protokollierung und Auswertung erfolgen. Eine personenbezogene Auswertung von Protokolldaten oder Einsehen in das E-Mail-Postfach darf nur anlassbezogen bei einem konkreten Verdacht wegen einer Straftat, oder bei konkreten Anhaltspunkten für eine Arbeitspflichtverletzung in verhältnismäßigem Rahmen erfolgen. So sollte die Kontrolle in Anwesenheit des Betroffenen und im Beisein des Datenschutzbeauftragten und/oder des Betriebsrates/Personalrates erfolgen. Das Lesen offensichtlich privater E-Mails ist ausgeschlossen, es sei denn, es bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass sich die Straftat oder der Arbeitspflichtverstoß gerade aus dem Inhalt dieser privaten E-Mails ergibt.
Ist der private E-Mail-Verkehr vom betrieblichen E-Mail-Postfach erlaubt, sollte der Arbeitgeber klare Vorgaben machen, welche Einstellungen die Beschäftigten vorzunehmen haben, wenn sie - geplant oder nicht geplant – abwesend sind (zum Beispiel Abwesenheitsnotiz). Wurden diese Einstellungen nicht vorgenommen (etwa weil es bei einer ungeplanten Abwesenheit nicht möglich war oder weil es vergessen wurde), darf ein Zugriff auf das betriebliche E-Mail-Postfach der betroffenen Beschäftigten - soweit dies für betriebliche Zwecke erforderlich ist - nur mit vorab eingeholter Einwilligung des betroffenen Mitarbeiters erfolgen.
Ein Zugriff auf bereits vor der Abwesenheit der jeweiligen Beschäftigten eingegangenen E-Mails ist ebenfalls nur zulässig, soweit dieser für betriebliche Zwecke erforderlich ist und vorab die Einwilligung eingeholt wurde.
Tipp: Um die Problematik des Zugriffs auf betriebliche E-Mails bei erlaubter Privatnutzung zu vermeiden, sollten private E-Mails ausschließlich über private E-Mail-Postfächer gesendet und empfangen werden.
Wichtig für das Unternehmen: ein Anspruch auf private Nutzung von E-Mail- oder Internetzugang besteht nicht. Soweit der Arbeitgeber die private Nutzung ausnahmsweise gestattet, erfolgt dies in seinem freien Ermessen (es sei denn die private Nutzung wurde arbeitsvertraglich oder in einem Tarifvertrag zugesichert). Die Nutzungserlaubnis kann also wieder zurückgenommen werden. Ein Vorbehalt, die private Nutzung zu widerrufen, sollte daher in der Nutzungsvereinbarung aufgenommen werden.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder und des Bundes (Deutsche Datenschutzkonferenz) haben zu diesem Themenkreis eine ausführliche Orientierungshilfe erstellt.
Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutzaufsicht Schleswig-Holstein stellt ein Stufenmodell für die private Internetnutzung bereit.
Sie haben noch Fragen? Gerne wir Ihnen zur Verfügung.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dieser Service nur Mitgliedsunternehmen der IHK Hochrhein-Bodensee und solchen Personen, die die Gründung eines Unternehmens in dieser Region planen, zur Verfügung steht.