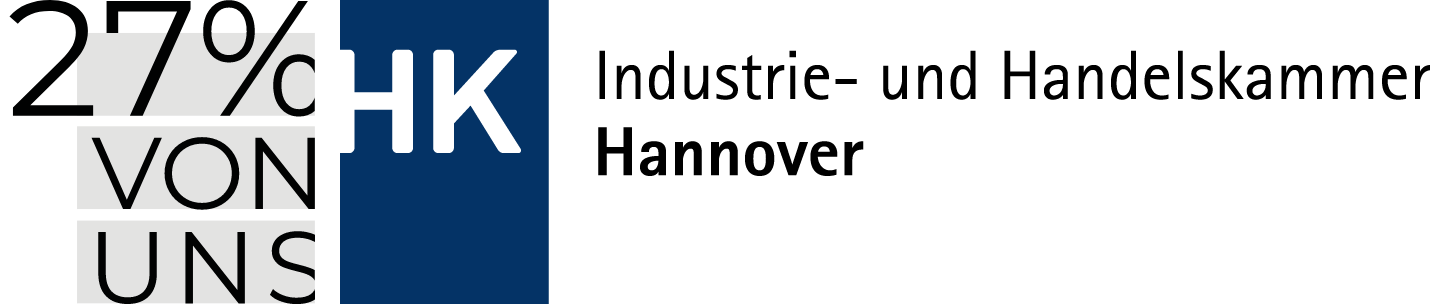Interkulturelle Kompetenz im Geschäft
Nancy Rienow, US-Amerikanerin und interkulturelle Trainerin (www.cross-culture-success.de) weiß, warum es für den Erfolg deutscher Unternehmen auf dem US-Markt so wichtig ist, sich mit den Unterschieden in der deutschen und US-amerikanischen Kultur zu beschäftigen.
Working with Americans
Was Lieschen Müller sagt und Jane Doe denkt.
Deutschland und die USA haben sehr enge Wirtschaftsbeziehungen: Volkswagen, Bosch, Aldi, Continental, Knorr oder Beiersdorf sind in den USA genauso bekannt wie es Amazon, Ford, ExxonMobil, die Jet Tankstellen, Google, McDonalds oder HP hierzulande sind. Es gibt zahlreiche prominente Beispiele erfolgreicher deutsch-amerikanischer Fusionen, exzellent operierende Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen in den USA sowie etablierte Handelsverbindungen zu Importeuren und Endkunden in den USA.
Weniger prominent sind allerdings die Beispiele der gescheiterten Fusionen, der minder performenden US-Dependancen deutscher Unternehmen, der verärgerten OEMs oder des enttäuschten Kunden. Dabei geht in der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit vermutlich genauso oft etwas schief, wie etwas rund läuft. Die Ursachen sind vielfältig: strategische Fehler, eine unglückliche Finanzierung, ein zu hoher Preis oder überschätzte Synergien.
Manchmal hat man aber auch einfach nicht zueinander gefunden: Kulturelle Unterschiede lassen sowohl großen Fusionen als auch ganz normalen Exportgeschäfte zwischen Deutschland und den USA in der Tat nicht selten scheitern.
Deutschland und die USA haben sehr enge Wirtschaftsbeziehungen: Volkswagen, Bosch, Aldi, Continental, Knorr oder Beiersdorf sind in den USA genauso bekannt wie es Amazon, Ford, ExxonMobil, die Jet Tankstellen, Google, McDonalds oder HP hierzulande sind. Es gibt zahlreiche prominente Beispiele erfolgreicher deutsch-amerikanischer Fusionen, exzellent operierende Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen in den USA sowie etablierte Handelsverbindungen zu Importeuren und Endkunden in den USA.
Weniger prominent sind allerdings die Beispiele der gescheiterten Fusionen, der minder performenden US-Dependancen deutscher Unternehmen, der verärgerten OEMs oder des enttäuschten Kunden. Dabei geht in der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit vermutlich genauso oft etwas schief, wie etwas rund läuft. Die Ursachen sind vielfältig: strategische Fehler, eine unglückliche Finanzierung, ein zu hoher Preis oder überschätzte Synergien.
Manchmal hat man aber auch einfach nicht zueinander gefunden: Kulturelle Unterschiede lassen sowohl großen Fusionen als auch ganz normalen Exportgeschäfte zwischen Deutschland und den USA in der Tat nicht selten scheitern.
Kein Exot, aber dennoch anders
Bei Geschäften oder Projekten in asiatischen oder arabischen Ländern kommt der Gedanke an Missverständnisse und -interpretationen bei der Ursachenforschung einigermaßen schnell: In Saudi-Arabien ist eine Vertragsunterzeichnung eben doch sehr viel wahrscheinlicher, wenn sie durch einen Mann initiiert wird. Fällt sie in Honkong auf einen Tag, der eine 6, 8 oder 9 im Datum hat, werden die asiatischen Geschäftspartner dies als gutes Omen bewerten.
Spät, manchmal viel zu spät, werden kulturelle Unterschiede allerdings als Ursache von verpatzten Deals zwischen westlichen Industriestaaten herangezogen. Das gilt auch im Geschäft mit der USA. Sicherlich fehlt einigen Deutschen manchmal das Verständnis für bestimmte Gesetze, Einstellungen oder Angewohnheiten – aber ein Exot auf der Erdkugel sind die USA aus deutscher Sicht nun wirklich nicht. Auch wenn gute 7900 Kilometer, der atlantische Ozean und mindestens sechs Stunden Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Nordamerika liegen, scheinen die USA uns doch recht nah: Der Black Friday, Halloween, die Simpsons oder das iPhone sind hierzulande im gesellschaftlichen Alltag etabliert; die englische Sprache ist der Mehrheit der Deutschen nicht fremd. Tatsache ist jedoch, dass es erhebliche und auch oft unterschwellige Unterschiede zwischen der deutschen- und US-amerikanischen Kultur gibt, die gerade beim Vermarkten, Verkaufen, Verhandeln und in der übergreifenden Projektzusammenarbeit deutlich werden.
Spät, manchmal viel zu spät, werden kulturelle Unterschiede allerdings als Ursache von verpatzten Deals zwischen westlichen Industriestaaten herangezogen. Das gilt auch im Geschäft mit der USA. Sicherlich fehlt einigen Deutschen manchmal das Verständnis für bestimmte Gesetze, Einstellungen oder Angewohnheiten – aber ein Exot auf der Erdkugel sind die USA aus deutscher Sicht nun wirklich nicht. Auch wenn gute 7900 Kilometer, der atlantische Ozean und mindestens sechs Stunden Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Nordamerika liegen, scheinen die USA uns doch recht nah: Der Black Friday, Halloween, die Simpsons oder das iPhone sind hierzulande im gesellschaftlichen Alltag etabliert; die englische Sprache ist der Mehrheit der Deutschen nicht fremd. Tatsache ist jedoch, dass es erhebliche und auch oft unterschwellige Unterschiede zwischen der deutschen- und US-amerikanischen Kultur gibt, die gerade beim Vermarkten, Verkaufen, Verhandeln und in der übergreifenden Projektzusammenarbeit deutlich werden.
© Fotostudios Barth GmbH
„Die Sprache, die Produkte, die vermeintliche Ähnlichkeit der Kultur gepaart mit der Offenheit der US-Amerikaner gegenüber allem, was neu und innovativ ist, führt vermutlich dazu, dass der Markt von vielen deutschen Betrieben am liebsten im Sturm, schnell und großflächig, erobert werden will. Über kulturelle Unterschiede, die es beim Markteintritt eventuell zu beachten gibt, wird am Anfang also oft gar nicht nachgedacht. In der Tat kann die Art und Weise der Kommunikation aber das ,make or break‘ eines Projektes bestimmen“, meint Nancy Rienow. „Das gilt sowohl für Produktpräsentationen und Verhandlungen also auch für den ganz normalen Geschäftsalltag: Beim Smalltalk, in Diskussionen, Telefonaten mit US-Kunden und natürlich auch in Gesprächen mit Kollegen oder Mitarbeiterinnen lauern viele Fettnäpfchen, in die man zu schnell hineinstapfen kann.“
Die sachlichen Deutschen und die diplomatischen Amerikaner
Eigentlich sind US-Amerikanerinnen und -Amerikaner für einen sehr direkten Kommunikationsstil bekannt. Nach dem „How are you?“ und ein bisschen Small Talk zu Wetter, Reise & Co. kommt man bei geschäftlichen Treffen ziemlich schnell und ohne Umschweife direkt zum Thema. Bedarf ein Problem einer sofortigen Lösung, ist eine Angelegenheit sehr wichtig, wird auch nicht lang um den heißen Brei herumgeredet. Dennoch gibt es einen großen Unterschied zwischen dieser Direktheit und der den Deutschen nachgesagten direkten Art. Letzte stößt in den USA nämlich selten auf Gegenliebe.
„Mit einem direkten Wiederspruch in Form eines klaren ,Nein!‘ können die meisten US-Amerikaner nur wenig anfangen“, erklärt Nancy Rienow. Es wirke wie eine Ablehnung. „Ein guter und nachvollziehbarer Gedanke. Aber eventuell könnten wir in Betracht ziehen, diese Spezifikation …“ wäre in den USA viel konstruktiver als das „Nein“. Auch bei der Delegation von Aufgaben, dem Kommunizieren von Deadlines warnt die Expertin vor zu knappen Ansagen: „I need this done“ wird meist als zu direkt empfunden. „That won’t work“ kann schnell als unhöflich und wenig wertschätzend empfunden werden. Für die USA braucht es „softeners“. So könnte man oben genannte Beispiele folgendermaßen formulieren: „It would be great to have this done by … .”, „I like your idea to …., however, I’m concerned that that won’t work because ….. ”
Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Amerikanerinnen das Wort „problem“ im beruflichen Kontext kaum verwenden. Während Deutsche es nutzen, um einer Sorge Ausdruck zu verleihen, benutzen Amerikaner es vor allem, um auf eine aufkommende Krise aufmerksam zu machen. Wenn es in den USA aber keine Probleme gibt, wie äußert man seine Sorgen dann konstruktiv?
„Das ist eine Sache der Perspektive“, meint Nancy Rienow. „Natürlich gibt es in den USA Probleme! Sie werden nur anders beschrieben – als „concern“ oder als „issue“ eben. Das sei kein Fake, habe nichts mit einer Verschleierung von Tatsachen zu tun, sondern sei Ausdruck eines freundlichen und respektvollem Umgangs. Zu diesem freundlichen und respektvollem Umgang gehören übrigens auch Begrüßung und Small Talk. „How are you?“, „Take care“, „Nice to have met you“ – diese Umgangsformen gehören im Supermarkt, dem Wartezimmer, der Rezeption oder an der Tankstelle einfach dazu. Und werden bei geschäftlichen Gesprächen in jedem Fall durch ein bisschen Small Talk ergänzt. Ein freundlicher Schwatz über den neuen Hund, den letzten Urlaub oder den neu eröffneten Golf Club um die Ecke des Büros: „You really need to check out the golf club around the corner here. We could go together.“ In den USA sind diese Umgangsformen wirklich wichtig und sind für den Moment auch immer „ehrlich“ gemeint sind. Wenn dann aber ein konkreter Termin vorgeschlagen wird oder ganz gezielte Nachfragen nach der Abstammung des Hundes kommen, dann wissen Sie, dass noch mehr dahintersteckt und können von einem verbindlichen Interesse ausgehen.“
„Mit einem direkten Wiederspruch in Form eines klaren ,Nein!‘ können die meisten US-Amerikaner nur wenig anfangen“, erklärt Nancy Rienow. Es wirke wie eine Ablehnung. „Ein guter und nachvollziehbarer Gedanke. Aber eventuell könnten wir in Betracht ziehen, diese Spezifikation …“ wäre in den USA viel konstruktiver als das „Nein“. Auch bei der Delegation von Aufgaben, dem Kommunizieren von Deadlines warnt die Expertin vor zu knappen Ansagen: „I need this done“ wird meist als zu direkt empfunden. „That won’t work“ kann schnell als unhöflich und wenig wertschätzend empfunden werden. Für die USA braucht es „softeners“. So könnte man oben genannte Beispiele folgendermaßen formulieren: „It would be great to have this done by … .”, „I like your idea to …., however, I’m concerned that that won’t work because ….. ”
Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Amerikanerinnen das Wort „problem“ im beruflichen Kontext kaum verwenden. Während Deutsche es nutzen, um einer Sorge Ausdruck zu verleihen, benutzen Amerikaner es vor allem, um auf eine aufkommende Krise aufmerksam zu machen. Wenn es in den USA aber keine Probleme gibt, wie äußert man seine Sorgen dann konstruktiv?
„Das ist eine Sache der Perspektive“, meint Nancy Rienow. „Natürlich gibt es in den USA Probleme! Sie werden nur anders beschrieben – als „concern“ oder als „issue“ eben. Das sei kein Fake, habe nichts mit einer Verschleierung von Tatsachen zu tun, sondern sei Ausdruck eines freundlichen und respektvollem Umgangs. Zu diesem freundlichen und respektvollem Umgang gehören übrigens auch Begrüßung und Small Talk. „How are you?“, „Take care“, „Nice to have met you“ – diese Umgangsformen gehören im Supermarkt, dem Wartezimmer, der Rezeption oder an der Tankstelle einfach dazu. Und werden bei geschäftlichen Gesprächen in jedem Fall durch ein bisschen Small Talk ergänzt. Ein freundlicher Schwatz über den neuen Hund, den letzten Urlaub oder den neu eröffneten Golf Club um die Ecke des Büros: „You really need to check out the golf club around the corner here. We could go together.“ In den USA sind diese Umgangsformen wirklich wichtig und sind für den Moment auch immer „ehrlich“ gemeint sind. Wenn dann aber ein konkreter Termin vorgeschlagen wird oder ganz gezielte Nachfragen nach der Abstammung des Hundes kommen, dann wissen Sie, dass noch mehr dahintersteckt und können von einem verbindlichen Interesse ausgehen.“
Von Machern und Denkern
Der Stereotyp der Macher und Denker ist eigentlich so gegenwärtig, dass er eigentlich jeglicher landestypischer Zuordnung entbehrt: In Deutschland wird gedacht, in den USA einfach mal gemacht. Klischee oder Wahrheit?
„Macher und Denker gibt es natürlich sowohl in Deutschland als auch in den USA! Fakt ist aber, dass man in Deutschland dazu neigt, viel ausführlicher über Themen nachzudenken, als dies in den USA tendenziell der Fall ist. Das liegt unter anderem an den unterschiedlichen Denk- und Argumentationsweisen der beiden Kulturen. Ist man sich über die Existenz dieses Unterschiedes bewusst, kann das für die Zusammenarbeit durchaus von großem Vorteil sein. Denn dann werden deutsche Geschäftsleute die Arbeitsweise ihrer US-Kollegen und -Kolleginnen nicht vorschnell als oberflächlich oder leger beurteilen, sondern versuchen, die Hintergründe zu verstehen und die Vorteile der anderen Perspektive und Arbeitsweise zu nutzen. Denn: Was bringt es schon, seinem US-amerikanischen Gegenüber im Vertrieb vorzuschreiben, wie und mit welchen Materialien und Strategien er oder sie vor Ort Produkte, Leistungen und Unternehmensimage des deutschen Betriebs in den USA verkauft? Im Zweifel sind sie es, die die potenziellen Kunden kennen. Ist jemand der Ansicht, technische Datenblätter und Garantieversprechen zugunsten einer guten Geschichte vernachlässigen zu wollen, dann sollte man diesem Versuch eine Chance geben. Die Datenblätter können auch nachgeliefert werden…
Zu viele Details, zum Beispiel über die Unternehmenshistorie, technische Prozesse, Zertifikate etc. können in den USA ganz schnell „over the top“ sein. Hier ist man generell schnell beim Thema – bei dem was wirklich zählt und jetzt wichtig ist. „Wenn Hintergrundwissen benötigt wird, fragt man nach“, meint Nancy Rienow.
„Macher und Denker gibt es natürlich sowohl in Deutschland als auch in den USA! Fakt ist aber, dass man in Deutschland dazu neigt, viel ausführlicher über Themen nachzudenken, als dies in den USA tendenziell der Fall ist. Das liegt unter anderem an den unterschiedlichen Denk- und Argumentationsweisen der beiden Kulturen. Ist man sich über die Existenz dieses Unterschiedes bewusst, kann das für die Zusammenarbeit durchaus von großem Vorteil sein. Denn dann werden deutsche Geschäftsleute die Arbeitsweise ihrer US-Kollegen und -Kolleginnen nicht vorschnell als oberflächlich oder leger beurteilen, sondern versuchen, die Hintergründe zu verstehen und die Vorteile der anderen Perspektive und Arbeitsweise zu nutzen. Denn: Was bringt es schon, seinem US-amerikanischen Gegenüber im Vertrieb vorzuschreiben, wie und mit welchen Materialien und Strategien er oder sie vor Ort Produkte, Leistungen und Unternehmensimage des deutschen Betriebs in den USA verkauft? Im Zweifel sind sie es, die die potenziellen Kunden kennen. Ist jemand der Ansicht, technische Datenblätter und Garantieversprechen zugunsten einer guten Geschichte vernachlässigen zu wollen, dann sollte man diesem Versuch eine Chance geben. Die Datenblätter können auch nachgeliefert werden…
Zu viele Details, zum Beispiel über die Unternehmenshistorie, technische Prozesse, Zertifikate etc. können in den USA ganz schnell „over the top“ sein. Hier ist man generell schnell beim Thema – bei dem was wirklich zählt und jetzt wichtig ist. „Wenn Hintergrundwissen benötigt wird, fragt man nach“, meint Nancy Rienow.
Kurz & knackig. Aber bunt und laut.
Amerikanisches Marketing ist für den Erfolg deutscher Betriebe in den USA von großer Bedeutung. Heutzutage wird so viel online recherchiert, Firmen-Websites werden genauso wie soziale Netzwerke genutzt, um sich ein Bild von Unternehmen und den Menschen dahinter zu machen. Digitaler Content gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Vergleicht man deutsche Reklamen, TV-Werbung, Firmen-Websites oder Produktbroschüren mit ihren US-amerikanischen Pendants, dann bekommt man in den USA sehr viel mehr Farbe, Visionen und „Marktschreierei“ geliefert. Dafür muss man sich nur an die Werbe-Wettbewerb bekannter amerikanischer Fast-Food oder Soft-Drink Riesen erinnern: Blindtastings zwischen Coca-Cola und Pepsi, wie sie von Pepsi schon in den achtziger Jahren in der Welt durchgeführt wurden, Slogans wie „Never trust a Clown“, den Burger King sich im Kampf gegen den Rivalen McDonalds zu eigen machte. In Deutschland wäre ein so aggressives Marketing mit einer Menge Ärger verbunden gewesen – vergleichende Werbung war lange Zeit nur in bestimmten Ausnahmen erlaubt. In den USA hingegen war und ist es eine beliebte Werbeform und wird auch in aggressiver Form nahezu unbegrenzt zugelassen.
„Competition wird in den USA großgeschrieben. Der Wettbewerbsgedanke kulturell einfach eine große Rolle. Deswegen ist vergleichende Werbung auch nicht nur okay, sondern man braucht sie vielleicht sogar, um aus der Masse herauszustechen“, meint die Expertin. „Dennoch würde ich deutschen Unternehmen nicht per se raten, ihrem Marketing einfach mal mehr ,Mascara‘ zu geben: Biotechnologieunternehmen vermarkten ihre Produkte natürlich anders als Autofirmen. Wichtig ist, dass deutsche Betriebe Menschen in den USA in ihrer Werbung ansprechen, sie involvieren.“ Das kann schon eine Herausforderung sein und erfordert auch Arbeit: Für die Webseite bedeutet dies zum Beispiel die amerikanische Telefonnummer für einen Kontakt im Betrieb. Und eine Seite in Englisch natürlich. „Diese sollte allerdings genauso wie Flyer oder Präsentationen nicht einfach in das Englische übersetzt werden. Schauen Sie wie es US-amerikanische Unternehmen aus der Branche machen! Nutzen Sie deren Begrifflichkeiten, Bilder und Farbgebung, wenn es sich mit dem Image Ihres Unternehmens verbinden lässt“, rät Nancy Rienow.
So weit, so gut. Was aber bedeutet dies für die Produktpräsentation deutscher Unternehmen in den USA? Braucht es in den USA immer und in jedem Fall den „Elevator Pitch“, um Erfolg zu haben?
In maximal 30 Sekunden und auf den Punkt genau erklären zu können, was das eigene Produkt oder die eigene Leistung ausmacht… das braucht es vielleicht nicht. Vielleicht wird der Gedanke an den Elevator Pitch deutschen Unternehmen aber helfen, die Produkten und Leistungen in den USA besser an Frau und Mann zu bringen. Anstatt alle Aspekte des eigenen Angebots unbedingt erwähnen zu wollen, sollten wirklich nur die Highlights präsentiert werden. Anstatt die eigene Meinung zu Entwicklung, Produkt oder Angebot zu verkaufen, sollte es darum gehen, die vermeintliche Meinung und Mehrwert, den die Kundin haben wird, zu verkaufen. Denn: Entscheidend ist nicht, was man selbst fantastisch an dem eigenen Angebot findet, sondern das, was der Kunde an dem Angebot fantastisch finden könnte.
Nancy Rienow ergänzt: „Es ist nicht so, dass die US-Amerikaner nicht an Fakten interessiert wären. Die Frage ist nur, welche Fakten für sie wichtig sind oder sein könnten und wie detailliert man hier vorgehen sollte. Deutsche tendieren dazu, Details zu lieben. Für diese Detailverliebtheit, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit werden sie ja auch überall auf der Welt geschätzt. Im Gegenüber mit den USA laufen deutsche Unternehmen allerdings Gefahr, potenzielle Kunden mit zu vielen Details zu langweilen oder sogar abzuschrecken. Meine Empfehlung: Entscheiden Sie, welche Fakten wirklich wichtig sind, und präsentieren Sie zunächst nur diese. Beginnen Sie mit etwas, das die Aufmerksamkeit des Kunden weckt. Stellen Sie eine Frage, erzählen Sie eine Geschichte, und ja, betrachten Sie das Ganze ein wenig als Show. Seien Sie optimistisch und stolz auf das, was Sie präsentieren. Je besser Sie Ton und Geschmack des Kundenkreises treffen, desto erfolgreicher werden Sie sein.“
„Competition wird in den USA großgeschrieben. Der Wettbewerbsgedanke kulturell einfach eine große Rolle. Deswegen ist vergleichende Werbung auch nicht nur okay, sondern man braucht sie vielleicht sogar, um aus der Masse herauszustechen“, meint die Expertin. „Dennoch würde ich deutschen Unternehmen nicht per se raten, ihrem Marketing einfach mal mehr ,Mascara‘ zu geben: Biotechnologieunternehmen vermarkten ihre Produkte natürlich anders als Autofirmen. Wichtig ist, dass deutsche Betriebe Menschen in den USA in ihrer Werbung ansprechen, sie involvieren.“ Das kann schon eine Herausforderung sein und erfordert auch Arbeit: Für die Webseite bedeutet dies zum Beispiel die amerikanische Telefonnummer für einen Kontakt im Betrieb. Und eine Seite in Englisch natürlich. „Diese sollte allerdings genauso wie Flyer oder Präsentationen nicht einfach in das Englische übersetzt werden. Schauen Sie wie es US-amerikanische Unternehmen aus der Branche machen! Nutzen Sie deren Begrifflichkeiten, Bilder und Farbgebung, wenn es sich mit dem Image Ihres Unternehmens verbinden lässt“, rät Nancy Rienow.
So weit, so gut. Was aber bedeutet dies für die Produktpräsentation deutscher Unternehmen in den USA? Braucht es in den USA immer und in jedem Fall den „Elevator Pitch“, um Erfolg zu haben?
In maximal 30 Sekunden und auf den Punkt genau erklären zu können, was das eigene Produkt oder die eigene Leistung ausmacht… das braucht es vielleicht nicht. Vielleicht wird der Gedanke an den Elevator Pitch deutschen Unternehmen aber helfen, die Produkten und Leistungen in den USA besser an Frau und Mann zu bringen. Anstatt alle Aspekte des eigenen Angebots unbedingt erwähnen zu wollen, sollten wirklich nur die Highlights präsentiert werden. Anstatt die eigene Meinung zu Entwicklung, Produkt oder Angebot zu verkaufen, sollte es darum gehen, die vermeintliche Meinung und Mehrwert, den die Kundin haben wird, zu verkaufen. Denn: Entscheidend ist nicht, was man selbst fantastisch an dem eigenen Angebot findet, sondern das, was der Kunde an dem Angebot fantastisch finden könnte.
Nancy Rienow ergänzt: „Es ist nicht so, dass die US-Amerikaner nicht an Fakten interessiert wären. Die Frage ist nur, welche Fakten für sie wichtig sind oder sein könnten und wie detailliert man hier vorgehen sollte. Deutsche tendieren dazu, Details zu lieben. Für diese Detailverliebtheit, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit werden sie ja auch überall auf der Welt geschätzt. Im Gegenüber mit den USA laufen deutsche Unternehmen allerdings Gefahr, potenzielle Kunden mit zu vielen Details zu langweilen oder sogar abzuschrecken. Meine Empfehlung: Entscheiden Sie, welche Fakten wirklich wichtig sind, und präsentieren Sie zunächst nur diese. Beginnen Sie mit etwas, das die Aufmerksamkeit des Kunden weckt. Stellen Sie eine Frage, erzählen Sie eine Geschichte, und ja, betrachten Sie das Ganze ein wenig als Show. Seien Sie optimistisch und stolz auf das, was Sie präsentieren. Je besser Sie Ton und Geschmack des Kundenkreises treffen, desto erfolgreicher werden Sie sein.“
Amerikaner sind nie „out of office“
Amerikaner sind nie „out of office“. E-Mails werden immer beantwortet – auch an Wochenenden oder während eines Urlaubs. Ein zweiwöchiger Urlaub, ohne sich im Büro zu melden – in Deutschland ein völlig normaler Vorgang – ist für Amerikanerinnen und Amerikaner undenkbar. Service, 24/7-Erreichbarkeit wird in den USA großgeschrieben. Ein Gefühl, das trügt?
„Ein bisschen vielleicht. Im Durchschnitt haben die US-Amerikaner im Vergleich zu Deutschland allerdings wenig Urlaub. Damit sind sie per se schon einmal mehr am Arbeiten. Ob man aber wirklich immer erreichbar ist oder nicht, hängt natürlich, wie hierzulande auch, von der Tätigkeit ab: Verkäufer, Existenzgründer, Selbstständige und Unternehmen, die ihre Kunden direkt bedienen, sind in der Regel auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar. In den USA gibt es einen starken Wettbewerbsdruck – deswegen ist kundenorientiertes Denken das A und O. Der Kunde ist König.
Rund um die Uhr muss man aber auch in den USA nicht erreichbar sein. Dennoch sollten sich deutsche Unternehmen definitiv nach der US-Zeitzone richten sowie im Urlaub eine kompetente Vertretung stellen. Und ja: Für viele Amerikaner ist die Arbeit sehr wichtig und motivierend. Deswegen sind viele von ihnen in der Tat selten „out of office“.
„Ein bisschen vielleicht. Im Durchschnitt haben die US-Amerikaner im Vergleich zu Deutschland allerdings wenig Urlaub. Damit sind sie per se schon einmal mehr am Arbeiten. Ob man aber wirklich immer erreichbar ist oder nicht, hängt natürlich, wie hierzulande auch, von der Tätigkeit ab: Verkäufer, Existenzgründer, Selbstständige und Unternehmen, die ihre Kunden direkt bedienen, sind in der Regel auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar. In den USA gibt es einen starken Wettbewerbsdruck – deswegen ist kundenorientiertes Denken das A und O. Der Kunde ist König.
Rund um die Uhr muss man aber auch in den USA nicht erreichbar sein. Dennoch sollten sich deutsche Unternehmen definitiv nach der US-Zeitzone richten sowie im Urlaub eine kompetente Vertretung stellen. Und ja: Für viele Amerikaner ist die Arbeit sehr wichtig und motivierend. Deswegen sind viele von ihnen in der Tat selten „out of office“.
Failure is the Way to Sucess
In der US-amerikanischen Kultur gehört das Scheitern zum Geschäft: Aus Fehlern lernt man, sie führen oft erst zum Erfolg. So sagt man. Und in Deutschland? Da passen Fehler, Scheitern & Co. nicht wirklich zu vielen anderen Werten, die den Deutschen so eigen sind. Ihre Detailverliebtheit, die Genauigkeit, der Perfektionismus. Im Geschäftsleben hat diese Denke, die wirklich mehr als ein Klischee ist, durchaus Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von deutschen und amerikanischen Betrieben: Eigentlich passende Bewerber werden nicht zum Interview eingeladen, weil man die gerade Linie im Lebenslauf vermisst. Möglicherweise gute Handelspartner werden abgewiesen, da das Unternehmen schon einmal in Insolvenz gegangen ist…
„Niemand will wirklich scheitern, nicht einmal die US-Amerikaner! Aber in der Tat werden Fehler in den USA im Vergleich zu Deutschland definitiv weniger streng gesehen. Und die Meinung, dass Fehler dazu gehören, um wirklich erfolgreich zu sein, ist im Land, an Universitäten und Schulen und eigentlich allen Branchen und Betrieben präsent. Was ist denn wirklich ein Fehler? Ist es, wenn man nach einer anfänglich getroffenen Entscheidung die Richtung ändern muss, weil Informationen überholt sind oder sich äußere Faktoren geändert haben? Für Deutsche vielleicht – aber für die meisten Menschen in den USA wäre dies ein flexibles Reagieren auf Veränderungen“, antwortet Nancy Rienow. „Wenn ein Unternehmen scheitert, bedeutet das nicht unbedingt, dass es nicht mehr kreditwürdig ist. Die Kreditgeber werden vorsichtiger sein, aber in der Regel gibt es immer noch Chancen für einen Neuanfang. Er wird den gleichen Fehler wohl kaum noch einmal machen.“
„Niemand will wirklich scheitern, nicht einmal die US-Amerikaner! Aber in der Tat werden Fehler in den USA im Vergleich zu Deutschland definitiv weniger streng gesehen. Und die Meinung, dass Fehler dazu gehören, um wirklich erfolgreich zu sein, ist im Land, an Universitäten und Schulen und eigentlich allen Branchen und Betrieben präsent. Was ist denn wirklich ein Fehler? Ist es, wenn man nach einer anfänglich getroffenen Entscheidung die Richtung ändern muss, weil Informationen überholt sind oder sich äußere Faktoren geändert haben? Für Deutsche vielleicht – aber für die meisten Menschen in den USA wäre dies ein flexibles Reagieren auf Veränderungen“, antwortet Nancy Rienow. „Wenn ein Unternehmen scheitert, bedeutet das nicht unbedingt, dass es nicht mehr kreditwürdig ist. Die Kreditgeber werden vorsichtiger sein, aber in der Regel gibt es immer noch Chancen für einen Neuanfang. Er wird den gleichen Fehler wohl kaum noch einmal machen.“
Seidenpapier und Schleife
Fehler und Misserfolge gehören in den USA also zum Erfolg dazu. Wenn es aber zur Ansprache von Fehlern und Misserfolgen kommt, dann ist großes Fingerspitzengefühl seitens der Deutschen gefragt.
Auch wenn natürlich niemand gerne kritisiert wird, wird Kritik in Deutschland meistens sehr direkt und konkret angesprochen. Niemand redet hier groß um den heißen Brei herum. In den USA ist das anders – hier reagiert man auf Kritik höchst sensibel.
„Vielen US-Amerikanern fällt es schwer, sich von einer Idee, einem Vorschlag oder einer Handlung, die kritisiert oder nicht auf 100-prozentige Gegenliebe stößt, zu distanzieren. Kritik wird in den USA also vermutlich sehr viel schneller persönlich anstatt sachlich empfunden. Auch wenn US-Amerikaner also nicht so fehlerempfindlich sind wie die Deutschen, wollen sie diese auch nicht unter die Nase gerieben bekommen“, erzählt Nancy Rienow. „Es gibt immer natürlich immer Ausnahmen. In Situationen, in denen ein Thema äußerst problematisch oder dringlich ist, kann die Kritik direkter geäußert werden. Auch kann die Art und Weise, wie Kritik geäußert wird, übrigens nach dem geografischen Standort der betreffenden Person variieren. Menschen, die im Süden oder Mittleren Westen leben, neigen dazu, mit ihrer Kritik noch sanfter umzugehen als in anderen Gegenden des Landes“, schließt sie.
Kritik gehört in den USA also verpackt – am besten als Bonbon mit Seidenpapier und Schleife - zumindest aus deutscher Sicht. Immer sollten zuerst positive Aspekte betont werden, die Kritik dann eher indirekt und wirklich niemals vor einer Gruppe formuliert werden. An das Ende gehört ein positiver Ausblick. Seidenpapier und Schleife braucht es in der Zusammenarbeit mit Beschäftigten und Handelspartnerinnen und -partnern in den USA übrigens sowie sehr viel mehr als in Deutschland. Deutsche Arbeitnehmende erwarten in der Regel kein besonderes Lob von ihren Vorgesetzen, wenn sie ihre Arbeit ordentlich machen. In den USA ist man es hingegen gewohnt, von Klein auf gelobt und angespornt zu werden: „You can do it!“ oder „Everyone can be a winner!“
Auch wenn natürlich niemand gerne kritisiert wird, wird Kritik in Deutschland meistens sehr direkt und konkret angesprochen. Niemand redet hier groß um den heißen Brei herum. In den USA ist das anders – hier reagiert man auf Kritik höchst sensibel.
„Vielen US-Amerikanern fällt es schwer, sich von einer Idee, einem Vorschlag oder einer Handlung, die kritisiert oder nicht auf 100-prozentige Gegenliebe stößt, zu distanzieren. Kritik wird in den USA also vermutlich sehr viel schneller persönlich anstatt sachlich empfunden. Auch wenn US-Amerikaner also nicht so fehlerempfindlich sind wie die Deutschen, wollen sie diese auch nicht unter die Nase gerieben bekommen“, erzählt Nancy Rienow. „Es gibt immer natürlich immer Ausnahmen. In Situationen, in denen ein Thema äußerst problematisch oder dringlich ist, kann die Kritik direkter geäußert werden. Auch kann die Art und Weise, wie Kritik geäußert wird, übrigens nach dem geografischen Standort der betreffenden Person variieren. Menschen, die im Süden oder Mittleren Westen leben, neigen dazu, mit ihrer Kritik noch sanfter umzugehen als in anderen Gegenden des Landes“, schließt sie.
Kritik gehört in den USA also verpackt – am besten als Bonbon mit Seidenpapier und Schleife - zumindest aus deutscher Sicht. Immer sollten zuerst positive Aspekte betont werden, die Kritik dann eher indirekt und wirklich niemals vor einer Gruppe formuliert werden. An das Ende gehört ein positiver Ausblick. Seidenpapier und Schleife braucht es in der Zusammenarbeit mit Beschäftigten und Handelspartnerinnen und -partnern in den USA übrigens sowie sehr viel mehr als in Deutschland. Deutsche Arbeitnehmende erwarten in der Regel kein besonderes Lob von ihren Vorgesetzen, wenn sie ihre Arbeit ordentlich machen. In den USA ist man es hingegen gewohnt, von Klein auf gelobt und angespornt zu werden: „You can do it!“ oder „Everyone can be a winner!“
Code of Conduct
Es heißt, dass Verhaltensweisen und Äußerungen in den USA sehr viel schneller als diskriminierend oder sogar belästigend empfunden werden können und deutsche Unternehmen bei Gesprächen mit Job-Kandidaten, US-Kolleginnen und Geschäftspartnern höchst sensibel mit Aussagen und Fragen, die die Person betreffen, umgehen sollten. Auch Gleichstellung soll in den USA einen viel höheren Stellenwert haben, als dies in Deutschland der Fall ist.
„Rechtlich gesehen gibt es dazu in den USA klare Regeln. Fragen nach Alter, Familienstand oder Staatsangehörigkeit (rassischer Hintergrund/ethnische Zugehörigkeit), Geburtsort, Muttersprache, gesundheitlichen Beschwerden, körperlichen oder geistigen Einschränkungen, Drogen- oder Alkoholkonsum et cetera pp sind Tabu. Hier kann es durchaus Unterschiede zum deutschen Habitus geben – deutsche Betriebe, die in den USA Job-Interviews durchführen, sollten die Regeln kennen, sich schulen lassen oder einen US-Experten in Begleitung haben. Es gibt viele Möglichkeiten, über diese Themen zu sprechen, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen, wenn sie für das Tätigkeitsprofil entscheidend sind“, so Rienow.
Insgesamt müsse man in den USA aber wirklich sehr vorsichtig sein – besonders in der heutigen Zeit mit der "Me Too"-Bewegung, rassistischen Auseinandersetzungen und der zunehmenden, und auch abnehmenden Akzeptanz der sexuellen Identität eines Menschen, meint die Expertin. „Die USA ist derzeit als Land sehr gespalten und die Bevölkerung hat, je nach politischer oder religiöser Überzeugung unterschiedliche Ansichten darüber, was richtig und korrekt ist. Also können auch einfache Bemerkungen während eines Arbeitstages negativ wahrgenommen werden. So kann es beispielsweise als diskriminierend empfunden werden, Frauen als ‚Mädchen‘ zu bezeichnen oder harmlos und scherzhaft von den verschiedenen Geschlechtern zu sprechen, was in Deutschland in gewissen Situationen akzeptabel sein mag“, antwortet Nancy Rienow.
Fakt ist, dass deutsche Unternehmen in puncto Frauenanteil im Vorstand oder Führungspositionen im Vergleich mit den USA weit, weit hinten liegen. Eine männerlastige Führungsetage im deutschen Betrieb, ein Verhandlungsrunde nur mit dem männlichen Geschlecht – kann das in den USA wirklich zum Nachteil werden?
„Gleichberechtigung war und ist schon immer ein großes Thema in den USA gewesen. Als ich vor 29 Jahren mein damaliges Unternehmen auf einer Konferenz in den USA vertrat, erlebten wir diese Situation: Als die Organisatoren begannen, die Mitglieder unseres Teams vorzustellen, war ich noch nicht auf der Bühne. Sofort fragte das Publikum: "Gibt es keine Frauen?!?" Inzwischen ist viel passiert. Wenn deutsche Betriebe gute Frauen in ihren Teams haben, empfiehlt es sich in der Zusammenarbeit sicherlich, diese mit ins Boot zu holen. Bei Vorträgen und Diskussionsrunden mit mehreren Referierenden sollte am besten ein gutes Verhältnis zwischen den Geschlechtern sein. Ist dem nicht so, ist es natürlich kein ,Kick-out‘ für das Projekt oder den Auftrag. Wird allerdings darauf geachtet und stimmt alles weitere auch, dann könnte es den ,Kick-Off‘ beeinflussen.
„Rechtlich gesehen gibt es dazu in den USA klare Regeln. Fragen nach Alter, Familienstand oder Staatsangehörigkeit (rassischer Hintergrund/ethnische Zugehörigkeit), Geburtsort, Muttersprache, gesundheitlichen Beschwerden, körperlichen oder geistigen Einschränkungen, Drogen- oder Alkoholkonsum et cetera pp sind Tabu. Hier kann es durchaus Unterschiede zum deutschen Habitus geben – deutsche Betriebe, die in den USA Job-Interviews durchführen, sollten die Regeln kennen, sich schulen lassen oder einen US-Experten in Begleitung haben. Es gibt viele Möglichkeiten, über diese Themen zu sprechen, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen, wenn sie für das Tätigkeitsprofil entscheidend sind“, so Rienow.
Insgesamt müsse man in den USA aber wirklich sehr vorsichtig sein – besonders in der heutigen Zeit mit der "Me Too"-Bewegung, rassistischen Auseinandersetzungen und der zunehmenden, und auch abnehmenden Akzeptanz der sexuellen Identität eines Menschen, meint die Expertin. „Die USA ist derzeit als Land sehr gespalten und die Bevölkerung hat, je nach politischer oder religiöser Überzeugung unterschiedliche Ansichten darüber, was richtig und korrekt ist. Also können auch einfache Bemerkungen während eines Arbeitstages negativ wahrgenommen werden. So kann es beispielsweise als diskriminierend empfunden werden, Frauen als ‚Mädchen‘ zu bezeichnen oder harmlos und scherzhaft von den verschiedenen Geschlechtern zu sprechen, was in Deutschland in gewissen Situationen akzeptabel sein mag“, antwortet Nancy Rienow.
Fakt ist, dass deutsche Unternehmen in puncto Frauenanteil im Vorstand oder Führungspositionen im Vergleich mit den USA weit, weit hinten liegen. Eine männerlastige Führungsetage im deutschen Betrieb, ein Verhandlungsrunde nur mit dem männlichen Geschlecht – kann das in den USA wirklich zum Nachteil werden?
„Gleichberechtigung war und ist schon immer ein großes Thema in den USA gewesen. Als ich vor 29 Jahren mein damaliges Unternehmen auf einer Konferenz in den USA vertrat, erlebten wir diese Situation: Als die Organisatoren begannen, die Mitglieder unseres Teams vorzustellen, war ich noch nicht auf der Bühne. Sofort fragte das Publikum: "Gibt es keine Frauen?!?" Inzwischen ist viel passiert. Wenn deutsche Betriebe gute Frauen in ihren Teams haben, empfiehlt es sich in der Zusammenarbeit sicherlich, diese mit ins Boot zu holen. Bei Vorträgen und Diskussionsrunden mit mehreren Referierenden sollte am besten ein gutes Verhältnis zwischen den Geschlechtern sein. Ist dem nicht so, ist es natürlich kein ,Kick-out‘ für das Projekt oder den Auftrag. Wird allerdings darauf geachtet und stimmt alles weitere auch, dann könnte es den ,Kick-Off‘ beeinflussen.
Stand: 09.01.2024