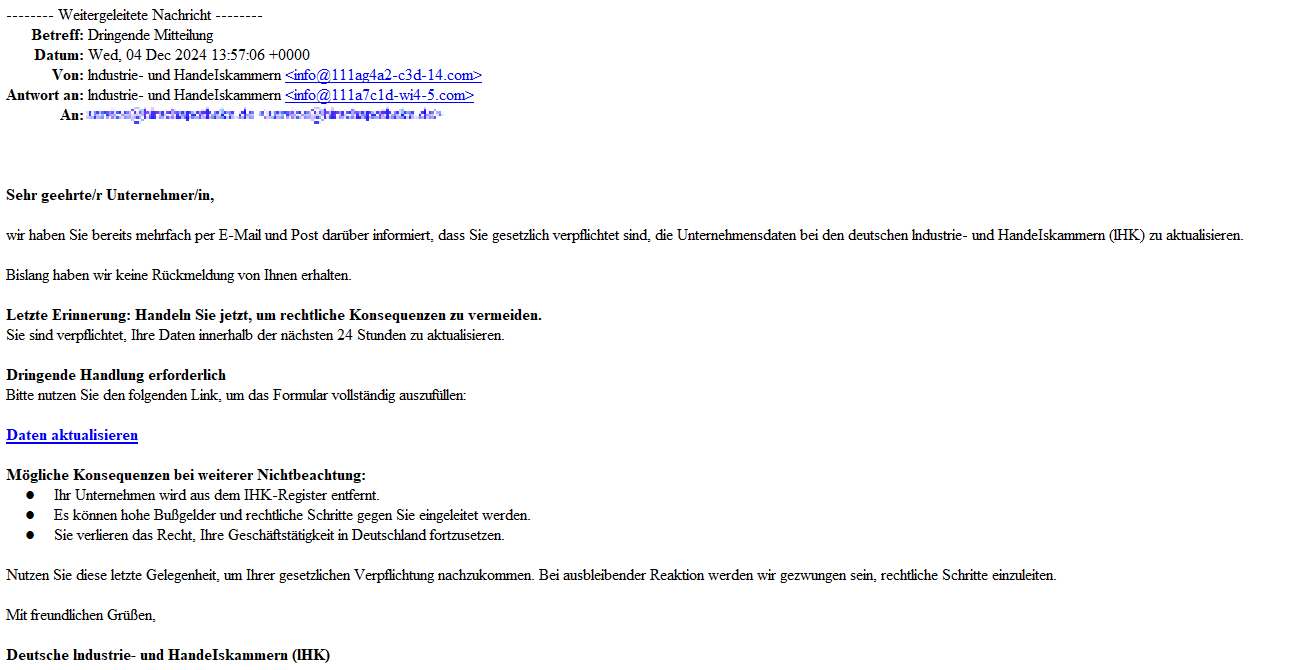Juni 2025
1. Arbeitsrecht
Kein Verzicht auf Mindesturlaub durch Vergleich
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern auch dann nicht verfallen, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt und auf die Urlaubstage verzichtet haben.
Im konkreten Fall war ein Arbeitnehmer, der als Betriebsleiter beschäftigt war, 2023 durchgehend bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses im April erkrankt. Im Rahmen des Vergleichs zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses hatten sich die Parteien auf eine Abfindung und einen „Urlaubsverzicht" geeinigt. Die Arbeitnehmerseite nahm die Vereinbarung unter Hinweis auf rechtliche Bedenken gegen die Regelung zum Urlaubsverzicht an.
Der Arbeitnehmer klagte daraufhin eine Urlaubsabgeltung in Höhe von 1.615,11 Euro nebst Zinsen ein.
Das BAG gab dem Arbeitnehmer Recht und entschied, dass der Verzicht auf den gesetzlichen Mindesturlaub unwirksam ist. Die Ansprüche auf bezahlten Erholungsurlaub sowie auf Abgeltung von nicht genommenem Urlaub bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses könnten nicht im Voraus ausgeschlossen oder beschränkt werden.
Dies gelte auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis durch einen Vergleich beendet werde und der Arbeitnehmer den Urlaub wegen Krankheit tatsächlich nicht habe nehmen können. Der Arbeitgeber müsse dem Arbeitnehmer die offenen Urlaubstage finanziell abgelten.
Die Botschaft des BAG ist eindeutig: Der gesetzliche Mindesturlaub kann nicht wirksam ausgeschlossen werden - auch nicht durch eine einvernehmliche Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer.
BAG, Urteil vom 3. Juni 2025; Az.: 9 AZR 104/24
Zeitnahe Kündigung nach Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Motiv des Arbeitgebers ist entscheidend
Ein Verstoß gegen das Maßregelungsverbot des § 612a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kann vorliegen, wenn der Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, weil der Arbeitnehmer mit der Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zugleich sein Recht geltend macht, nicht zur Arbeit erscheinen zu müssen Eine Kündigung aus Anlass einer Krankmeldung ist aber nur dann eine unzulässige Maßregelung, wenn gerade das zulässige Fernbleiben von der Arbeit sanktioniert werden soll. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen mit Urteil vom 28. März 2025 (Az.: 10 SLa 916/24 entschieden.
Die Parteien stritten im Wesentlichen um die Wirksamkeit einer Probezeitkündigung. Der Kläger hatte einen Arbeitsunfall erlitten und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 24. Januar 2024 eingereicht. Zwei Tage später kündigte ihm die Arbeitgeberin.
Das LAG sah darin keinen Verstoß gegen das Maßregelungsverbot nach § 612a BGB: Eine Kündigung aus Anlass einer Krankmeldung sei nur dann eine unzulässige Maßregelung, wenn gerade das zulässige Fernbleiben von der Arbeit sanktioniert werden solle. Wolle der Arbeitgeber dagegen den für die Zukunft erwarteten Folgen weiterer Arbeitsunfähigkeit vorbeugen, insbesondere Betriebsablaufstörungen, fehle es an einem unlauteren Motiv für die Kündigung, wie auch schon das Bundesarbeitsgericht entschieden habe.
In dem vorliegenden Fall ordnete das LAG den Ausspruch der Kündigung zwei Tage nach Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lediglich als zeitliche Koinzidenz ein und sah nicht genügend Anhaltspunkte für ein unlauteres Motiv.
Das LAG-Urteil ist abrufbar unter
2. Firmen-, Handels- und Gesellschaftsrecht
Handelsregistereintrag bleibt, auch wenn er falsch ist
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem aktuellen Beschluss entschieden, dass Gesellschafter nicht die Löschung einer Handelsregistereintragung über die Auflösung seiner Gesellschaft verlangen können - selbst wenn die Eintragung nicht der tatsächlichen Beschlusslage entspricht.
In dem verhandelten Fall war eine Gesellschafterin zu 36,4 Prozent an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) beteiligt. In der Gesellschafterversammlung stimmte sie gegen die Liquidation der Gesellschaft, während die Mehrheitsgesellschafterin dafür votierte. Grundsätzlich bedarf die beschlussweise Auflösung der Gesellschaft gemäß Paragraf 60 des Gesetzes der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) grundsätzlich einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen. Im Protokoll hieß es, es gebe keine solche Mehrheit. Dennoch wurde die Auflösung der GmbH später im Handelsregister eingetragen.
Die Minderheitsgesellschafterin beantragte daraufhin die Löschung dieser Eintragung. Sie argumentierte, dass die Auflösung nicht wirksam beschlossen worden sei. Doch weder das Registergericht noch das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main gaben ihrem Antrag statt.
Auch der BGH bestätigte die Entscheidung und stellte in seinem Urteil klar, dass eine fehlerhafte Eintragung im Handelsregister die subjektiven Rechte des Gesellschafters nicht verletze. Die Eintragung sei deklaratorisch und könne Auswirkungen auf das Verhalten von Geschäftspartnern haben, stelle aber keinen direkten Eingriff in die Rechte des Gesellschafters dar.
Zwar könne die Gesellschafterin im Zivilrechtsweg geltend machen, dass die eingetragene Auflösung nicht wirksam beschlossen worden seien und eine Liquidation der Gesellschaft daher unzulässig sei. Grundlegende Bestimmungen zur Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen seien im GmbHG nicht enthalten, sodass hier auf die gesetzlichen Regelungen in den Paragrafen 241 ff. Aktiengesetz (AktG) zurückgegriffen werden könne.
Eine Löschung der Eintragung im Handelsregister könne sie jedoch nicht verlangen.
BGH, Beschluss vom 7. Mai 2025; Az.: II ZB 15/24
Beschwerdebefugnis einer Personengesellschaft gegen Zurückweisung einer Anmeldung zum Handelsregister
Dem Beschluss des Kammergerichts Berlin (KG) vom 10. April 2025 (Az.: 22 W 12/25) lag der Sachverhalt zugrunde, dass eine GmbH & Co. KG im Handelsregister eingetragen war. Dort waren ein persönlich haftender Gesellschafter und zwei Kommanditisten (Herr EM und die T & Co.) eingetragen.
Nachdem Herr EM verstarb, wurde zur Eintragung im Handelsregister angemeldet, dass der Kommanditist EM aus der Gesellschaft ausgeschieden sei. Die Einlage sei auf die andere Kommanditistin übertragen. Unterzeichnet war diese Anmeldung vom Sohn des EM, Herrn AM, letzterer jeweils handelnd in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter für den persönlich haftenden Gesellschafter, die T & Co. sowie – unter Berufung auf eine transmortale Vollmacht – für Herrn EM.
Die GmbH & Co. KG wendete sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung durch das Amtsgericht. Im anwaltlichen Schriftsatz wurde „namens und in Vollmacht“ der GmbH & Co. KG Beschwerde eingelegt.
Die Beschwerde wurde als unzulässig abgewiesen, weil die GmbH & Co. KG nicht beschwerdebefugt sei. Durch die Zurückweisung der Anmeldung sei sie nicht unmittelbar in ihren eigenen Rechten beeinträchtigt. Denn durch die Zurückweisung einer Anmeldung, die auf die Eintragung von Tatsachen in Bezug auf eine Personenhandelsgesellschaft gerichtet sei, würden alle notwendigen Anmelder (vgl. § 108 Satz 1 HGB alter Fassung in Verbindung mit § 161 Absatz 2 HGB alter Fassung sowie § 106 Absatz 7, Absatz 6 HGB in Verbindung mit § 161 Absatz 2 HGB in der Fassung durch das MoPeG) beschwert und seien damit beschwerdeberechtigt, nicht aber die Personenhandelsgesellschaft selbst. Eine Auslegung der Beschwerdeschrift dahingehend, dass Beschwerde durch alle Gesellschafter eingelegt werde, scheide wegen des eindeutigen Wortlauts der Beschwerdeschrift aus.
Nachdem Herr EM verstarb, wurde zur Eintragung im Handelsregister angemeldet, dass der Kommanditist EM aus der Gesellschaft ausgeschieden sei. Die Einlage sei auf die andere Kommanditistin übertragen. Unterzeichnet war diese Anmeldung vom Sohn des EM, Herrn AM, letzterer jeweils handelnd in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter für den persönlich haftenden Gesellschafter, die T & Co. sowie – unter Berufung auf eine transmortale Vollmacht – für Herrn EM.
Die GmbH & Co. KG wendete sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung durch das Amtsgericht. Im anwaltlichen Schriftsatz wurde „namens und in Vollmacht“ der GmbH & Co. KG Beschwerde eingelegt.
Die Beschwerde wurde als unzulässig abgewiesen, weil die GmbH & Co. KG nicht beschwerdebefugt sei. Durch die Zurückweisung der Anmeldung sei sie nicht unmittelbar in ihren eigenen Rechten beeinträchtigt. Denn durch die Zurückweisung einer Anmeldung, die auf die Eintragung von Tatsachen in Bezug auf eine Personenhandelsgesellschaft gerichtet sei, würden alle notwendigen Anmelder (vgl. § 108 Satz 1 HGB alter Fassung in Verbindung mit § 161 Absatz 2 HGB alter Fassung sowie § 106 Absatz 7, Absatz 6 HGB in Verbindung mit § 161 Absatz 2 HGB in der Fassung durch das MoPeG) beschwert und seien damit beschwerdeberechtigt, nicht aber die Personenhandelsgesellschaft selbst. Eine Auslegung der Beschwerdeschrift dahingehend, dass Beschwerde durch alle Gesellschafter eingelegt werde, scheide wegen des eindeutigen Wortlauts der Beschwerdeschrift aus.
3. Steuerrecht
BFH: Keine willkürliche Preisaufteilung bei Menüangeboten
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 5. Juni 2025 (Az.: XI R 19/23) entschieden, dass bei sogenannten Kombiangeboten – etwa einem Menü bestehend aus Burger, Pommes und Getränk – die Umsatzsteueraufteilung sachgerecht erfolgen muss. Im konkreten Fall hatte ein Gastronom den Preis für das Getränk im Menü künstlich hoch angesetzt, um den ermäßigten Steuersatz auf Speisen zu maximieren.
Der BFH stellte in seinem Urteil klar, dass Einzelpreise innerhalb eines Menüs nicht höher angesetzt werden dürften als beim Einzelverkauf. Die Aufteilung müsse sich an den tatsächlichen Marktpreisen orientieren. Andernfalls drohten Nachzahlungen bei der Umsatzsteuer.
Für Gastronomiebetriebe bedeutet das: Wer Kombipakete anbietet, sollte die Preisgestaltung und die steuerliche Behandlung regelmäßig überprüfen – insbesondere bei Mischumsätzen mit unterschiedlichen Steuersätzen (7 % für Speisen, 19 % für Getränke).
BFH: Umsatzsteuerpflicht auf Beiträge bei coronabedingter Schließung von Fitnessstudios
Mit Urteil vom 13. November 2024 (Az.: XI R 5/23), das am 17. April 2025 veröffentlicht wurde, hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudios auch während pandemiebedingter Schließungen umsatzsteuerpflichtig bleiben – sofern keine Rückzahlung erfolgt und ein wirtschaftlicher Ausgleich gewährt wird.
Im vorliegenden Fall bot das Studio seinen Mitgliedern als Kompensation zusätzliche Nutzungsmonate an. Der BFH sah darin einen wirtschaftlich verwertbaren Vorteil, der einen steuerbaren Leistungsaustausch begründet. Eine Rückzahlung wäre Voraussetzung für eine Minderung der Umsatzsteuer – ein bloßer Anspruch genüge nicht.
Für die Praxis bedeutet das: Beiträge bleiben steuerpflichtig, wenn ein Ausgleich – etwa in Form von Zusatzleistungen – gewährt wird. Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen sollten ihre damalige Handhabung prüfen und steuerlich bewerten.
4. Wettbewerbsrecht
Hinweis auf Transitvisum
Gemäß einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt muss ein Reisevermittler darüber informieren, wenn für Reisen mit Zwischenstopp ein sogenanntes Transitvisum, also eine Durchreiseautorisierung, erforderlich ist.
Beklagt war ein Online-Portal, das Reisen vermittelt, unter anderem auch einen Flug von Zürich über Los Angeles nach Auckland. Jedoch gab es auf dem Portal bei der Flugbuchung keinen Hinweis darauf, dass für die USA ein Transitvisum, also eine Durchreiseautorisierung (ESTA), erforderlich ist. Eine Familie, die die entsprechende Flugroute gebucht hatte, konnte aufgrund des fehlenden Transitvisums den Flug am Abreisetag nicht antreten.
Beklagt war ein Online-Portal, das Reisen vermittelt, unter anderem auch einen Flug von Zürich über Los Angeles nach Auckland. Jedoch gab es auf dem Portal bei der Flugbuchung keinen Hinweis darauf, dass für die USA ein Transitvisum, also eine Durchreiseautorisierung (ESTA), erforderlich ist. Eine Familie, die die entsprechende Flugroute gebucht hatte, konnte aufgrund des fehlenden Transitvisums den Flug am Abreisetag nicht antreten.
Nach Ansicht des Gerichts ist die Information zur Erforderlichkeit etwaiger Durchreiseautorisierungen für einen Zwischenstopp jedoch als wesentlich für die Entscheidung des Verbrauchers über die Flugroute einzustufen. Insbesondere bei Buchungen kurz vor Reiseantritt könnte ein Transitvisum manchmal nicht mehr rechtzeitig beantragt werden. Daher müsse ein Hinweis auf etwaige Durchreiseautorisierungen durch den Portalbetreiber erfolgen.
OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 30. Juni 2025; Az.: 6 U 154/24 – nicht rechtskräftig
Werbung mit Kundenbewertungen
Seit 2022 sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, bei der Werbung mit Kundenbewertungen anzugeben, ob und gegebenenfalls wie sie die Echtheit der Bewertungen überprüfen.
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat diese Verpflichtung erneut bestätigt. In dem entschiedenen Fall hatte ein Angelverein gegen eine Angelschule geklagt, die im Internet mit Kundenbewertungen für ihre Leistungen geworben hatte – ohne dabei kenntlich zu machen, ob und wie die Echtheit der Bewertungen geprüft wurde.
Das Gericht stellte klar: Wer keine Maßnahmen zur Überprüfung der Echtheit von Bewertungen ergreift, muss darauf ausdrücklich hinweisen. Andernfalls liege ein Wettbewerbsverstoß vor. Die Beklagte hatte keine Maßnahmen zur Überprüfung der Kundenstellung ergriffen. Das Oberlandesgericht verurteilte die Beklagte zur Unterlassung.
Praxishinweis: Wer mit Kundenbewertungen wirbt, sollte unbedingt transparent darlegen, ob und wie die Echtheit der Bewertungen sichergestellt wird.
OLG Köln, Urteil vom 20. Dezember 2024; Az.: 6 U 59/24
5. Internetrecht
Neue Hinweise auf die Gestaltung eines Cookie-Banners auf Webseiten
Das Verwaltungsgericht (VG) in Hannover befasste sich mit der Aufmachung und Gestaltung eines Cookie-Banners. Folgende Aspekte waren aus Sicht des Gerichts im konkreten Fall entscheidend:
- Das Ablehnen von Cookies war deutlich umständlicher als das Akzeptieren;
- Nutzerinnen und Nutzer wurden durch ständige Banner-Wiederholungen zur Einwilligung gedrängt;
- die Überschrift „optimales Nutzungserlebnis“ und die Beschriftung „akzeptieren und schließen“ auf dem Schließen-Button waren irreführend;
- der Begriff der „Einwilligung“ fehlte vollständig;
- die Zahl der eingebundenen Partner und Drittdienste war nicht ersichtlich und
- Hinweise auf das Recht zum Widerruf der Einwilligung und eine Datenverarbeitung in Drittstaaten außerhalb der EU waren erst nach Scrollen sichtbar.
Das Gericht erkannte im Ergebnis, dass Nutzerinnen und Nutzer dadurch keine informierte, freiwillige und eindeutige Einwilligung gegeben hätten, wie es die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlange.
6. Zivilrecht, Gewerberecht, Gewerbliche Schutzrechte, Sonstiges
Fiktive Schadensabrechnung: Kein Vortrag zu tatsächlich getätigten Aufwendungen notwendig
Ist wegen der Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Geschädigte gemäß § 249 Absatz 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Der Geschädigte hat bei Ausübung der Ersetzungsbefugnis des § 249 Absatz 2 Satz 1 BGB die Wahl, ob er fiktiv nach den Feststellungen eines Sachverständigen oder konkret nach den tatsächlich aufgewendeten Kosten abrechnet.
Bei fiktiver Schadensabrechnung ist der objektiv zur Wiederherstellung erforderliche Betrag maßgeblich – unabhängig von einer tatsächlichen Reparatur und deren Kosten. Der Geschädigte muss nicht darlegen, ob, wie und zu welchem Preis er reparieren ließ.
In dem konkreten Fall entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH), dass
- eine Fiktive Abrechnung zulässig sei, ohne dass der Geschädigte tatsächliche Reparaturkosten oder Rechnungen vorlegen müsse,
- eine Abrechnung auf Basis eines Sachverständigengutachtens zulässig sei, auch wenn eine (ggf. günstigere) Reparatur stattgefunden habe und
- eine Verpflichtung zur Offenlegung tatsächlicher Reparaturkosten nicht notwendig sei, da die Möglichkeit zur fiktiven Abrechnung praktisch ausgehöhlt würde.
Das Urteil stärkt die fiktive Abrechnungspraxis und stellt klar: Der Geschädigte entscheidet, ob er fiktiv oder konkret abrechnet, ohne sich durch erfolgte Reparaturen rechtlich binden zu müssen.
BGH, Urteil vom 28. Januar 2025; Az.: VI ZR 300/24
7. Veranstaltungshinweise
Workshop für Führungskräfte
In diesem Workshop erhalten Sie einen praxisorientierten Überblick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Themen, die Sie als Führungskraft wissen sollten, um rechtssichere Unternehmensentscheidungen treffen zu können. Zudem erhalten Sie wertvolle Handlungsempfehlungen für Ihren Betriebsalltag.
Es werden folgende Themen behandelt:
- Chancen und Grenzen vorformulierter Arbeitsverträge
- Kontrolle, Weisungsrecht, Versetzungen
- Belohnungssysteme
- Grundlagen: Vertrag, Nebenpflichten Kündigung
- Ausgewählte Probleme aus der Praxis – Themen nach Wunsch der Teilnehmer
Der Workshop findet am 26.08.2025 von 14:00 bis 17:00 in 35390 Gießen, Flutgraben 4, statt.
Es referiert Herr Dr. Ali Machdi-Ghazvini. Das Teilnahmeentgelt beträgt 120,00 EUR.
Weitere Details und Anmeldungen unter IHK Gießen-Friedberg, Recht und Steuern, Christiane Bölitz-Reitz, Tel: 0641 7954-4025, Email: veranstaltungen@giessen-friedberg.ihk.de,
Update Arbeitsrecht 2025
In diesem Seminar werden die Teilnehmer über die neuesten Entwicklungen im Arbeitsrecht informiert. Es werden die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), des Bundesarbeitsgerichts (BAG) sowie verschiedener Landesarbeitsgerichte (LAGs) vorgestellt und diskutiert. Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie Personalverantwortliche, die ihr Wissen im Arbeitsrecht auf den neuesten Stand bringen möchten. Durch praxisnahe Fallbeispiele und Diskussionen werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, mit den aktuellsten rechtlichen Entwicklungen im Arbeitsrecht umzugehen.
Das Seminar findet am 02.09.2025 von 14:00 bis 17:00 in 35390 Gießen, Flutgraben 4, statt.
Es referiert Frau Rechtsanwältin Julia-Christina Sator. Das Teilnahmeentgelt beträgt 120,00 EUR.
Weitere Details und Anmeldungen unter IHK Gießen-Friedberg, Recht und Steuern, Christiane Bölitz-Reitz, Tel: 0641 7954-4025, Email: veranstaltungen@giessen-friedberg.ihk.de,
Umgang mit Krankheit, Langzeiterkrankung und Schwerbehinderung
In diesem Seminar erfahren Sie, auf was es bei Krankheit und Schwerbehinderung ankommt. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei auf
- Abgrenzung häufige Kurzerkrankungen und Langzeiterkrankung, dauerhafte Arbeitsunfähigkeit und krankheitsbedingte Leistungsminderung
- BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)
- Verdacht wahrheitswidriger Krankmeldungen
- Weiterarbeit trotz gelben Scheins
- Sportunfälle und Lohnfortzahlung
- Was ist während Krankheit erlaubt
- Krankheitsbedingte Kündigung
- Rechtliche Reaktionsmöglichkeiten
- Einbeziehung des Betriebsrats
Das Seminar findet am 09.09.2025 von 14:00 bis 17:00 in 35390 Gießen, Flutgraben 4, statt.
Es referiert Herr Dr. Heiko Reiter. Das Teilnahmeentgelt beträgt 120,00 EUR.
Weitere Details und Anmeldungen unter IHK Gießen-Friedberg, Recht und Steuern, Christiane Bölitz-Reitz, Tel: 0641 7954-4025, Email: veranstaltungen@giessen-friedberg.ihk.de,
„Wir richten uns nach Ihren Wünschen“
Sie sind auf der Suche nach einer Seminarveranstaltung und haben diese bisher nicht gefunden? Dann teilen Sie uns Ihre Themenwünsche doch einfach mit!
Sie sind auf der Suche nach einer Seminarveranstaltung und haben diese bisher nicht gefunden? Dann teilen Sie uns Ihre Themenwünsche doch einfach mit!
Ansprechpartner Recht:Dr. Sven Sudler, E-Mail: sven.sudler@giessen-friedberg.ihk.deCindy Mett, E-Mail cindy.mett@giessen-friedberg.ihk.de
Ansprechpartner Steuern:Elke Dietrich, E-Mail: elke.dietrich@giessen-friedberg.ihk.de
Stand: 26.06.2025